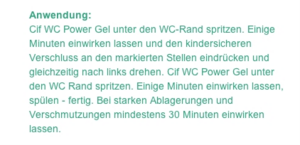Kundenbeziehungsmanagement - Schnittstelle Image
Lektion 8: Schnittstelle Nr. 6 – Das Image
In dieser Lektion müssen wir uns ausführlich mit dem Image beschäftigen. Besonderes Augenmerk gilt dem Social Web, das möglicherweise in Zukunft eine noch größere Rolle spielen wird, denn genau dort treten neue Herausforderungen auf, denen sich Unternehmen mit ihrem KBM stellen müssen.
Die heute immer noch wichtigste Schnittstelle ist eine Website. Meist sind diese schon mit gewissen interaktiven Funktionen ausgestattet und nicht immer funktionieren diese. Zur besseren Illustration sehen wir uns auch hier ein Beispiel an:
Beispiel 1: Neues vom Häusl
(Die Geschichte stammt vom Februar 2010, hat aber meiner Erfahrung nach nichts an Aktualität eingebüßt.)
Ich bin so stolz: Gestern durfte ich eine Flasche “Cif-24 h Gel extra dickflüssig Lemon fresh” erwerben, zwecks Reinigung meines WCs. Und wieder einmal beging ich den fatalen Fehler, einen einzigen Blick auf die Packung bzw. aufs Etikett zu werfen. So was darf man nicht tun, ich weiß, so was geht den Konsumenten nichts an, auch nicht den mündigen. Die Firmen werden schon wissen, was sie tun, die sind schließlich groß, ganz besonders die Unilever, die hinter der Marke Cif steckt.
Auf dem Etikett finde ich ein Siegel, eine wunderschöne blaue Weltkugel mit Sternchen, darunter steht “www.sustainable-cleaning.com”. Was das wohl heißen mag? Auf der Website blinken Sternchen und man verweist auf die Website von A.I.S.E, deren Initiative das sei. Es handelt sich um eine “Charter für nachhaltiges Waschen und Reinigen”. Man werde, so heißt es, von unabhängiger Seite überprüft, ob man bei der Herstellung der Produkte auch brav die “Nachhaltigkeit” berücksichtige. “Sicher und umweltschonend” würde man erzeugen, da man die Rohstoffe “sorgfältig” auswähle und sie sicher und effizient in der Erzeugung einsetze. Dann bekenne man sich noch zu “leicht verständlichen Informationen” auf den Verpackungen, die einen “sicheren und umweltverträglichen Gebrauch” gewährleisten würden. Zu guter Letzt stellen die Firmen, die der Charter angehören, noch Daten zur Verfügung, “mit denen die wirtschaftliche, soziale und ökologische Gesamtleistung” gemessen werden kann, und daraus entstünde dann ein jährlicher Nachhaltigkeitsbericht.
Wer genaueres wissen will, kann sich bei einer Telefonnummer erkundigen, die am Produkt drauf steht. Stimmt, in meinem Fall ist das eine kostenlose Nummer: 0800 206044, Unilever Austria. Oder man klickt einen Link an, dann kommt man zu den Daten des WKO-Fachverbandes der Chemischen Industrie, immerhin mit Ansprechpartner (Christian Gründling) und Telefonnummer 0590900 DW 3348.
Bleiben wir noch kurz bei der Seite. Wenn man im Menü die “Sicherheitsratschläge” anklickt, dann kommen ein paar allgemeine Ratschläge à la “Reinigungsmittel nicht trinken” oder “nachher gut lüften” sowie der Hinweis “Den Inhalt dieser Nachfüllpackung vollständig in den Originalbehälter nachfüllen.” Häh? Das ist eine Website, keine Nachfüllpackung. Waren die Programmierer besoffen? Hat sich das niemand angesehen, nachdem es online ging? Irgendwie erscheint mir das nicht besonders nachhaltig. (Glauben Sie nicht? So blöd kann niemand sein? Nachsehen: http://www.sustainable-cleaning.com/DE_safebehaviour.html)
Leider gibt es dann außer dem bisherigen Wischi-Waschi (eigentlich eh okay für eine Website über Reinigungsmittel) keine brauchbaren Informationen, nur Verweise auf verschiedene Initiativen, die dort wiederum sich selbst erklären. Wenn man auf die “Charter” klickt, kommt der Hinweis auf die Website (auf der man sich ja schon befindet) und wenn man auf die Website geht, kommt der Hinweis auf die Charter. Immerhin, ein wenig Kreislaufdenken dürfte da ja schon enthalten sein. Was ich nicht finde:
1.) Den Nachhaltigkeitsbericht, der ja groß angepriesen wird.
2.) Informationen, was denn nun wirklich getan wird, um nachhaltig zu sein. Woher kommen die Rohstoffe, welche werden verwendet, ist die Verpackung umweltfreundlich, wie soll ich sie entsorgen?
Nichts in der Art. Also gehe ich auf die Cif-Website, schließlich habe ich ja meinen lemonfrischen Reiniger vor mir. Dort wird es leicht bizarr, denn ein Werbespot beginnt unaufgefordert mich zu beschallen. Gott sei Dank kann ich ihn abschalten. Auch sonst wird hier geworben und man könnte auch selbst “loben oder tadeln”. Wenn man das allerdings versucht, landet man im Kontakt-Nirwana des Internets. Die aufpoppende Kontaktseite war leer, sie blieb so weiß wie die Wäsche, die man mit Unilever-Produkten waschen kann. Sie blieb übrigens nachhaltig leer, und zwar egal mit welchem Browser man es probiert (Safari, Firefox…) und wahrscheinlich bis in alle Ewigkeit. (Anmerkung: inzwischen 2012 funktioniert sie – Unilever hat reagiert und den Fehler ausgebessert.)
Ob das der einzige Fehler ist? Okay, Umlaute werden nur bei jedem zweiten Aufruf der Seite dargestellt, das rechne ich als Kleinigkeit. Sehr nett ist die Beschreibung über die Anwendung, die für mich den ersten Preis für Verständlichkeit und innere Logik bekommt. Hier im Original:
Haben die vor dem Programmieren vielleicht doch einen klitzekleinen Schluck vom WC-Reiniger genommen, so zum Testen? Die einzig brauchbare Information ist der Verweis auf die Seite www.cleanright.eu, wo sich tatsächlich genauere Informationen über die Nachhaltigkeitsprogramme finden lassen.
Griff zum Telefon. Eine sehr nette Dame meldet sich (und zwar sofort, ohne Warteschleife) und nimmt meine Wünsche entgegen, etwa die Frage, woraus die Flasche meines Cif-Reinigers besteht und wie man sie entsorgen soll. Ich brauche auch nicht lange warten, das schüttelt sie aus dem Ärmel: “Die Flasche ist aus Plastik und gehört in den Plastikmüll.” Kurze Sprachlosigkeit meinerseits, darauf wäre ich von alleine nicht gekommen. Meine Nachfrage, aus welcher Art Plastik denn die Flasche bestehe, kann sie leider nicht mehr beantworten, verspricht aber, mir das zu schicken. Ich wünsche mir noch den oben erwähnten Nachhaltigkeitsbericht und bin, sagen wir mal, mittelmäßig zufrieden. Ich erwähne noch die leere, blütenweiße Kontaktseite von Cif und sie verspricht, nachzusehen.
4 Stunden später: Die Antwort von Unilever ist da. Die Flasche besteht aus folgenden Bestandteilen: Flasche: – High density Polyethylen (HDPE) – Polyethylen (PE) Verschluss: – Polypropylen (PP)
Wikipedia sagt dazu folgendes:
“Polyethylen ist durch seine hohe Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und Chemikalien sehr langlebig und nicht natürlich abbaubar. Durch Sonneneinstrahlung kann PE verspröden und zerfällt dann in immer kleinere Teile, wird jedoch nicht von Bakterien, Tieren oder Pflanzen in den natürlichen Kreislauf integriert. Verpackungen aus PE überdauern die verpackten Produkte, wie Lebensmittel, um Jahrhunderte. Als sogenannter Plastikmüll verschmutzt PE ohne fachgerechte Entsorgung die Umwelt. Das bekannteste Beispiel ist der Müllstrudel im Pazifik. Hier hat sich im Nordpazifikwirbel (englisch „North Pacific Gyre“) ein gigantischer Müllteppich angesammelt.”
Soviel zum Thema Nachhaltigkeit, bei Unilever heißt das scheinbar: Schadstoffe halten sich besonders lange in der Umwelt!
Den Nachhaltigkeitsreport haben sie mir auch geschickt, leider ist das nicht der – möglicherweise spannende – Bericht unabhängiger Fachleute, sondern eine Art Werbeprospekt der Unilever, bunt mit Jubelbotschaften, was man nicht alles tut und wie sehr man Schadstoffe reduziert. Alles ist grün und bunt und viele Blumen und lachende Models wohin man schaut.
Weshalb erzeugt man nicht umweltfreundliche Flaschen, idealerweise wiederverwertbar? Oder nachfüllbare Flaschen, das würde sich bei so stabilen Flaschen wie der meines WC-Gels auszahlen, die könnte man Jahre lang benützen! Unilever könnte sogar Marktanteile halten, weil die KonsumentInnen eher das gleiche Produkt in die Flasche einfüllen und diese auch eine ständige Markenerinnerung wäre.
Es ist natürlich nicht nur die Website, sondern der gesamte Auftritt eines Unternehmens, der das Image prägt. Und natürlich gehören da auch Rechtsabteilung, Unternehmenssprecher etc. dazu. Besonders heikel ist der Auftritt in den Social Networks bzw. im gesamten Web 2.0 bzw. allen weiteren Internetformen, die da noch folgen mögen.
Wie dies schiefgehen kann und was daraus zu lernen ist, zeigt die Geschichte von Jack Wolfskin:
Beispiel 2: Das Jack-Wolfskin-Desaster
Welche Macht haben Facebook, Geizhals, YouTube und ähnliche Plattformen?
In der Internetplattform “Facebook” sammelt man Personen als “Freunde” und kann auch – je nach Einstellung – “Fans” haben. Seit 2010 gibt es eine Facebook-Gruppe mit dem Namen “Kann dieser seelenlose Ziegelstein mehr Freunde haben als H.C. Strache?”
Zum Zeitpunkt der Gründung obiger Gruppe (5. oder 6. Februar) hatte Herr Strache ca. 18.000 Fans und ca. 3.900 Freunde. Der Aufruf, der obigen Gruppe beizutreten, hatte am 10. Februar die Marke von 65.000 Fans überschritten.
Was hat das zu bedeuten? Ist das eine neue Form politischer Meinungsmache oder schlicht und einfach belanglos – etwa weil die Menschen aus Jux und Gaudi dieser Gruppe beitreten, dann aber bei der nächsten Wahl trotzdem für Strache stimmen?
Die Gründer der Gruppe bleiben auf Facebook im Verborgenen, es gibt lediglich eine nichtssagende E-mail-Adresse, es “steht” quasi niemand zur Gründung und Verantwortung dieser Gruppe. Aber: Ist das notwendig?
Der Standard und Die Presse berichteten jedenfalls bereits darüber und als demokratische Meinungsbildungsplattform ist Facebook sicher ein modernes Medium.
Die Frage nach der Wirkung wird jedoch bis zu entsprechenden wissenschaftlichen Forschungen ungeklärt bleiben müssen. Worin unterscheidet sich diese Form der Meinungsäußerung von der einer Demonstration auf der Ringstraße? Die Mobilisierung von Menschenmassen funktioniert im Internet erwiesenermaßen, wie der Sportartikelhersteller Jack Wolfskin schmerzlich zu spüren bekam, als er nachlässig auf Reklamationen reagierte und in sinnloser Weise auf seine Markenrechte pochte. Verärgerte Kunden riefen im Internet zum Boykott auf und der Umsatz von Jack Wolfskin sank erschreckend deutlich und erstaunlich schnell (manche sprechen von bis zu 50 % in einem halben Jahr, das ist jedoch nirgends bestätigt), so dass die Firma zu einer Änderung ihrer Geschäftspolitik gezwungen war.
Das Beispiel von Flashmobs (spontane Kundgebungen vieler Menschen auf öffentlichen Plätzen) zeigt, wie schnell und direkt die Verbindung zwischen Internet und “Realwelt” geknüpft werden kann.
Sehen wir uns genauer an, was hinter der Geschichte von Jack Wolfskin steht:
Die Firma ist einer der größten Outdoor-Equipment-Hersteller der Welt und gibt sich selbst ein junges, lockeres Image: Wettergegerbte Globetrotter, junge sportliche, fesche Menschen sind die bevorzugte Zielgruppe und so sehen auch die Testimonials aus. Man gibt sich weltoffen und modern.
Und dann kam jemand und verwendete das Logo. Da war es vorbei mit locker und weltoffen – so der Spiegel (Link: http://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/0,1518,655890,00.html):
a.) Die taz
Das Logo der Zeitung ist der Abdruck einer Tatze (auch „Tazze“ genannt). Roland Matticzk, der Erfinder des Logos, versäumte es jedoch, sich in den Gründungsjahren der taz die Rechte daran zu sichern. Das Unternehmen Jack Wolfskin registrierte in den 1980ern ein ähnliches Logo für sich. Den Rechtsstreit zwischen den beiden Unternehmen verlor die taz im Jahre 2002, was zur Folge hatte, dass sie die Tatze nun nicht mehr auf Produkte drucken darf, die zum Kerngeschäft von Jack Wolfskin gehören. Zudem darf sie die Tatze auf eigenen Produkten nur in Verbindung mit dem Zusatz „die tageszeitung“ nutzen.
Auch gegen die Abbildung einer daraufhin mit einem Kreuz überstickten „Tazze“ neben dem geforderten Schriftzug auf einem Badehandtuch, das über den verlagseigenen taz-Shop vertrieben wird, ging Jack Wolfskin vor: „Das ‚Durchstreichen‘ des Tatzensymbols (beinhaltet) eine rufschädigende Abwertung der bekannten Marke“, monierten die Anwälte.
b.) Die Handarbeitswerkstatt Dawanda
Mit voller Härte gegen die ganz Kleinen: Der Outdoor-Riese Jack Wolfskin mahnt ohne Vorwarnung Hobby-Handarbeiter ab, die im Web selbstgebastelte Ohrstecker, Taschenspiegel und Sticker verkaufen. Ihr Vergehen: Auf den Handarbeiten sind Pfotenabdrücke zu sehen.
Auf den ersten Blick wirkt Martina Hopf nicht wie eine Markenpiratin. Auf den zweiten, dritten und vierten auch nicht. Hopf verkauft beim Handarbeits-Portal Dawanda selbstgenähte Kirschkernkissen, Strampler, Stoffe und auch Stickdateien. Nun soll sie die Schneiderin viel Geld an die Anwaltskanzlei des Klamottenkonzerns Jack Wolfskin zahlen. Weil sie Stickdateien verkauft hat, mit denen man sich Herzchen, Sternchen und ein Katzenpfötchen auf alles mögliche sticken kann.
links die Jack-Wolfskin-Pfote, rechts die „Fälschung“, oben ein Produkt von DaWanda
Abmahnwürdig findet Jack Wolfskin daran das Pfötchenmuster. Denn so gut wie alles, was nach Pfötchen aussieht und verkauft wird, sieht der Konzern als Verletzung seiner Markenrechte. Der deutsche Outdoor-Riese hat in der Vergangenheit schon gegen die "taz" prozessiert und durchgesetzt, dass die Zeitung ihre "taz"-Pfote nicht einfach so auf Klamotten drucken darf. Nun hat Jack Wolfskin neue Gegner im Visier: Hobby-Schneider und Handarbeiter wie Martina Hopf.
Im Oktober verschickte die von Jack Wolfskin beauftragte Anwaltskanzlei Harmsen Utescher Abmahnungen per Einwurfeinschreiben mit angehängter Kostennote an Bastler, die Selbstgenähtes bei Dawanda verkaufen. SPIEGEL ONLINE liegen mehrere dieser Schreiben vor. Die von der Kanzlei errechneten Streitwerte (zwischen 20.000 und 25.000 Euro) und daraus abgeleiteten Gebühren (zwischen 850 und 1000 Euro) unterscheiden sich, die Formulierungen sind identisch. Die Kanzlei Harmsen Utescher erklärt den aus heiterem Himmel Abgemahnten erstmal einschüchternd, Jack Wolfskin gehöre, "wie Ihnen vermutlich bekannt ist, zu den führenden Herstellern von Outdoor-Equipment und Outdoor-Bekleidungsstücken", könne in der Bundesrepublik "die Marktführerschaft beanspruchen" und gehöre in Europa "zu den drei Marktführern".
"Die Tatze unserer Mandantin ist markenrechtlich geschützt"
Dann kommen die Juristen zur Sache: "Die Tatze unserer Mandantin ist in Deutschland und vielen Ländern der Welt umfangreich markenrechtlich geschützt." Gegen diese Markenrechte hätten die Abgemahnten Bastler mit ihrer Handarbeit verstoßen. Die Forderungen der Kanzlei: Binnen zwei Wochen sollen die Abgemahnten die beigefügte Unterlassungserklärung unterschrieben zurücksenden, binnen drei Wochen die Gebühren an die Kanzlei überweisen.
Wenn nicht, wird Ärger angedroht: "Für den Fall, dass die gesetzten Fristen fruchtlos verstreichen, werden wir unserer Mandantin empfehlen, ohne weitere Vorankündigung gerichtliche Schritte einzuleiten."
Jack Wolfskin bestätigt auf Anfrage von SPIEGEL ONLINE dieses Vorgehen. Firmensprecherin Lena Fischer erklärt: "Die typische Jack Wolfskin Tatze ist als Marke geschützt. Daher dürfen Dritte keine ähnlichen oder identischen Zeichen für ähnliche und identische Waren, wie sie Jack Wolfskin anbietet, im geschäftlichen Verkehr benutzen."
Jack Wolfskin sieht sich in der Abmahn-Pflicht
Das Unternehmen habe als Markeninhaberin "das Bestreben und die Pflicht, die Marke gegen ähnliche Drittzeichen zu verteidigen, da die Marke sonst geschwächt wird". Man prüfe mit den Anwälten in jedem Einzelfall sehr gründlich, ob die Voraussetzungen einer Markenverletzung vorliegen. Es seien nur Anbieter abgemahnt worden, "deren Produkte die Markenrechte von Jack Wolfskin auch wirklich verletzen". Die Abmahnungen gegen Dawanda-Anbieter seien "zwar bedauerlich", doch es handele sich hier "um eindeutige Markenrechtsverletzungen".
Es geht hier um Taschenspiegel, um Deckchen und kleine, niedliche Sticker, gebastelt von Heimarbeitern, die damit gewiss keine Millionenumsätze machen. Aber ihre Pfötchen-Designs sehen Jack Wolfskin zufolge der Firmenmarke einfach zu ähnlich. Sprecherin Fischer: "Anbieter, deren Artikel mit Pfotenabdrücken keine Ähnlichkeit zur Jack Wolfskin Tatze aufweisen, können ihre Artikel selbstverständlich weiter unbeanstandet verkaufen."
Überhaupt habe man nur Anbieter abgemahnt, die "im geschäftlichen Verkehr handeln". Laut Jack Wolfskin handelt ein Bastler gewerblich, wenn "in der Vergangenheit Verkäufe in einem gewissen Umfang getätigt wurden, wohingegen Kleinstanbieter, die beispielsweise nur ein oder zwei Produkte pro Jahr verkaufen, von uns natürlich nicht kontaktiert wurden".
Handarbeitern drohen 10.000 Euro Vertragsstrafe
Hier geht ein Konzern nicht gegen Markenpiraten vor, sondern gegen Heimarbeiter. Das vergisst man leicht, liest man die Erklärung, die die Heimarbeiter gegenüber dem Klamottenkonzern abgeben sollen. Laut den in den SPIEGEL ONLINE vorliegenden Dokumenten identischen Forderungen sollen die abgemahnten Handarbeiter:
- Jack Wolfskin denjenigen Schaden ersetzen, der der Firma durch ihre Handlungen "in der Vergangenheit entstanden ist, entsteht und in Zukunft noch entstehen wird".
- Jack Wolfskin binnen weniger Wochen "schriftlich Auskunft über die Umsätze" erteilen, "die mit dem Vertrieb erzielt wurden", über den "Umfang und die Art der getätigten Werbung, jeweils aufgegliedert nach Kalendervierteljahren, sowie nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten" und der erzielten Gewinne.
- Jack Wolfskin schriftlich Auskunft über Hersteller, Lieferanten und andere Vorbesitzer, gewerblichen Abnehmer der hergestellten, ausgelieferten, erhaltenen oder bestellten Waren geben.
Bei Verstoß gegen die unterzeichnete Erklärung sollen 10.000 Euro Vertragsstrafe drohen.
Das Problem der Abgemahnten: Es könnte sein, dass ein Gericht gegen Jack Wolfskin entscheidet und die Sache ähnlich bewertet wie die meisten Bürger mit gesundem Menschenverstand: Wie kann ein Taschenspiegel, ein Sticker, eine Ohrstecker, der nichts mit Outdoor zu tun hat, nirgends die Marke Wolfskin erwähnt und von ganz anders aussehenden Pfotenabdrücken bedeckt wird, der Millionen-Marke Wolfskin schaden? Es ist aber leider nicht sicher, dass ein Gericht so urteilt. Eine der Abgemahnten bringt es auf den Punkt:
"Wolfskin hat mehr Geld, um mit einem Batzen Gutachten auf die Verwechslungsgefahr zu pochen. Ich hatte zwar den Willen, aber einfach nicht das Geld, mich da irgendwie weiter zu rechtfertigen. Bei dem Streitwert kann nicht einmal ein befreundeter Anwalt tätig werden. Schon die Gebühren für Verfahren am Oberlandesgericht sind zu hoch."
Viele der Abgemahnten haben Angst vor den Anwälten des Konzerns, wollen deshalb nicht namentlich in Artikel erwähnt werden. Umso lauter ist der Aufschrei im Web - seitdem das rabiate Vorgehen Wolfskins bekannt wurde, empören sich Blogger über die Angstkampagne der Firma.
Kann man Ohrstecker mit Outdoor-Klamotten verwechseln?
Auch wenn es formaljuristisch korrekt ist - das Vorgehen des Bekleidungskonzerns wirkt in jeder Hinsicht überzogen. Jack Wolfskin schlägt mit der Abmahnkeule nicht auf professionelle Markenpiraten ein, die mit gefälschten Produkten Profit mit der Tatzen-Marke machen. Die Abmahn-Opfer sind Bastler, die gar nicht auf die Idee kommen, dass man ihre Werke mit den Kunststoff-Jacken und -Schuhen des Tatzen-Konzerns verwechseln könnte.
Die von Jack Wolfskin angeführte Gefahr einer Verwässerung der Marke besteht tatsächlich: Wenn ein Unternehmen nachweislich nicht gegen die Nutzung seiner geschützten Warenzeichen oder zumindest ähnlichen Mustern vorgeht, kann es sein, dass die Marke irgendwann vor Gericht nicht mehr gegen echte Markenpiraten verteidigt werden kann. Aber gegen die Verwässerungsgefahr muss man nicht mit Abmahnungen vorgehen. Ein freundliches Schreiben, das die Problematik erklärt und die Betroffenen bittet, ihre Muster anders zu gestalten, wäre ausreichend. Wer darauf nicht reagiert, kann immer noch abgemahnt werden.
So ein Schreiben mit dem Hinweis auf die Markenproblematik wäre besserer Stil als eine Abmahnung mit Kostennote ohne Vorwarnung.
Wolfskin: "Kleinhändler für Entstehung der Kosten verantwortlich"
Das sieht Jack Wolfskin ganz anders. Ob es tatsächlich notwendig sei, verhältnismäßig kleine Anbieter gleich abzumahnen? Natürlich. Wolfskin-Sprecherin Fischer: "Auch derartige Kleinanbieter sind, wenn sie sich mit ihren Produkten in den geschäftlichen Verkehr begeben, dazu verpflichtet, vor Bewerbung und Verkauf dieser Produkte die Verletzung von Markenrechten Dritter zu überprüfen beziehungsweise auszuschließen."
Man habe bei den Handarbeiter-Fällen darauf geachtet, "die Kosten möglichst gering zu halten". Dass die Kosten in Höhe von 991 Euro für Kleinunternehmer "noch immer verhältnismäßig hoch" sind, gesteht die Wolfskin-Sprecherin ein. Aber: "Der Kleinhändler ist für die Entstehung der Kosten verantwortlich, da er markenverletzende Ware verkauft hat und wir dadurch zur Verteidigung unserer Marke gezwungen waren." Und überhaupt diene so eine Abmahnung der "schnellen und relativ kostengünstigen Beendigung der Angelegenheit".
Eine Botschaft, die man durchaus als Drohung verstehen kann, hat Jack Wolfksin noch: Eine Abmahnung verhindere "zusätzliche häufig weit höhere Kosten im Falle einer Einschaltung der Gerichte".
Jack Wolfskin reagiert auf Kritik beim Vorgehen zum Markenschutz Idstein, 23. Oktober 2009 – Die zum Teil heftigen Reaktionen im Internet auf das Vorgehen von Jack Wolfskin in Fällen von Markenrechtsverletzungen führen zu einem Einlenken des Unternehmens. Gegen die zehn Anbieter, die Produkte mit Tatzen-Design auf der Plattform DaWanda.de verkauft hatten und daraufhin von Jack Wolfskin abgemahnt wurden, werden keine weiteren rechtlichen Schritte mehr verfolgt. „Der Schutz unserer Marke hat für uns oberste Priorität“, sagt Manfred Hell, Geschäftsführer von Jack Wolfskin. „Wir sind immer bemüht, mit Augenmaß und nur dort vorzugehen, wo wir unsere Schutzrechte wirklich gefährdet sehen. Die zum Teil heftige Kritik unserer Kunden in den aktuellen Fällen der DaWanda-Anbieter nehmen wir ernst und zum Anlass, unser Vorgehen kritisch zu hinterfragen. Dies bedeutet, dass wir mit dem Entfernen der betroffenen Produkte von der Internetplattform die Fälle als erledigt ansehen, keine weiteren rechtlichen Schritte verfolgen und den Anbietern die vor allem kritisierten Kosten erlassen.“ Darüber hinaus wird Jack Wolfskin sein Vorgehen in Fällen von kleingewerblichen Angeboten verändern. Hier wird das Unternehmen in Zukunft zunächst auf anwaltliche Schritte verzichten und selbst Kontakt aufnehmen. Kommt es zu einer Einigung, sollen Kosten möglichst ganz vermieden werden. Anwaltliche Hilfe soll in Zukunft erst ein letzter Schritt sein. Weiterhin sagt Manfred Hell: „An der großen Emotionalität, mit der die Debatte geführt wurde, sehen wir, wie hoch die Erwartungshaltung an uns ist. Dem wollen wir gerecht werden. Wir haben uns der Kritik gestellt, unser Vorgehen kritisch durchleuchtet und werden in Zukunft sensibler agieren.“
Pressekontakt: JACK WOLFSKIN Ausrüstung für Draussen GmbH & Co. KGaA Limburger Str. 38-40 65510 Idstein Tel.: 06126 / 954-445 Fax: 06126 / 954-169 e-Mail: presse@jack-wolfskin.com
Sehen wir uns nun auszugsweise eine Reaktion im werbeblogger.de an
Kretin am 23. Oktober 2009 um 13:25 Uhr
Zitat von Manfred Hell: “An der großen Emotionalität, mit der die Debatte geführt wurde, sehen wir, wie hoch die Erwartungshaltung an uns ist. Dem wollen wir gerecht werden. Wir haben uns der Kritik gestellt, unser Vorgehen kritisch durchleuchtet und werden in Zukunft sensibler agieren.”
Übersetzung:
Wir hatten nicht damit gerechnet, dass es zu einem solchen Aufstand kommt, weil wir das schließlich seit Jahren so machen. Bisher sind wir damit noch immer durchgekommen. Ärgerlich nur, dass die Leute, die uns unser Image als ehrliche Naturburschen (und unser Zeug) bisher abgekauft haben, jetzt mitbekommen haben, dass wir den Raubtierkapitalismus neu definiert haben. Bevor das Desaster für uns jetzt noch größere Ausmaße annimmt, fressen wir etwas Kreide und hoffen, dass sich die Wogen bis zum Weihnachtsgeschäft noch glätten lassen. Wir werden versuchen, uns in Zukunft nicht wieder erwischen zu lassen.
Was hat das alles bewirkt?
In erster Linie Widerstand, der sich mittels verschiedener Ideen im Internet zeigte. Im folgenden ein paar Beispiele dafür, was kreative Köpfe im Netz verbreitet haben:
Aufgabe Lektion 8
1.) Wie hätte CIF auf meine Anfrage besser reagieren können?
2.) Mit welcher Art von KBM haben wir es bei Jack Wolfskin zu tun? Wie wären Sie an deren Stelle vorgegangen?