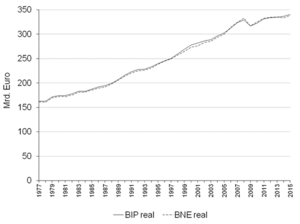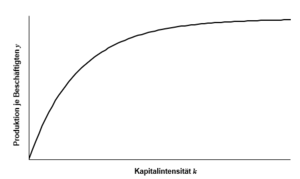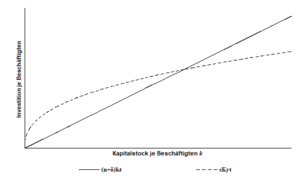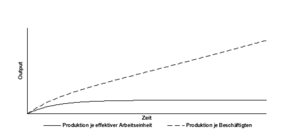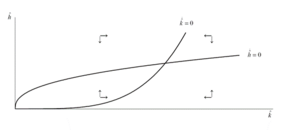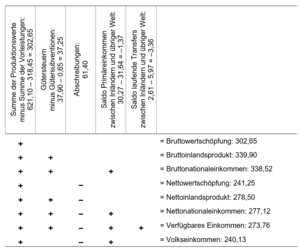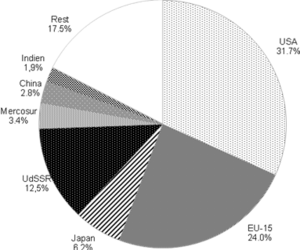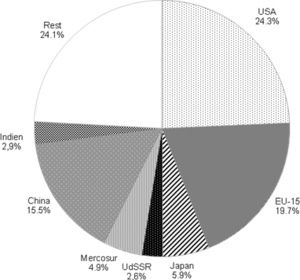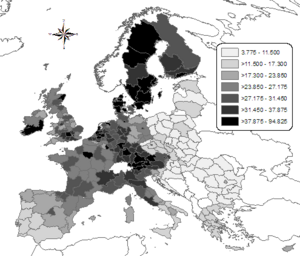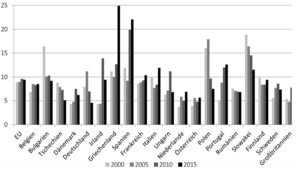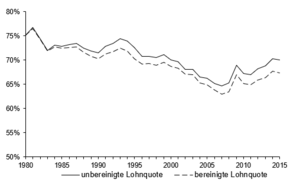Angewandte Makroökonomik - Gesamt
Sascha Sardadvar studierte Volkswirtschaft an der Universität Wien, der FU Berlin und der Wirtschaftsuniversität Wien. Er hat zahlreiche Artikel in regional- und wirtschaftswissenschaftlichen Fachzeitschriften veröffentlicht und habilitierte sich im Sommer 2015 im Fach Economic Geography and Regional Science. Zu seinen Forschungsschwerpunkten zählen Theorie und Empirie regionalen Wirtschaftswachstums, Ursachen und Auswirkungen interregionaler Arbeitsmigration sowie Fragen der Innovationsökonomik.
Einleitung
Die Lehrveranstaltung „Angewandte Makroökonomik“ hat zum Ziel, zentrale makroökonomische Konzepte so darzustellen, dass sie bei strategischen Entscheidungsfindungen auf Unternehmensebene nützlich sind. Insbesondere sollen makroökonomische Entwicklungen, die das Umfeld von Unternehmen beeinflussen, verständlich und auf diese Weise in Entscheidungen auf Unternehmensebene integrierbar werden. Die Lehrveranstaltung verbindet Theorie und Empirie: Die Studierenden sollen erstens in die Lage versetzt werden, die grundlegenden theoretischen Konzepte zu verstehen, welche wirtschaftspolitischen Entscheidungen und langfristigen Entwicklungen zugrunde liegen. Zweitens werden die damit verbundenen empirischen Konzepte diskutiert und zahlreiche Beispiele mit Österreich-Bezug gegeben, sodass die Studierenden mit im Alltag gebrauchten Begriffen wie Bruttoinlandsprodukt, Arbeitslosenquote oder Lohnquote vertraut sind. Aufgrund der gesellschaftspolitischen Relevanz der Inhalte ermöglicht das Studium des Skriptums auch den Erwerb einer Kritikfähigkeit laufender Entwicklungen und öffentlicher Diskussionen.
Die Lehrveranstaltung ist so konzipiert, die im Bachelor-Abschnitt thematisierte Makroökonomie erstens zu erweitern, und zweitens einzelne Fragestellungen zu vertiefen. Die Studierenden sollen nach Abschluss in der Lage sein, gesamtwirtschaftliche Fragen des langfristigen Wachstums sowie Fragen der Beschäftigung und der Verteilung selbständig beurteilen zu können. Die Lehrveranstaltung gliedert sich entsprechend in zwei Lektionen: Wachstumstheorie sowie Arbeit, Löhne und Gewinne.
Die erste Lektion widmet sich der Wachstumstheorie und somit der Frage, wodurch langfristiges Wachstum einer Volkswirtschaft determiniert wird. In Kapitel 1.1 erfolgt eine Abgrenzung zur kurzfristigen Wachstumstheorie (Konjunkturtheorie), wie sie im Bachelor-Studium behandelt wurde, sowie eine einführende Diskussion der relevanten Größen. Kapitel 1.2 leitet das grundlegende neoklassische Wachstumsmodell (Solow-Modell) her und beschreibt die Erweiterungen um technologischen Fortschritt und Humankapital. Im folgenden Kapitel 1.3 wird die Theorie im Zusammenhang mit der Beobachtung global unterschiedlicher Wohlstandsniveaus diskutiert. Kapitel 1.4 widmet sich empirischen Messkonzepten sowie weltweiten und europäischen Ausprägungen der Disparitäten.
In der zweiten Lektion wird der Fokus auf Arbeitsmarkttheorie und damit verbundenen Fragestellungen gerichtet. Kapitel 2.1 bietet eine Einführung in keynesianische Ansätze der Arbeitsmarkttheorie, daran anschließend werden in Kapitel 2.2 Theorie und Praxis der Lohnbildung erläutert. Nach der theoretischen Behandlung stehen in Kapitel 2.3 empirische Konzepte der Arbeitsmarktentwicklung und Einkommensverteilung, und schließlich in Kapitel 2.4 ihre empirische Entsprechung für Österreich im Mittelpunkt.
Wachstumstheorie
Gegenwärtig ist explizit oder implizit Ziel jeder Volkswirtschaft, die Produktion auszuweiten. Mit Fragen dieses Wachstums verbunden ist, ob sich das Outputniveau (die gesamte Produktion innerhalb einer Periode) verschiedener Ökonomien im Zeitverlauf angleicht, oder ob sich bestehende Disparitäten weiter vertiefen. Seit der Industriellen Revolution und insbesondere mit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wird einerseits eine permanente Ausweitung der Produktion und somit ein langfristig positives Wirtschaftswachstum verzeichnet – zumindest in jenen Volkswirtschaften, die man als Industriestaaten bezeichnet. In Kapitel 1.1.1 wird das langfristige vom kurzfristigen Wachstum abgegrenzt, bevor in Kapiteln 1.1.2 die neoklassische Produktionsfunktion als Grundlage als grundlegende Annahme der modernen Wachstumstheorie vorgestellt wird; anschließend wird in Kapitel 1.1.3 die Dynamik des neoklassischen Wachstumsmodells diskutiert. In Kapitel 1.2 wird die Produktionsfunktion vom Typ Cobb-Douglas eingeführt, um das neoklassische Wachstumsmodell in Kapitel 1.2.1 in Verbindung mit technologischem Fortschritt, in Kapitel 1.2.2 mit Kapitalakkumulation und Wachstum, und in Kapitel 1.2.3 mit Humankapital zu anzuwenden.
Grundlagen der Wachstumstheorie
Wenn in der Ökonomie von Wachstum die Rede ist, so ist damit grundsätzlich das gemeint, was im allgemeinen Sprachgebrauch Wirtschaftswachstum genannt wird. Das Einsparen zweier Silben im Jargon der Ökonomen verdeutlicht unmissverständlich die Bedeutung des Themas; dennoch ist es nötig, eine weitere Abgrenzung vorzunehmen: Wenn in der öffentlichen Diskussion das Wirtschaftswachstum zum Thema wird – und das ist ausgesprochen oft der Fall – so ist fast immer das kurzfristige Wachstum gemeint. Meistens bezieht man sich auf ein Jahr, ein mittlerer Horizont von drei bis fünf Jahren wird schon sehr viel seltener diskutiert. Die Wachstumstheorie hingegen geht weit darüber hinaus und legt das Erkenntnisinteresse vor allem auf die langfristige Entwicklung der Produktion. Um nationale und internationale Entwicklungen sowie politische Entscheidungen richtig interpretieren zu können ist es nötig, zu verstehen, nach welchen Mechanismen moderne Ökonomien funktionieren.
Kurzfristiges versus langfristiges Wachstum
In den bisherigen Lektionen des Bachelor-Studiengangs, die sich mit makroökonomischen Fragestellungen auseinandersetzen, [1] stand die Frage im Mittelpunkt, wie das Wirtschaftswachstum kurzfristig gesteuert werden kann. Es wurde gezeigt, wie die Produktion und somit das Einkommen via Geld- und Fiskalpolitik beeinflusst werden kann, etwa über Änderungen im Zinssatz, im Preisniveau oder bei der Nachfrage. Im Anschluss wurde der Einfluss des Auslands via Nachfrage und Wechselkurse diskutiert. Die entsprechende Politik dient vor allem der Stabilität, um hohe Inflation und Arbeitslosigkeit zu vermeiden. Marktwirtschaftliche Systeme sind durch Konjunkturzyklen gekennzeichnet, einem ständigen Auf und Ab der wirtschaftlichen Entwicklung: Auch ohne Rezession kann das Wachstum wie im Falle Österreichs seit den 1970er-Jahren von annähernd null bis über fünf Prozent jährlich betragen. [2] Ganz offensichtlich würde es langfristig einen enormen Unterschied machen, ob man nahe null über fünf Prozent wächst.
Angesichts solcher Schwankungen und der enormen Auswirkungen auf Lebensstandard und Wohlstand, den ein anhaltender Unterschied um das Vierfache bei der Wachstumsrate hätte, drängt sich die Frage auf, ob das langfristige Wachstum von den selben Determinanten bestimmt wird wie das kurzfristige Wachstum. Die Darstellung der Entwicklung in Österreich von 1977 bis 2015 in Abb. 1.1 zeigt, wie Krisen und Boom-Phasen aus der längerfristigen Perspektive
verblassen. Deutlich erkennbar ist hingegen bis zum Krisenjahr 2008 ein stetiges Wachstum im Lauf der Zeit. Die jährlichen Ausreißer im Rahmen der Konjunkturzyklen relativieren sich langfristig und fallen in der Abbildung kaum ins Auge: Im Mittel liegt das BIP-Wachstum im Beobachtungszeitraum bei 1,97%, es ist seit den 1970er-Jahren bis zum Ausbruch der Krise über die Jahre weder ein Abwärts- noch ein Aufwärtstrend der mittelfristigen Wachstumsrate zu beobachten. Seit Ausbruch der Krise 2008 wächst Österreichs Wirtschaft wieder, allerdings scheint es, als ob die Krise Österreichs Wachstum um eine Stufe gedrückt hätte: Die Kurven des BIP und des BNE zeigen einen Verlauf, als kostete die Krise Österreich 4 Prozent seines Wohlstands, seither entwickelt sich die Wirtschaft wie gehabt.
Man kommt der Frage nach den Determinanten des langfristigen Wachstums näher, wenn man sich vergegenwärtigt, dass Wirtschaftswachstum keine historische Notwendigkeit darstellt. Die Ökonomien Mitteleuropas wuchsen über Jahrhunderte kaum oder gar nicht, und auch heute ist in vielen Ländern der Erde das Wachstum der Gesamtwirtschaft geringer als jenes der Bevölkerung, sodass das BIP je Einwohner sogar schrumpft (z.B. in Ländern Zentralafrikas). Erst mit der Industriellen Revolution kam es zu einer erheblichen Ausweitung der Produktion, die in den Industrie-Staaten bis heute anhält. Wachstum lässt sich jedoch nicht nur in diesen, sondern in vielen, mitunter gänzlich unterschiedlich organisierten Ökonomien beobachten. Daraus folgt, dass eine Theorie, die das Wachstum in den wohlhabenden, kapitalistisch organisierten Volkswirtschaften erklären kann, auch erklären muss, warum es einerseits in anderen Systemen Wachstum gibt, aber andererseits in der Vergangenheit und in der Gegenwart in vielen Teilen der Welt kein Wachstum beobachtet wird.
Gedanken zum Wirtschaftswachstum als Folge von Produktivitätsfortschritten finden sich bereits bei den klassischen Ökonomen. Adam Smith [3] unterstreicht insbesondere die Bedeutung der Arbeitsteilung, [4] geht aber nur am Rande auf technologischen Fortschritt als solchen ein. David Ricardo [5] beschäftigt sich ausführlicher mit den Auswirkungen der Mechanisierung der Arbeitsprozesse, d.h. mit dem, was wir heute als „technologischen Fortschritt“ bezeichnen. Wie Smith vor ihm kommt jedoch auch Ricardo zu dem Schluss, dass auch die Entwicklung und der Einsatz von Maschinen die Ökonomie lediglich näher in Richtung eines stationären Zustands bringen: Demnach werden Produktivitätsfortschritte stets dazu führen, dass die Bevölkerung weiter wächst. Die Wirtschaft kann schließlich nur so lange wachsen, bis Kapitalakkumulation und Bevölkerungszahl ihr jeweiliges Maximum erreicht haben.
Karl Marx [6] greift die grundlegenden Gedanken von Smith und Ricardo auf und entwickelt ein Modell, das bereits die wesentlichen Aspekte der modernen Wachstumstheorie berücksichtigt, insbesondere die tragenden Rollen des technologischen Fortschritts und der Kapitalakkumulation. Die kapitalistisch organisierte Produktion führt zu einer ständigen Ausweitung der Produktion als Folge technischer Neuerungen und Investitionen. Marx kommt zum Schluss, dass dieser Prozess nicht endlos fortgesetzt werden kann, vielmehr führen mittel- bis langfristiges Wirtschaftswachstum zu einem Rückgang der Nachfrage nach dem Faktor Arbeit, was letztlich zu einem Systemwechsel führt. Marx’ Wachstumsmodell beschreibt das Wachstum einer kapitalistisch organisierten Ökonomie, und es bleibt offen, ob bzw. wie der Wachstumsprozess in einer kommunistisch organisierten Wirtschaft fortgesetzt würde.
Etwa 70 Jahre nach Marx finden sich auch bei John Maynard Keynes Gedanken über die langfristigen Auswirkungen technologischen Fortschritts, in seiner Theorie fokussiert er jedoch auf kurzfristige Wachstumspolitik. Allen vier genannten Ökonomen gemein ist, dass sie erhebliche Zweifel an einem immerwährenden Wirtschaftswachstum haben, bzw. ein solches erst gar nicht in Betracht ziehen. Die Frage, ob Wirtschaftswachstum auf Dauer möglich ist, stellt sich auch heute und hat insbesondere seit Ausbruch der Krise 2008 wieder an Aufmerksamkeit gewonnen. Die Diskussion über mögliche „Grenzen des Wachstums“ wird wissenschaftlich allerdings eher selten innerhalb der Ökonomie geführt, eher geht es um die Vereinbarkeit mit anderen Zielen, insbesondere Umweltschutz. Ob die Produktion in diesem Jahrhundert weiter steigen wird wie im vergangenen und welche Auswirkungen dies auf Gesellschaft und Umwelt hat, vermag niemand vorherzusehen. Festzuhalten ist allerdings, dass die Empirie bislang keine Hinweise auf ein Ende des Wachstums zeigt. Es kommt allerdings auch darauf an, was man unter „Wachstum“ konkret versteht. Wie weiter unten gezeigt wird, ist das BIP nur eine Möglichkeit, Wachstum zu messen, aber nicht notwendigerweise jene, die der Vorstellung von Wohlstandsvermehrung – denn darum geht es letzten Endes – tatsächlich entspricht. Ob etwa Umweltverschmutzung und Ressourcenabbau berücksichtigt werden, ist eine Frage der Konvention, aber kein konzeptioneller Widerspruch.
Ausgangspunkt der modernen Wachstumstheorie ist das Modell von Robert Solow [7] von 1956, auf dem die neoklassische Wachstumstheorie basiert. Ihr Modellrahmen hat sich bis heute als sehr robust erwiesen und repräsentiert in gewisser Weise eine ideale Theorie: Sie baut auf einigen wenigen, sinnvollen Annahmen auf, ist dabei in der Lage, eine Vielzahl beobachtbarer Phänomene zu erklären und schließt inkonsistente Entwicklungen aus. Im Unterschied zu den oben skizzierten Theorien ist sie nicht an ein bestimmtes Wirtschaftssystem gebunden, d.h. sie ist für kapitalistische, kommunistische und andere denkbare Organisationsformen anwendbar. In der Theorie gibt es im Gegensatz zur klassischen Ökonomie auch kein Ende des Wachstums: Statt eines stationären Zustands („stationary state“) strebt die Ökonomie einem Steady-State entgegen, womit ein Wachstum bei konstanter Rate gemeint ist. Anders formuliert gibt es in der modernen, neoklassischen Wachstumstheorie kein Ende des Wachstumsprozesses.
Die neoklassische Produktionsfunktion
Entscheidend für das Verständnis der neoklassischen Wachstumstheorie sind zwei kritische Annahmen: Erstens, die Ökonomie ist durch eine aggregierte Produktionsfunktion charakterisiert, in der im einfachsten Fall die beiden Faktoren Arbeit und Kapital in grundsätzlich beliebigen Einsatzverhältnissen berücksichtigt werden. [8] Zweitens ist diese Produktionsfunktion durch konstante Skalenerträge bei abnehmenden Grenzerträgen gekennzeichnet. Beide Annahmen werden im Folgenden beschrieben.
Die aggregierte Produktionsfunktion
Die neoklassische Produktionsfunktion hat die grundlegende Form:
Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle Y_t=f(K_t,L_t ) } (1.1)
Wie bisher steht Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle Y} für Output, wobei die Betrachtung auf eine geschlossene Volkswirtschaft beschränkt ist und somit Output mit Einkommen gleichgesetzt werden kann. [9] Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle K} bezeichnet den gesamten Sachkapitalbestand (Maschinen etc.) der Ökonomie und das gesamte Arbeitsangebot, wobei Letzteres unter der Annahme von Vollbeschäftigung identisch mit der eingesetzten Arbeit ist. Die Zeit, gekennzeichnet als , ist nur indirekt in der Produktionsfunktion über die Variablen , und vertreten. Die Gleichung (1.1) kann somit gelesen werden als: Der Output zum beliebigen Zeitpunkt ist eine Funktion der zum selben Zeitpunkt eingesetzten Mengen von Arbeit und Kapital.
Die Produktionsfunktion in Gleichung (1.1) stellt eine erhebliche Vereinfachung der Realität dar, als sie nur jeweils einen Typ Arbeit und Kapital kennt, also unterstellt, dass für jede Einheit Arbeit (ob Schweißer oder Krankenschwester) wie für jede Einheit Kapital (ob Traktor oder Bürogebäude) gilt, dass sie gleich produktiv sind und die gleiche Funktion erfüllen. In Kapitel 2.2.1 wird gezeigt, wie die Lockerung dieser Annahme das Modell realistischer macht, ohne die Hauptergebnisse zu ändern. Zunächst sei auf eine weitere implizite Annahme der Produktionsfunktion hingewiesen: Aus der Reduzierung auf Arbeit und Kapital ergibt sich, dass alle anderen Einflüsse in der langen Frist verhältnismäßig unwichtig sind, insbesondere Boden und natürliche Ressourcen. Das liegt zum einen daran, dass die Menge an Boden nicht veränderbar ist; insbesondere aber spielen diese Faktoren für moderne Ökonomien nur untergeordnete Rollen. [10] In Man beachte außerdem, dass die Instrumente der Wirtschaftspolitik keine Berücksichtigung finden: Auf lange Sicht werden wirtschaftspolitisch- und konjunkturbedingte Schwankungen vom langfristigen Trend dominiert, in der Produktion also ausgeglichen. Ziel des Modells ist folglich, die Determinanten des langfristigen Trends zu identifizieren. [11]
Skalen- und Faktorerträge
Während sich die klassische Ökonomie intensiv mit der Frage beschäftigte, wie eine stetig wachsende Bevölkerung bei konstantem Boden versorgt werden kann, bzw. wie sich der Einsatz von Maschinen auf den Faktor Arbeit auswirkt, führt die Vernachlässigung von natürlichen Ressourcen und Arbeitslosigkeit in der neoklassischen Wachstumstheorie zur zweiten kritischen Grundannahme, nämlich jener konstanter Skalenerträge. [12] Diese Annahme lässt sich einfach veranschaulichen: Sie bedeutet, dass bspw. eine Verdoppelung der Faktoren Arbeit und Kapital auch den Output verdoppeln wird. Formal muss für Gleichung (1.1) gelten:
Oder allgemein für jede beliebige, nichtnegative Konstante :
Diese wichtige Annahme ist zugleich eine Einschränkung, denn sie besagt, dass die Ökonomie hinreichend groß ist, sodass sie von einer Spezialisierung nicht weiter profitieren kann. Dies ist wichtig zur Unterscheidung von kleineren, regionalen Ökonomien, die etwa aufgrund von Agglomerationseffekten mitunter steigende Skalenerträge aufweisen (vgl. Kapitel 1.3.2). Das Solow-Modell, wie es im Folgenden beschrieben wird, bildet hinreichend große Ökonomien, d.h. Volkswirtschaften bzw. relativ große Regionalökonomien, ab.
Wenn hingegen nicht alle, sondern nur ein Faktor an Volumen zunimmt, gilt das Gesetz des abnehmenden Grenzprodukts. [13] Umgelegt auf eine Volkswirtschaft stellt sich auch hier die Frage, was passiert, wenn ein Faktor zunimmt, während der oder die anderen konstant bleiben. Ist etwa noch wenig Kapital vorhanden, so wird eine zusätzliche Einheit die Produktion erheblich erhöhen. Ist jedoch umgekehrt bereits reichlich Kapital vorhanden (etwa in Form von Traktoren oder Bürogebäuden), so werden weitere Einheiten kaum noch zur Produktion beitragen. Parallel verhält es sich mit dem Faktor Arbeit.
Die Annahme konstanter Skalenerträge erlaubt es, die Produktionsfunktion in intensiver Form darzustellen: Setzt man in Gleichung (1.3) ein, so erhält man den Output je eingesetzter Einheit Arbeit: Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \frac{Y_{t}}{L_{t}}=f\left(\frac{K_{t}}{L_{t}}, \frac{L_{t}}{L_{t}}\right)=f\left(\frac{K_{t}}{L_{t}}, 1\right) } (1.4)
Im Folgenden bezeichnet Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle y_t=Y_t/L_t } die Produktion je Beschäftigten zum Zeitpunkt Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle t} , und Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle k_t=K_t/\partial } die Kapitalintensität zum Zeitpunkt Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle t} . Gleichung (1.4) kann daher angeschrieben werden als: Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle y_t=f(k_t) } (1.5)
Die Produktion je Beschäftigten ist somit eine Funktion der Kapitalintensität. Die Annahme abnehmender Grenzerträge lässt sich durch die Bedingungen Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle f^{\prime}(k)>0} und Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle f \prime \prime (k)<0} ausdrücken und wird in Abb. 1.2 veranschaulicht.
Analog zur Kostengleichung eines einzelnen Anbieters [14] folgen zwei wichtige Implikationen des Modells: Im Gleichgewicht werden beide Faktoren Arbeit wie Kapital nach ihrem jeweiligen Grenzprodukt bezahlt. Daraus folgen das Lohnniveau zum Zeitpunkt Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle t} Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle w_t=(\partial Y_t)/(\partial L_t ) } (1.6)
und der Gewinnsatz zum Zeitpunkt Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle t} Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle r_t=(\partial Y_t)/(\partial K_t ) } (1.7)
[CHART]
Aus der Identität der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung folgt, dass die Summe der Löhne und Gewinne dem Gesamtprodukt entsprechen: Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle Y_t=w_t L_t +r_t K_t } (1.8)
Während die Entstehungsrechnung durch Gleichung (1.1) repräsentiert ist, verdeutlicht Gleichung (1.8) die Verteilungsrechnung: Das zum Zeitpunkt Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle t} in einer Ökonomie entstandene Einkommen entspricht der Summe der Löhne Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle w_t \partial } und der Gewinne (Kapitaleinkommen) Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle r_t K_t} . Der gesamte Output als das gesamte produzierte Einkommen lässt sich außerdem aufteilen in Konsum und Investitionen, d.h. Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle Y_t} lässt sich auch als Verwendungsrechnung darstellen: Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle Y_t=C_t+I_t } (1.9)
wobei Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle C} den gesamten Konsum und Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle I} die gesamten Investitionen bezeichnet. In einer geschlossenen Ökonomie sind Produktion und Ausgaben somit zwangsläufig identisch. Eine offene Ökonomie unterscheidet sich insofern, als durch Einkommen, die im Ausland oder vom Ausland erzielt werden, Gleichungen (1.8) und (1.9) nicht zwangsläufig übereinstimmen.
Die Dynamik des Modells
Es wird angenommen, dass die Produktionsfaktoren mit exogen bestimmter, konstanter Rate wachsen. Unter der Annahme, dass das Arbeitsangebot mit derselben Rate wie die Bevölkerung wächst bzw. identisch mit ihr ist, gilt: Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \dot{L}_{t}=n L_{t} } (1.10)
wobei ein Punkt über einer Variable deren Ableitung nach der Zeit symbolisiert und Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle n} die Rate des Bevölkerungswachstums ist. Die neoklassische Wachstumstheorie zeigt hier eine wesentliche Abweichung von den Annahmen der klassischen Gedanken zum Wirtschaftswachstum: Die Bevölkerung wächst nicht mehr mit der Wirtschaft, sondern losgelöst von ihr. Folglich kommt es in der neoklassischen Theorie nicht zwangsläufig zu einem stationären Zustand, sondern ein stetiges Wachstum pro Kopf ist möglich.
Es folgt aus Gleichung (1.10), dass zu jedem beliebigen Zeitpunkt Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle t} Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle L_{t}=L_{0} e^{n t} } (1.11)
wobei Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle e} für die Eulersche Zahl steht und Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 0} einen beliebigen Beginn eines Beobachtungszeitraums markiert. Man beachte, dass im Falle Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle n>0} aufgrund der abnehmenden, aber stets positiven Grenzproduktivität des Faktors Arbeit die gesamte Produktion Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle Y} ceteris paribus ein positives Wachstum verzeichnet, während die Produktion je Beschäftigten zurückgeht. Anders formuliert: Ein positives Wirtschaftswachstum je Beschäftigten bei zugleich positivem Bevölkerungswachstum kann es nur geben, wenn zugleich die Kapitalintensität und/oder die Arbeitsproduktivität steigt. Die erste Möglichkeit soll im Folgenden behandelt werden, ehe im nächsten Kapitel die Bedeutung des technologischen Fortschritts beleuchtet wird:
Der Anteil des Outputs, der investiert wird, entspricht der Sparquote und ist exogen gegeben und konstant. Eine investierte Einheit Output entspricht einer neuen Einheit Kapital. Kapitalgüter müssen jedoch von Zeit zu Zeit erneuert werden, da der vorhandene Kapitalstock verfällt. Die Investitionsgleichung nimmt daher folgende Form an: Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \dot{K}_{t}=s_{K} f\left(K_{t}, L_{t}\right)-\delta K_{t}=s_{K} Y_{t}-\delta K_{t} } (1.12)
Die Variable Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle s_K} bildet die Sparquote ab, während Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \delta } die Abschreibungsrate bezeichnet. Gleichung (1.12) ist die Schlüsselgleichung des Solow-Modells und beschreibt die Kapitalakkumulation als elementaren Prozess der industriellen Produktion: Ein Teil der Produktion wird konsumiert, der andere Teil wird reinvestiert. Zugleich verbraucht sich der bereits vorhandene Kapitalstock und muss daher permanent erneuert werden. Der Term Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle s_K Y_t} entspricht folglich den Bruttoinvestitionen zum Zeitpunkt Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle t} , während die Nettoinvestitionen durch die gesamte Gleichung Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle s_{K} Y_{t}-\delta K_{t}=\dot{K}_{t}} dargestellt sind.
Für den gesamten Kapitalstock einer Ökonomie gilt somit,
dass er dann steigt, wenn der linke Term in Gleichung (1.12) größer ist als der rechte, d.h. wenn Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle s_K Y_t>\delta K_t} ,
dass er konstant bleibt wenn Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle s_K Y_t=\delta K_t} und somit Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \dot{K}_{t}=0}
dass er fällt, wenn Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle s_K Y_t<\delta K_t} .
Analog lässt sich die Investitionsgleichung je Beschäftigten ausdrücken: Da Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle k_t=K_t/L_t } , folgt aus der Quotientenregel Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \dot{k}_{t}=\frac{\dot{K}_{t} L_{t}-K_{t} \dot{L}_{t}}{L_{t}^{2}}=\frac{\dot{K}_{t}}{L_{t}}-\frac{K_{t}}{L_{t}} \frac{\dot{L}_{t}}{L_{t}} } (1.13)
Es folgt aus den Gleichungen (1.12) und (1.13) Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \dot{k}_{t}=\frac{s_{K} Y_{t}-\delta K_{t}}{L_{t}}-\frac{K_{t}}{L_{t}} \frac{\dot{L}_{t}}{L_{t}}=s_{K} y_{t}-\delta k_{t}-n k_{t}=s_{K} y_{t}-(n+\delta) k_{t} } (1.14)
Aus Gleichung (1.14), der Entwicklung des Kapitalbestands je Beschäftigten über die Zeit, lassen sich weitere Schlüsse ziehen:
Erstens, der Kapitalstock je Beschäftigten bleibt konstant wenn Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle s_K y_t=(n+\delta )k_t} : Demnach muss ein höheres Bevölkerungswachstum durch eine höhere Sparquote ausgeglichen werden. Passiert dies nicht, wird der Kapitalstock je Beschäftigten und somit die Produktion je Beschäftigten sinken, auch wenn gleichzeitig die Gesamtproduktion steigt.
Zweitens, in einer betrachteten Ökonomie mag zu Beginn eines beliebigen Beobachtungszeitraums Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 0} der Fall Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle s_K y_t\neq (n+\delta )k_t} gegeben sein. Egal von welchem Punkt aus die Ökonomie startet, sie wird bei fixen Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle s_K} , Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle n} und Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \delta } sowie Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle k_t>0} stets zum Gleichgewicht Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \dot{k}_{t}=0} streben.
Drittens muss für die Sparquote Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle s_K<1} gelten, da es sonst keinen Konsum (einschließlich Grundnahrungsmittel) gäbe. Sie kann also nicht beliebig erhöht werden.
Abb. 1.3 veranschaulicht diese Zusammenhänge: Die Gerade zeigt jenes Brutto-Investitionsniveau je Beschäftigten Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle (n+\delta )k_t} , das erforderlich ist, um den Kapitalstock je Beschäftigten aufrecht zu erhalten. Die strichlierte Kurve zeigt das tatsächliche Brutto-Investitionsniveau Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle s_K y_t} : Ist es höher als das erforderliche Investitionsniveau, wird der Kapitalstock je Beschäftigten steigen, und vice versa – so lange, bis beide exakt gleich hoch sind.
Aus dem Fundament des neoklassischen Wachstumsmodells können bereits zwei Hauptergebnisse des Modells formuliert werden:
- Eine Erhöhung der Sparquote wird für eine gewisse Zeit das Wachstum erhöhen, bis die Ökonomie beim neuen Gleichgewichtspunkt angelangt ist. Um das Wachstum ab diesem Zeitpunkt wieder zu erhöhen, muss abermals die Sparquote erhöht werden. Da die Sparquote jedoch nicht den Wert eins erreichen kann, kann eine fortwährende Erhöhung der Sparquote nicht auf Dauer aufrechterhalten werden. Bleibt die Sparquote konstant, so hat sie auf die langfristige Wachstumsrate der Produktion je Beschäftigten keinen Einfluss.
- Die Sparquote bestimmt jedoch die Höhe des Produktionsniveaus: Eine höhere Sparquote führt langfristig zu einem höheren Niveau der Produktion je Beschäftigten.
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass es nur zwei Möglichkeiten gibt, damit Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle y} , die Produktion je Beschäftigten, wächst: Entweder erhöht sich die Kapitalintensität, d.h. dem Faktor Arbeit steht pro Einheit mehr Kapital zur Verfügung – dieses Szenario wurde soeben durchleuchtet. Oder die Arbeit wird selbst produktiver – dieses Szenario steht im Mittelpunkt des folgenden Kapitels.
Das Solow-Modell und seine Erweiterungen
Einen häufig angewendeten, nichtsdestoweniger speziellen Fall einer Produktionsfunktion, die die geforderten Bedingungen erfüllt, ist jene vom Typ Cobb-Douglas: Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle Y_{t}=K_{t}^{\alpha} L_{t}^{1-\alpha}, \quad 0<\alpha<1 } (1.15)
wobei Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \alpha } die Elastizität des Produktionsfaktors Kapital, und Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 1-\alpha } die Elastizität des Produktionsfaktors Arbeit bezeichnet. Indem beide Seiten der Gleichung (1.15) durch den Faktor Arbeit dividiert werden, erhält man die Produktion je Beschäftigten (Arbeitsproduktivität oder einfach Produktivität): Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle y_{t}=\frac{Y_{t}}{L_{t}} \Rightarrow y_{t}=k_{t}^{\alpha} } (1.16)
Aus Gleichung (1.16) geht bereits hervor, dass unter Abstraktion anderer Einflüsse die Produktivität mit steigendem Kapitaleinsatz grundsätzlich steigt. Anders ausgedrückt zeigt Gleichung (1.16) nichts anderes, als dass mehr Maschinen menschliche Arbeit produktiver machen. Im Folgenden wird die Produktionsfunktion vom Typ Cobb-Douglas angewendet, um den langfristigen Verlauf einer Volkswirtschaft zu beschreiben.
Technologischer Fortschritt
Das vorige Kapitel endete mit der Feststellung, dass zur langfristigen Produktionssteigerung die Produktivität des Faktors Arbeit erhöht werden muss. Um dies zu veranschaulichen, kann die Cobb-Douglas-Produktionsfunktion nun wie folgt angeschrieben werden: Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle Y_{t}=K_{t}^{\alpha}\left(A_{t} L_{t}\right)^{1-\alpha}, \quad 0<\alpha<1 } (1.17)
Die zusätzliche Variable Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle A_t} repräsentiert den technologischen Stand (das abstrakte Wissen) zum Zeitpunkt Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle t} . Diese allgemein verfügbare Technologie wächst mit konstanter Rate Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle g} , daher gilt analog zum Bevölkerungswachstum Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \dot{A}_{t}=g A_{t} } (1.18)
und folglich zu jedem beliebigen Zeitpunkt Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle A_{t}=A_{0} e^{g t} } (1.19)
Daraus folgt, dass die gesamte Produktion zum Zeitpunkt dargestellt werden kann als: Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle Y_{t}=K_{t}^{\alpha}\left(A_{0} e^{g t} L_{0} e^{n t}\right)^{1-\alpha} \Rightarrow Y_{t}=K_{t}^{\alpha}\left(A_{0} L_{0}\right)^{(1-\alpha)} e^{(1-\alpha)(g+n) t} } (1.20)
[CHART]
Es gibt nun zwei Möglichkeiten, die Produktion je Beschäftigten in intensiver Form darzustellen: Erstens, beide Seiten aus Gleichung (1.17) werden durch den Faktor Arbeit dividiert, und man erhält die Produktion je Beschäftigten: Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \frac{Y_{t}}{L_{t}}=K_{t}^{\alpha} L_{t}^{-\alpha} A_{t}^{1-\alpha} \Rightarrow y_{t}=k_{t}^{\alpha} A_{t}^{1-\alpha} } (1.21)
Aus Gleichung (1.21) folgt eine weiteres Hauptergebnis des Solow-Modells: Es wurde bereits festgehalten, dass die Sparquote nicht beliebig erhöht werden kann. Nimmt man nun an, dass die Sparquote langfristig konstant ist, sich die Ökonomie im Gleichgewichtszustand Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle s_K y_0=(n+\delta )k_0} befindet, und die allgemein verfügbare Technologie mit konstanter Rate Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle g} wächst, so folgt daraus, dass die Produktion je Beschäftigten langfristig mit ebendieser Rate Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle g} wächst. Dieses Wachstum wird als Steady-State-Wachstum oder Gleichgewichtswachstum bezeichnet.
Die zweite Möglichkeit zur Darstellung in intensiver Form besteht darin, beide Seiten aus Gleichung (1.17) durch die Variablen Arbeit und Technologie zu dividieren und auf diese Weise Produktion je Beschäftigten um den technologischen Fortschritt zu korrigieren. Es mag an dieser Stelle zunächst verwirren, die Technologie zuerst einzuführen, bloß um sie anschließend wieder herauszurechnen, doch wie noch zu sehen ist, vereinfacht es die folgenden Berechnungen; dargestellt wird die Produktion je effektiver Arbeitseinheit: Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \frac{Y_{t}}{A_{t} L_{t}}=K_{t}^{\alpha} L_{t}^{-\alpha} A_{t}^{-\alpha} \Rightarrow \hat{y}_{t}=\hat{k}_{t}^{\alpha} } (1.22)
wobei Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \hat{y} =Y_t/A_t L_t } den Output je effektiver Arbeitseinheit darstellt, während Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \hat{k}=K/AL} den Kapitalstock je effektiver Arbeitseinheit bezeichnet. Man sieht, dass
Gleichung (1.22) Gleichung (1.16) sehr ähnlich ist und kann nun festhalten, dass die Produktion je effektiver Arbeitseinheit in der langen Frist konstant bleibt. Dieser Zusammenhang wird in Abb. 1.4 veranschaulicht.
Kapital und Produktion im Zeitverlauf
Die Determinanten des Wachstums zeigen sich bei der weiteren Behandlung des Outputs je effektiver Arbeitseinheit. Analog zu Gleichung (1.12) gilt für die Gesamtwirtschaft unter Einbeziehung des technologischen Fortschritts: Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \dot{K}_{t}=s_{K} f\left(K_{t}, A_{t} L_{t}\right)-\delta K_{t} } (1.23)
da Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \hat{k}_{t}=K_{t} /\left(A_{t} L_{t}\right)} folgen aus der Quotientenregel sowie der Produktregel Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \dot{\hat{k}}_{t}=\frac{\dot{K}_{t} A_{t} L_{t}-K_{t}\left(\dot{A}_{t} L_{t}+A_{t} \dot{L}_{t}\right)}{A_{t}^{2} L_{t}^{2}}=\frac{\dot{K}_{t}}{A_{t} L_{t}}-\frac{K_{t} \dot{A}_{t} L_{t}}{A_{t}^{2} L_{t}^{2}}-\frac{K_{t} A_{t} \dot{L}_{t}}{A_{t}^{2} L_{t}^{2}} } (1.24)
Es folgt daher aus den Gleichungen (1.12), (1.21) und (1.24) Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \dot{\hat{k}}_{t}=\frac{s_{K} f\left(K_{t}, A_{t} L_{t}\right)-\delta K_{t}}{A_{t} L_{t}}-\frac{K_{t} \dot{A}_{t} L_{t}}{A_{t}^{2} L_{t}^{2}}-\frac{K_{t} A_{t} \dot{L}_{t}}{A_{t}^{2} L_{t}^{2}}=s_{K} \hat{y}_{t}-\delta k_{t}-g k_{t}-n k_{t}=s_{K} \hat{y}_{t}-(n+g+\delta) \hat{k}_{t} } (1.25)
Gleichung (1.25) besagt, dass die Veränderung im Kapitalstock je effektiver Arbeitseinheit die Differenz aus zwei Termen ist: Der linke Term, Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle s_K \hat{y_t}} , entspricht den Bruttoinvestitionen je effektiver Arbeitseinheit; der rechte Term Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle (n+g+\delta ) \hat{k_t}} , entspricht den Investitionen, die nötig sind, um Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \hat{y_t}} konstant zu halten. Dies ist folglich dann der Fall, wenn Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle s_K \hat{y_t}=(n+g+\delta ) \hat{k_t}} gilt. Wenn Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle s_K \hat{y_t}\neq (n+g+\delta ) \hat{k_t}} gilt, so steigt der Kapitalstock je effektiver Arbeitseinheit, Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \hat{k_t}} , wenn Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle s_K \hat{y_t}>(n+g+\delta ) \hat{k_t}} , und umgekehrt. Dieser Prozess verläuft analog zum in Abb. 1.3 dargestellten Mechanismus, als die Ökonomie immer zum Schnittpunkt der beiden Kurven tendiert: Wenn Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle s_K \hat{y_t}=(n+g+\delta ) \hat{k_t}} und somit Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \hat{k}_{t}=0} gilt, befindet sich die Ökonomie im Steady-State.
Bei näherer Betrachtung der Produktionsfunktion je effektiver Arbeitseinheit, Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \hat{y}_{t}=\hat{k}_{t}^{\alpha}} , wird deutlich, dass der Output je effektiver Arbeitseinheit im Steady-State nicht wächst, sondern konstant bleibt. Was bedeutet das? Im Steady-State ist nicht die Produktion an sich, sondern die Produktion je effektiver Arbeitseinheit konstant. Aus Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \hat{y}_{t}=\hat{k}_{t}^{\alpha}} folgt als Bedingung für den Steady-State Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle s_{K} \hat{k}_{t}^{* \alpha}=(n+g+\delta) \hat{k}_{t}^{*} } (1.26)
wobei Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \hat{k^*}} den Kapitalstock je effektiver Arbeitseinheit im Steady-State bezeichnet. Gleichung (1.26) lässt sich für Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \hat{k^*}} ausdrücken und man erhält Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \hat{k}^{*}=\left(\frac{s_{K}}{n+g+\delta}\right)^{\frac{1}{1-\alpha}} } (1.27)
Aus der Produktionsfunktion in Gleichung (1.22) folgt daher Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \hat{y}^{*}=\left(\frac{s_{K}}{n+g+\delta}\right)^{\frac{\alpha}{1-\alpha}} } (1.28)
wobei Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \hat{y^*}} den Output je effektiver Arbeitseinheit im Steady-State bezeichnet. Da der technologische Fortschritt Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle A} und die Bevölkerung (das Arbeitsangebot) Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle L} mit den konstanten Raten Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle g} bzw. Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle n} wachsen, kann der Output im Steady-State zu jedem beliebigen Zeitpunkt dargestellt werden als Steady-State-Output je Beschäftigten Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle y^*} zum Zeitpunkt Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle t} Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle y_{t}^{*}=A_{t} \hat{y}^{*}=A_{0} e^{g t}\left(\frac{s_{K}}{n+g+\delta}\right)^{\frac{\alpha}{1-\alpha}} } (1.29)
und der gesamte Steady-State-Output Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle Y^*} zum Zeitpunkt Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle t} als Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle Y_{t}^{*}=A_{t} L_{t} \hat{y}^{*}=A_{0} L_{0} e^{(g+n) t}\left(\frac{s_{K}}{n+g+\delta}\right)^{\frac{\alpha}{1-\alpha}} } (1.30)
Die Gleichungen (1.28), (1.29) und (1.30) verdeutlichen die Hauptaussagen des Solow-Modells:
- Eine Erhöhung der Sparquote wirkt sich positiv auf das Outputniveau aus, hat aber langfristig keine Auswirkung auf das Wirtschaftswachstum.
- Eine höhere Bevölkerungswachstumsrate wirkt sich positiv auf den gesamten Output, aber negativ auf den Output je Beschäftigten aus.
- Die Rate des technologischen Fortschritts wirkt sich positiv auf den gesamten Output sowie den Output je Beschäftigten aus.
Das langfristige Wachstum je Beschäftigten ist letztlich identisch mit der Rate des technologischen Fortschritts – dies ist in Gleichung (1.29) zu erkennen. Tatsächlich erscheint es auch intuitiv einleuchtend, dass die Zunahme des allgemeinen Wissens dafür gesorgt hat, dass der Lebensstandard in unseren Breiten um ein Vielfaches höher ist als noch vor 100 Jahren. Vieles von dem, womit wir uns heute beruflich beschäftigen, war vor einigen Generationen noch unbekannt, oder zumindest in dieser Form noch nicht bekannt. Darüber hinaus bietet das Wissen als Determinante von Produktion und Wachstum auch eine Erklärung für die weltweiten Unterschiede im Lebensstandard: Wenn technologischer Fortschritt für die Erhöhung der Produktivität im Zeitverlauf innerhalb einer Ökonomie verantwortlich ist, so folgt daraus, dass Unterschiede hinsichtlich des Zugangs zu Technologie zwischen Ökonomien zwangsläufig zu unterschiedlich hoher Produktivität führen. Anders formuliert sind weltweite Disparitäten beim BIP zumindest auch eine Folge unterschiedlicher Bestände an Wissen und seiner Anwendung. Durch die Implementierung des Wissens als Produktionsfaktor bietet das Solow-Modell eine plausible Erklärung für weltweite Disparitäten der wirtschaftlichen Entwicklung.
Darüber hinaus ist das Solow-Modell in der Lage, einen langfristigen Wachstumspfad mit dem Phänomen temporärer Schwankungen zu verbinden. Wie in Abb. 1.1 am Beispiel Österreich veranschaulicht, kann das Wachstum in einzelnen Perioden zwar zum Teil recht erheblichen konjunkturellen Einfluss unterliegen, welche von der jeweiligen Wirtschaftspolitik oder äußeren Faktoren abhängig sind. Langfristig befindet sich die Wirtschaft jedoch offensichtlich auf einem bestimmten Wachstumspfad. Selbst wenn die Wirtschaft schwer erschüttert wird und ein großer Teil des Kapitalstocks etwa durch einen Krieg vernichtet wird, kehrt sie zum Gleichgewichtswachstum zurück. Wie in Abb. 1.3 zu sehen, gilt bei konstanter Sparquote während der Übergangsphase Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle s_K y_t>(n+\delta )k_t} , und die Ökonomie weist in dieser Zeit ein relativ hohes Wachstum auf. Auf diese Weise ist das Solow-Modell auch in der Lage, das hohe Wirtschaftswachstum in Österreich nach dem Zweiten Weltkrieg zu erklären („Wirtschaftswunderjahre“).
Das Solow-Modell wird recht häufig dafür kritisiert, dass es zwar die Bedeutung des technologischen Fortschritts veranschaulicht, aber keine Antwort auf die Frage gibt, wie dieser technologische Fortschritt entsteht. [15] Ein weiteres Problem ergibt sich beim Versuch einer Quantifizierung des ursprünglichen Solow-Modells. Ein Unterschied um das Zehnfache beim BIP je Arbeitseinheit ist nicht ungewöhnlich bei Vergleichen sowohl im Raum wie über die Zeit. Ein zehnfacher Unterschied in Bezug auf Arbeitsproduktivität bedingt im Solow-Modell jedoch einen Unterschied von Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 10^{1 / \alpha} )} bei der Kapitalausstattung – bei der üblichen Annahme von Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \alpha \approx 1/3} ergibt sich daraus eine Kapitalausstattung je Arbeitseinheit um das Tausendfache. Das Verhältnis Kapital-Output mag sowohl über die Zeit wie in verschiedenen Ökonomien ganz erheblich variieren, derart gigantische Unterschiede sind jedoch empirisch nicht haltbar.
Ein zweites Problem der Quantifizierung ergibt sich bei Vergleichen um die Welt. Aus Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \alpha \approx 1/3} ergibt sich weiter, dass eine Differenz beim Output je Arbeiter um das Zehnfache eine Differenz bei der Grenzproduktivität des Kapitals um das Hundertfache bedingt. Im Kontext ganzer Volkswirtschaften folgt, dass da, wo bereits viel Kapital vorhanden ist, der Grenzertrag einer weiteren Einheit die Gesamtproduktion relativ wenig erhöhen wird – und umgekehrt da, wo noch wenig Kapital vorhanden ist, eine weitere Einheit sehr viel Ertrag bringt. Folglich wäre eine rege Investitionstätigkeit in Entwicklungs- und Schwellenländern zu erwarten, während Industrieländer eher unattraktiv für Investoren wären: Aus Gleichung (1.7)
und der Cobb-Douglas-Produktionsfunktion aus Gleichung (1.15) ergibt sich als erwarteter Gewinn einer zusätzlichen Einheit Kapital zum Zeitpunkt Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle t} : Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \frac{\partial Y_{t}}{\partial K_{t}}=\alpha K_{t}^{\alpha-1} L_{t}^{1-\alpha}=\alpha\left(\frac{L_{t}}{K_{t}}\right)^{1-\alpha}>0 } (1.31)
Da Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \alpha <1} gilt, ist die der erwartete Gewinn (rate of return) eindeutig positiv. Ein nochmaliges Ableiten der Produktionsfunktion zeigt, dass dieser zusätzliche Produktionsgewinn je Einheit Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle K_t} umso kleiner wird, je größer Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle K_t} ist: Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \frac{\partial^{2} Y_{t}}{\partial K_{t}^{2}}=\alpha(\alpha-1) K_{t}^{\alpha-2} L_{t}^{1-\alpha}<0 } (1.32)
Aus Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \alpha <1} folgt Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \alpha -1<0} , somit ist die Beziehung eindeutig negativ. Anders gesagt: Unter sonst identischen Bedingungen ist es reizvoller dort zu investieren, wo es noch verhältnismäßig wenig Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle K_t} gibt. Es ist eines der Hauptmerkmale der neoklassischen Theorie, dass die Grenzproduktivität Kapitalströme lenken wird, und zwar dorthin, wo es am produktivsten tätig sein wird. Daraus folgt, dass neue Fabriken, Bürogebäude und andere Investitionsgüter tendenziell eher dort entstehen sollten, wo es noch verhältnismäßig wenig davon gibt. Kapital ist stets auf der Suche nach höheren Renditen und wird daher – wenn man es lässt – dorthin wandern, wo es diese erwartet. Folglich würde man eine Wanderung vom Zentrum in die Peripherie erwarten, d.h. von den wohlhabenden, reichlich mit Kapital ausgestatteten Industriestaaten in die Schwellen- und Entwicklungsländer; ein solcher Prozess lässt sich in der Realität bis zu einem gewissen Grad tatsächlich beobachten. Die meisten Investitionen finden jedoch in den Zentren statt, die meisten grenzüberschreitenden Kapitalströme haben ihr Ursprungs- wie Zielland innerhalb der Industriestaaten. Wie im Folgenden gezeigt wird, kann die Einführung einer zweiten Kapitalform – des Humankapitals – erklären, warum auch fortgeschrittene Ökonomien mit hohem Sachkapitalbestand attraktiv für weitere Sachkapitalinvestitionen sind.
Die Rolle des Humankapitals
Robert Lucas hat 1990 [16] mehrere mögliche Erklärungen diskutiert, warum Kapital nicht in jenem Ausmaß von Industrie- in Schwellenländer fließt, wie man es aus der neoklassischen Theorie erwarten würde. [17] Neben (damals weit verbreiteten) Einschränkungen und Verboten von Kapitalexporten und -importen sowie Unterschieden beim Zugang zu Technologie ist es insbesondere eine Neuinterpretation des Begriffs Kapital, die sich als Erklärung anbietet. Spätestens seit den 1970er-Jahren hat sich innerhalb der Industriestaaten die Ausbildung der Arbeitskräfte als bedeutender Wirtschaftsfaktor gezeigt – und seither in ihrer Bedeutung eher noch zugenommen. So gesehen bleibt die Ausstattung mit Kapital entscheidend für das Produktionsniveau, doch ist mit „Kapital“ nun nicht mehr ausschließlich Sachkapital in Form von Maschinen und Ausrüstung, sondern auch Humankapital in Form von Ausbildung, Erfahrung und Fertigkeiten des Faktors Arbeit gemeint.
N. Gregory Mankiw, David Romer und David N. Weil [18] haben kurz nach Lucas’ Beitrag Solows Modell erweitert, indem sie das Humankapital als zusätzlichen Faktor in die Produktionsfunktion aufnehmen: Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle Y_{t}=K_{t}^{\alpha} H_{t}^{\beta}\left(A_{t} L_{t}\right)^{1-\alpha-\beta}, \quad \alpha>0, \quad \beta>0, \quad \alpha+\beta<1 } (1.33)
wobei Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle H_t} den Bestand an Humankapital zum Zeitpunkt Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle t} darstellt. Humankapital ist dabei definiert als die Gesamtheit der Fähigkeiten, der Erfahrung und des Wissens aller Arbeiter in einer Ökonomie. Alle anderen Variablen sind wie bisher definiert: Der aggregierte Output einer Ökonomie zum Zeitpunkt Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle t} ist folglich eine Funktion der Variablen Sachkapital Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle K_t} , Humankapital Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle H_t} und effektiver Arbeit Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle A_t \partial } . Die in Gleichung 1.16 ausgedrückten Bedingungen für Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \alpha } und Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \beta } stellen sicher, dass die Annahme konstanter Skalenerträge nach wie vor erfüllt ist.
Die Dynamik des Modells folgt für Arbeit und Technologie den in den Gleichungen (1.10) und (1.18) dargestellten Prozessen. Für Sachkapital gilt in Analogie zu Gleichung (1.23) Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \dot{K}_{t}=s_{K} f\left(K_{t}, H_{t}, A_{t} L_{t}\right)-\delta K_{t}=s_{K} Y_{t}-\delta K_{t} } (1.34)
Durch die Aufnahme einer zweiten Form von Kapital wird nun eine zweite Kapitalakkumulationsgleichung benötigt: Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \dot{H}_{t}=s_{H} f\left(K_{t}, H_{t}, A_{t} L_{t}\right)-\delta H_{t}=s_{H} Y_{t}-\delta H_{t} } (1.35)
wobei Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle s_H} jenen Anteil der Produktion darstellt, der für Neuinvestitionen in Humankapital aufgewendet wird; mit anderen Worten entspricht Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle s_H Y_t} den Aufwendungen für das Ausbildungssystem zum Zeitpunkt Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle t} . Der Einfachheit zuliebe wird außerdem unterstellt, dass Humankapital mit Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \delta } dieselbe Abschreibungsrate aufweist wie das Sachkapital. Trotz dieser Gemeinsamkeiten bei der Modellierung ist Humankapital nicht einfach als zweite Form von Kapital zu verstehen, vielmehr nimmt es eine Doppelrolle ein: Einerseits folgt auf Investitionen in der Gegenwart ein höherer Output in der Zukunft, und wie beim Sachkapital muss zur Aufrechterhaltung des gegenwärtigen Niveaus permanent ein gewisser Anteil reinvestiert werden. Andererseits ist das Humankapital in den Arbeitern verkörpert: Der durchschnittliche Arbeiter stellt nun für die Produktion sowohl eine Einheit Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle L} plus eine gewisse Menge Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle H} bereit. Somit wird zwar einerseits der Anteil des Einkommens, das an beide Arten Kapital geht, vergrößert. Andererseits ist das Humankapital Teil der Arbeit und wird folglich als Lohn ausbezahlt.
Das gesamte Lohnaufkommen Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle W} zum Zeitpunkt Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle t} beträgt somit Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle W_{t}=L_{t} w_{t}=L_{t} \frac{\partial Y_{t}}{\partial L_{t}}+H_{t} \frac{\partial Y_{t}}{\partial H_{t}} } (1.36)
während der Gewinnsatz zum Zeitpunkt Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle t} unverändert bleibt und der Beziehung in Gleichung (1.7) mit Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle r_t=\partial Y_t/\partial K_t} folgt. Analog zu Gleichung (1.22) können wiederum beide Seiten der Produktionsfunktion in Gleichung (1.35) durch effektive Arbeit dividiert werden, und man erhält so die Produktion je effektiver Arbeitseinheit: Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \hat{y}_{t}=\frac{Y_{t}}{A_{t} L_{t}} \Rightarrow \hat{y}_{t}=\hat{k}_{t}^{\alpha} \hat{h}_{t}^{\beta} } (1.37)
wobei Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \hat{k}=K/AL} den Bestand an Sachkapital je effektiver Arbeitseinheit, und Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \hat{h}=H/AL} den Bestand an Humankapital je effektiver Arbeitseinheit bezeichnet.
Die Entwicklung der Ökonomie lässt sich darstellen über die beiden Schlüsselgleichungen des Mankiw-Romer-Weil-Modells Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \dot{\hat{k}}_{t}=s_{K} \hat{y}_{t}-(n+g+\delta) \hat{k}_{t} } (1.38)
und Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \dot{\hat{h}}_{t}=s_{H} \hat{y}_{t}-(n+g+\delta) \hat{h}_{t} } (1.39)
die das Wachstum an Sachkapital je effektiver Arbeitseinheit, und das Wachstum an Humankapital je effektiver Arbeitseinheit darstellen. Setzt man jeweils die rechte Seite der beiden Gleichungen (1.38) und (1.39) gleich null und löst das entsprechende System aus zwei Gleichungen für Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \hat{k}} und Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \hat{h}} , so erhält man den Steady-State-Wert des Sachkapitals je effektiver Arbeitseinheit, Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \hat{k}^{*}=\left(\frac{s_{K}^{1-\beta} s_{H}^{\beta}}{n+g+\delta}\right)^{\frac{1}{1-\alpha-\beta}} } (1.40)
des Humankapitals je effektiver Arbeitseinheit, Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \hat{h}^{*}=\left(\frac{s_{K}^{\alpha} s_{H}^{1-\alpha}}{n+g+\delta}\right)^{\frac{1}{1-\alpha-\beta}} } (1.41)
sowie, folgend aus Gleichung (1.37), Output im Steady-State je effektiver Arbeitseinheit: Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \hat{y}^{*}=\hat{k}^{* a} \hat{h}^{* b}=\left(\frac{s_{K} s_{H}}{(n+g+\delta)^{\alpha+\beta}}\right)^{\frac{1}{1-\alpha-\beta}} } (1.42)
144.png|547x236px]]
Abb. 1.5: Die dynamische Stabilität des Mankiw-Romer-Weil-Modells – unabhängig
von der Ausgangslage strebt die Ökonomie stets zum Zustand Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \dot{\hat{k}}=0}
und Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \dot{\hat{h}}=0}
Die Ökonomie befindet sich im Steady-State-Wachstum, wenn Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \dot{\hat{k}}=0} und Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \dot{\hat{h}}=0} : Sind beide Bedingungen erfüllt, beträgt wie im Solow-Modell das Wachstum je effektiver Einheit Null, und das Wachstum je Beschäftigten entspricht Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle g} . Dementsprechend werden positive oder negative Veränderung der Höhe von Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle s_K} oder Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle s_H} sich zwar entsprechend auf das langfristige Output-Niveau auswirken, nicht aber auf die langfristige Wachstumsrate. Die Auswirkungen auf das langfristige Outputniveau durch Veränderung von einer oder beiden Sparquoten (Sachkapital und/oder Humankapital) lassen sich aus Gleichung (1.42) ablesen.
Durch die Berücksichtigung eines zusätzlichen Faktors wird das Mankiw-Romer-Weil-Modell im Vergleich zum Solow-Modell zwar komplexer, bleibt aber stabil: Was immer auch der Ausgangspunkt der Ökonomie hinsichtlich der Werte für Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \hat{k}} und Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \hat{h}} sein mag, das System konvergiert zu Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \hat{k}=0} und Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \hat{ h}=0} [19] Dieser Zusammenhang wird im Phasendiagramm in Abb. 1.5 skizziert: Von einem beliebigen Ausgangspunkt strebt das System stets zum Schnittpunkt der beiden Kurven.
Die qualitativen Schlussfolgerungen des Mankiw-Romer-Weil-Modells sind ähnlich zu jenen des Solow-Modells, die Einbeziehung des Humankapital führt jedoch zu erheblichen quantitativen Unterschieden. Dazu zählt insbesondere die Grenzproduktivität des Kapitals, die im Cobb-Douglas-Fall folgende Form annimmt: Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \frac{\partial Y_{t}}{\partial K_{t}}=\alpha K_{t}^{\alpha-1} H_{t}^{\beta}\left(A_{t} L_{t}\right)^{1-\alpha-\beta} } (1.43)
Wie oben skizziert ist die Grenzproduktivität des Kapitals ausschlaggebend für den erwarteten Ertrag von Neuinvestitionen. Aus dem Zusammenhang, der sich in Gleichung (1.43) darstellt, ergibt sich ceteris paribus eine umso höhere Attraktivität für Investitionen, je mehr Humankapital in der betreffenden Ökonomie vorhanden ist. Wie sich überprüfen lässt, ist die Grenzproduktivität des Sachkapitals umso höher, je höher der Wert von Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle H_t} ist. Auf diese Weise ist das Mankiw-Romer-Weil-Modell in der Lage, das Erklärungsvermögen des ursprünglichen Solow-Modells um Disparitäten in der Entwicklung sowie Investitionsströme in Ökonomien mit hohen Sachkapitalbeständen entscheidend zu verbessern.
Disparitäten der Entwicklung
Bis ins 18. Jahrhundert hinein waren die weltweiten Unterschiede im Lebensstandard relativ gering. Erst die Industrielle Revolution hat einerseits das stetige Wirtschaftswachstum ermöglicht, sorgte andererseits aber auch für unterschiedliche Wachstumsraten – die drastischen Unterschiede, die heute bestehen, sind hauptsächlich das Ergebnis unterschiedlichen Wirtschaftswachstums der letzten 100 bis 200 Jahre. Die Konsequenzen, die sich daraus ergeben, rechtfertigen für sich allein die Prüfung der Konvergenzhypothese, wonach Ökonomien mit einem heute geringeren Outputniveau in der Zukunft schneller wachsen. Anders formuliert: Werden jene, die heute zurückliegen, ihren Rückstand aufholen?
Die Konvergenz-Hypothese
Aus dem Solow-Modell (und seiner Erweiterung um Humankapital) lassen sich mindestens drei Kräfte ableiten, die Konvergenz zwischen Ökonomien erwarten lassen:
- Das Modell sagt eine Konvergenz zum eigenen Steady-State-Wachstum voraus. Daraus folgt, dass zwei Ökonomien mit vergleichbarem Steady-State, aber momentan unterschiedlichen aktuellen Niveaus, zueinander konvergieren werden.
- Die Grenzproduktivität des Kapitals ist dort höher, wo noch wenig vorhanden ist – bei freien Kapitalflüssen und unter sonst identischen Bedingungen wird dort investiert werden, wo noch wenig vorhanden ist, wodurch ein Aufholprozess hinsichtlich der Produktivität in Gang gesetzt wird.
- Output ist auch eine Funktion der Technologie. Daraus folgt, dass technologische Aufholprozesse zu einer Steigerung der Produktion führen.
Modellendogene Konvergenz
Der erste Punkt ergibt sich aus dem Modell selbst, wonach eine Ökonomie stets zu ihrem eigenen Steady-State konvergieren wird. [20] Die Stabilität des Modells gewährleistet eine Konvergenz der Produktionsfaktoren zu einem bestimmten Niveau – was auch immer die Ausgangslage sein mag. Dieser Zusammenhang wurde von Robert J. Barro und Xavier X. Sala-i-Martin [21] formal aus dem Solow-Modell abgeleitet und mündet in die Gleichung Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \frac{1}{T} \ln \left(\frac{y_{T}}{y_{0}}\right)=g+\frac{1-e^{-\tilde{\beta} T}}{T} \ln \left(\frac{y_{0}^{*}}{y_{0}}\right) } (1.44)
wobei Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle ln} den natürlichen Logarithmus bezeichnet und Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \tilde{\beta}=(1-\alpha )(n+g+\delta )} die Konvergenzgeschwindigkeit misst. [22] Die linke Seite in Gleichung (1.44) entspricht einer Approximation des Wachstums zwischen den Zeitpunkten Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle =} und Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle T} . Nach einigen Umformungen erhält man die ökonometrische Spezifikation Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \frac{\ln y_{T}-\ln y_{0}}{T}=\beta_{0}+\beta_{1} \ln y_{0} } (1.45)
wobei Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \beta_{0}=g+\left[\left(1-e^{-\tilde{\beta} T}\right) / T\right] \ln y_{0}^{*}} der Konstanten und Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \beta_{1}=\left(e^{-\tilde{\beta} T}-1\right) / T} der Steigung der Regressionsgeraden entspricht, woraus sich schließlich als empirisch messbare Konvergenzgeschwindigkeit Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \tilde{\beta}=-\ln(1+Tb)/T} ergibt. In ökonometrischen Tests wird üblicherweise Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \beta _1} geschätzt: Ist Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \beta _1} negativ, so liegt Konvergenz vor – ein höheres Ausgangsniveau des BIP je Einwohner, Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle y_0} , führt der Hypothese zufolge zu einem langsameren Wachstum, daher besteht ein negativer Zusammenhang. Da Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \beta _1} der entscheidende Parameter ist, spricht man auch von Beta-Konvergenz.
Eine einfachere Methode, die Konvergenz-Hypothese zu prüfen, besteht darin, die Varianz des BIP je Einwohner für mehrere Zeitpunkte Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle t} zu messen: Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \sigma_{t}^{2}=\frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n}\left(\ln y_{i, t}-\frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} \ln y_{i, t}\right)^{2} } (1.46)
Um für allgemeine Wachstumsprozesse und Inflation zu kontrollieren, werden auch hier die Werte logarithmiert. Nimmt die Varianz im Zeitverlauf ab, so liegt Konvergenz vor. Da die Varianz üblicherweise durch Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \sigma } symbolisiert wird, wird diese Art der Konvergenz auch Sigma-Konvergenz genannt.
Typen von Konvergenz
Ein Problem, das sich bei Prüfung der Konvergenz-Hypothesen auftritt, ist, dass ein Steady-State ein theoretisches Konstrukt darstellt, dessen wahre Höhe unbekannt ist – weshalb Annahmen darüber getroffen werden müssen, inwieweit sich die zu prüfenden Ökonomien hinsichtlich ihrer Steady-States voneinander unterscheiden. In empirischen Tests werden üblicherweise die Ausgangsdaten und die Wachstumsraten ausgewählter Ökonomien verglichen, gegebenenfalls ergänzt um weitere Variablen – d.h. es wird getestet, ob die Ökonomien zueinander konvergieren. Da das Solow-Modell als solches jedoch ein Modell für eine geschlossene Ökonomie ist, werden zwei Konzepte der Konvergenz unterschiedlicher Ökonomien unterschieden:
- Absolute Konvergenz bezeichnet den Prozess, wonach Ökonomien mit einem niedrigeren Output-Niveau auf jeden Fall schneller wachsen und folglich aufholen – es wird also unterstellt, dass alle Ökonomien zu einem identischen Steady-State-Niveau streben.
- Bedingte Konvergenz berücksichtigt Heterogenität zwischen Ökonomien und unterstellt, dass Ökonomien umso schneller wachsen, je weiter sie von ihrem eigenen Steady-State entfernt sind. Da das wahre Steady-State unbekannt ist, müssen Annahmen darüber getroffen werden, wodurch in der Realität die Höhe der Steady-States bestimmt wird.
Vergleichbare Steady-States
Als Beispiel für bedingte Konvergenz aufgrund vergleichbarer Steady-States kann der Aufholprozess Österreichs gegenüber der Schweiz nach dem Zweiten Weltkrieg genannt werden: Die beiden Länder sind sich hinsichtlich ihrer wichtigsten Parameter ähnlich, allerdings war das Sachkapital in Österreich vom Krieg weitgehend zerstört. Das führte zu einer erhöhten Grenzproduktivität von Sachkapitalinvestitionen in Österreich, was das Wachstum temporär beschleunigt hat: Ausgehend von einem niedrigeren Niveau hat Österreich über Jahrzehnte zur Schweiz aufgeholt, bis sich der Abstand auf relativ niedrigem Niveau eingependelt hat.
Kapitalflüsse
Das Modell von Mankiw, Romer und Weil bietet eine bessere Erklärung für die empirisch beobachtbaren Kapitalströme, ändert aber nichts an einer der Grundaussagen des Modells: Wo die Grenzproduktivität des Sachkapitals höher ist, ist der erwartete Ertrag einer Neuinvestition höher, also wird Kapital dorthin fließen. Die Attraktivität des Ziellands hängt nicht nur davon ab, wie viel Sachkapital dort bereits vorhanden ist, sondern insbesondere, wie produktiv es eingesetzt wird. Die Hypothese, wonach unter sonst gleichen Bedingungen Kapital in kapitalärmere Regionen fließen wird, bleibt unter der Annahme konstanter Skalenerträge aufrecht. Der Fall steigender Skalenerträge wird im folgenden Kapitel 1.3.2 diskutiert.
Technologische Aufholprozesse
Technologische Aufholprozesse als dritter Grund für Konvergenz können auf mannigfaltige Weise auftreten. Die Ausbreitung des Wissens ist bereits für die ältesten Hochkulturen kennzeichnend, ihre zum Teil jahrtausendealten Pfade wirken bis heute nach. Im Sinne ökonomischer Entwicklung kann Wissen dabei sehr umfassend begriffen werden und beschreibt sehr abstrakte Konzepte ebenso wie alltägliche Anwendungen.
Doch obwohl so unterschiedliche Dinge wie Integralrechnungen und Kochrezepte als verfügbares Wissen gelten, und obwohl ihre jeweilige Weiterentwicklung von sehr unterschiedlichen Faktoren abhängt, haben sie eine entscheidende Eigenschaft gemein: die Nichtrivalität. Das bedeutet, dass die Anwendung beliebigen verfügbaren Wissens – unabhängig davon, ob es sich um Integralrechnungen oder um Kochrezepte handelt – den Bestand ebendieses Wissens nicht verbraucht, sondern vielmehr beliebig oft angewendet werden kann. Diese Eigenschaft unterscheidet das Wissen von konventionellen privaten ökonomischen Gütern: Das Wissen nimmt die Charakteristik eines öffentlichen Guts an.
Ein Schluss, der aus diesen Überlegungen unmittelbar folgt ist, dass Produktion und Verteilung des Wissens nicht ausschließlich der Regulierung über Marktmechanismen überlassen werden können: Die Grenzkosten der Bereitstellung des Wissens, das bereits existiert, betragen null. Allerdings kann Wissen bis zu einem gewissen Grad auch geheim gehalten werden, wodurch es sich wiederum von öffentlichen Gütern unterscheidet: Es besteht also prinzipiell die Möglichkeit der Ausschließbarkeit. Der Grad der jeweiligen Ausschließbarkeit hängt von der Art des betreffenden Wissens ab.
Aus diesen Eigenschaften sowie der enormen Bedeutung, die das Wissen für die ökonomische Entwicklung hat, ergeben sich wichtige Schlussfolgerungen und neue Fragen hinsichtlich der Regulierung einzelner Ökonomien, von der Finanzierung der Universitäten bis zur idealen Dauer der exklusiven Anwendung patentierter Verfahren. Für die interregionale und internationale Entwicklung ist darüber hinaus von Bedeutung, wie leicht oder wie schwierig Wissen verfügbar ist.
Regionale Polarisation
Im Unterschied zur Konvergenz-Hypothese beobachten wir auf der ganzen Welt Zentrum-Peripherie-Gefälle, in denen das jeweilige Zentrum prosperiert, während das Hinterland zurückzufallen scheint. Im Folgenden werden die Grundlagen erläutert, wie ein solches Zentrum-Peripherie-Gefälle entsteht und sich möglicherweise vertieft. Diese Diskussion ist insbesondere für divergente Entwicklungen innerhalb einer Volkswirtschaft relevant: Die regionale Entwicklung kann vielfältige Muster zeigen und verläuft nur selten gleichmäßig. Ein besonders markanter Ausdruck ungleicher Entwicklung ist die historische Herausbildung von Städten.
Zwar ist es einerseits nahezu unmöglich, Verallgemeinerungen darüber aufzustellen, warum bestimmte ökonomische Entwicklungen an bestimmten Orten einsetzen und nicht an anderen. Es lässt sich allerdings beobachten, dass regionale Zentren wirtschaftlicher Entwicklung kumulativ als Folge eines gewissen Startvorteils entstehen. In weiterer Folge führen daraus entstandene Agglomerationsvorteile dazu, dass sich weitere Betriebe ansiedeln, die ihrerseits Arbeitskräfte anlocken, welche wiederum die Attraktivität des Standorts weiter erhöhen:
- Lokalisationsvorteile sind Kostenvorteile, die sich aus der räumlichen Ballung von Betrieben derselben Branche ergeben. Bestimmte Betriebe profitieren von der Ansiedlung an einem bestimmten Ort, indem sie auf einen gemeinsamen Pool qualifizierter Arbeitskräfte zurückgreifen, bzw. bereits vorhandene Verflechtungen zwischen Betrieben ausnützen.
- Verstädterungsvorteile bezeichnen Kostenvorteile, die durch Betriebe aus verschiedenen Branchen in unmittelbarer Nachbarschaft entstehen. Sie spiegeln externe Ersparnisse wider, die mit der räumlichen Ballung von Unternehmen und Sektoren zusammenhängen und deshalb in metropolitanen Regionen am stärksten ausgeprägt sind.
Die sich daraus ergebenden Vorteile und wirtschaftlichen Bindungen stellen den Anfangs- oder Startvorteil dar, der wirtschaftliche Entwicklung in Gang setzt. Im Sinne der Wachstumstheorie gilt die Annahme konstanter Skalenerträge hier nicht: Eine fortgesetzte Ansiedlung von Sach- und Humankapital führt aufgrund der Agglomerationsvorteile zu erhöhter Produktion, d.h. es bestehen steigende Skalenerträge. Allerdings können ab einer bestimmten Größe Agglomerationsvorteile zu -nachteilen werden, etwa durch überlastete Verkehrssysteme, Verwaltung oder Umweltbelastung. In diesem Fall liegen sinkende Skalenerträge vor.
In frühen Wachstumsphasen wirken häufig kumulative, sich selbst verstärkende Kräfte und beeinflussen über Größenersparnisse die wirtschaftliche Entwicklung im Raum: Wachstum in der Vergangenheit führt ab einer bestimmten Größe zu weiterem Wachstum. Ein solcher Prozess wird von Gunnar Myrdal [23] beschrieben, der bemerkt, dass eine gegenwärtige Anziehungskraft eines Zentrums ihren Ursprung hauptsächlich in einem historischen Zufall hat, der womöglich auch anderswo hätte stattfinden können.
Als Selbstverstärkung wird ein Prozess spiralförmiger Steigerung von Vorteilen in einem spezifischen geographischen Umfeld als Folge von Agglomerationseffekten und anderen externen Ersparnissen bezeichnet; umgekehrt kann jedoch auch eine Abwärtsspirale eintreten. In beiden Fällen werden dauerhafte oder zumindest längerfristig existente räumliche Disparitäten durch verschiedene soziale und ökonomische Prozesse im Zeitablauf sogar noch verstärkt. Durch die Wirkung auf die Ansiedlung der Faktoren und Kapital wird die Entwicklung entscheidend von anderen Ökonomien geprägt; deren Einfluss ist tendenziell umso stärker, je näher sie geographisch liegen. Dabei werden unterschieden:
- Zentripetale Entzugseffekte, welche die negativen Auswirkungen des Wachstums einer Region auf eine andere bezeichnen; bereits bestehende Disparitäten zwischen Zentrum und Peripherie werden verstärkt.
- Zentrifugale Ausbreitungseffekte, welche positive Auswirkungen des Wachstums einer Region auf eine andere bezeichnen; in weiterer Folge kann nun in der Peripherie ein kumulativer Wachstumsprozess entstehen.
Myrdal geht davon aus, dass in den meisten Fällen die Entzugseffekte stärker als die Ausbreitungseffekte wirken. Mechanismen dieser Art tragen dazu bei, dass sich ökonomische Zentren bilden und halten können – das Ergebnis ist ein räumlich ungleiches Muster der Entwicklung. Dieses Muster ist charakterisiert durch ein dominantes Zentrum (Kern) und eine subdominante Peripherie, wobei Zentrum und Peripherie gemeinsam ein interdependentes räumliches System bilden. Zentren verfügen dabei über eine hohe Kapazität zur Generierung und Absorption innovativen Wandels; die peripheren Regionen sind von den Zentren abhängig, ihr Entwicklungspfad wird hauptsächlich von den Institutionen der Zentren bestimmt. Das Zentrum dominiert zu jedem Zeitpunkt die Peripherie, was jedoch nicht unbedingt zum Nachteil der Peripherie sein muss:
- Das Zentrum fragt Güter aus der Peripherie nach, wodurch Geld in die Peripherie fließt.
- Arbeitskräfte wandern von der Peripherie ins Zentrum aufgrund neuer Beschäftigungsmöglichkeiten, eine mögliche Folge ist eine Verringerung der Arbeitslosigkeit in der Peripherie.
- Die Notwendigkeit von Inputs aus der Peripherie führt zu Investitionen, die durch Kapital aus dem Zentrum finanziert werden.
Die Folge solcher positiven Effekte kann sein, dass in der Peripherie nun selbst Auslösefaktoren für eine vorteilhafte Entwicklung überwiegen und eine solche in Gang setzen. Diese Schlussfolgerungen basieren im Wesentlichen auf dem neoklassischen Modell und seinen Grundannahmen, wonach die Produktionsfaktoren von Regionen geringer Erträge und Regionen hoher Erträge fließen und es in weiterer Folge zu einem Ausgleich bei der Faktorentlohnung kommt. Bei Nichterfüllung der Grundannahmen des Solow-Modells wie insbesondere jener konstanter Skalenerträge sind ausgleichende Kräfte jedoch nicht die zwangsläufige Folge. Anders formuliert führt Wachstum im Zentrum nicht zu einem parallelen Wachstum in der Peripherie, sondern kann zu einer Vertiefung der Disparitäten führen. Letzteres tritt auch dann auf, wenn die Peripherie zwar wächst, aber eben langsamer als das Zentrum.
Die Umkehrung der oben aufgezählten Ausbreitungseffekte beschreibt die Wirkung der Entzugseffekte:
- Der Erwerb von Gütern aus der Peripherie durch das Zentrum beschränkt sich möglicherweise auf primäre Güter, deren Nachfrageelastizität sehr gering ist; die Nachfrage bspw. nach Agrargütern oder Rohstoffen steigt nicht zwangsläufig, wenn das Zentrum hohe Wachstumsraten aufweist.
- Die Migration von Arbeitskräften aus der Peripherie ins Zentrum betrifft häufig eher die jungen und gut ausgebildeten Arbeitskräfte, die in weiterer Folge der Peripherie nicht mehr zur Verfügung stehen.
- Aufgrund von Agglomerationseffekten finden die meisten Investitionen nach wie vor in den Zentren statt, d.h. Kapitalströme gehen nicht zwangsläufig von Richtung Zentrum in Richtung Peripherie, sondern möglicherweise sogar umgekehrt.
Wenn es keine ausgleichenden Faktoren gibt, wie zum Beispiel ein Gegensteuern von Seiten der Politik, werden die Produktionsfaktoren Arbeit und Kapital beim Überwiegen zentripetaler Entzugseffekte von der Peripherie ins Zentrum wandern. Diese generieren wiederum Multiplikatoreffekte, die Disparitäten vertiefen sich weiter. Paul Krugman hat 1991 mit einem einflussreichen Modell gezeigt, [24] dass die Polarisationen sich umso mehr vertiefen, je günstiger Güter interregional gehandelt werden können. Der erste Grund hierfür ist, dass Produzenten bei sinkenden Handelskosten (dazu zählen Transportkosten, Zölle und regional differierende Präferenzen) den gesamten Markt von einem Standort aus bedienen können, während sie bei hohen Handelskosten die Standorte verteilen, um näher bei den Märkten zu sein. Der zweite Grund ist, dass bei sinkenden Handelskosten die Produzenten ihren bevorzugten Standort unter vielen möglichen wählen können. Aufgrund der oben beschriebenen Aggolmerationsvorteile werden das eher solche Standorte sein, die bereits über viel Sach- und Humankapital verfügen, wodurch sich die Disparitäten noch vertiefen.
Im Unterschied zum ursprünglichen Solow-Modell, das eine geschlossene Ökonomie beschreibt, berücksichtigen Polarisationsmodelle ihrem Wesen nach Interaktionen zwischen Ökonomien. Erweitert man das Solow-Modell um Kapitalflüsse und Migration, so zeigen sich auch im neoklassischen Wachstumsmodell Tendenzen zur Vertiefung bereits vorhandener Disparitäten, d.h. statt Konvergenz kommt es zu Divergenz: Neuinvestitionen finden eher dort statt, wo bereits viel Sach- und Humankapital vorhanden sind, ebenso wandern Humankapitalträger bevorzugt dorthin, wo das Lohnniveau höher ist.
Im Zuge der ökonomischen Integration sowohl der EU wie der Weltwirtschaft (Globalisierung) nehmen auch Volkswirtschaften immer mehr den Charakter von Regionalökonomien an, als sie ihre eigene Entwicklung immer mehr von der Entwicklung anderer Ökonomien abhängt, wodurch Polarisationsmodelle an Bedeutung gewinnen.
Empirie
Die Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung (VGR) dient zur Beantwortung insbesondere zweier Fragestellungen: Erstens soll die Beschreibung der Entwicklung der wirtschaftlichen Aktivitäten und der gesamten Produktion eines Landes erreicht werden, zweitens sollen quantitative Aussagen über die Entwicklung des Wohlstands der Bürger eines Landes oder einer Region erreicht werden.
Welche Größen der VGR relevant sind, ist prinzipiell abhängig von theoretischen Überlegungen bzw. jeweiligen spezifischen Fragestellungen. Es gibt jedoch kaum eine Maßzahl der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften, der in Politik und Öffentlichkeit so viel Bedeutung beigemessen wird wie dem Bruttoinlandsprodukt und seiner Entwicklung im Zeitverlauf. Das BIP dient als Indikator für internationale Vergleiche der Entwicklung und des Wohlstands wie für Erfolg oder Misserfolg einer Wirtschaftspolitik. Ob man den Blick nun auf die Welt, ein einzelnes Land oder eine Region wirft, es fällt schwer, die Bedeutung des Wirtschaftswachstums zu überschätzen: Die Schwierigkeiten, die man mit Regionen wie Süditalien oder Ostdeutschland assoziiert sind eng mit Fragen der wirtschaftlichen Entwicklung verknüpft. Das gilt ebenso für die Präferenzen über bestimmte Gesellschaftsordnungen bis hin zur Weltpolitik. Streitigkeiten wie etwa neoliberaler versus keynesianischer Wirtschaftspolitik innerhalb des kapitalistischen Systems lassen sich auf Fragen des wirtschaftlichen Erfolgs zurückführen und werden letztlich an diesem gemessen. Das BIP oder damit verwandte Größen der VGR hierbei als entscheidendes Kriterium heranzuziehen ist relativ unumstritten.
Je mehr das BIP jedoch als Maß für wirtschaftliche Leistungsfähigkeit angewendet wird, umso so mehr wird es auch kritisiert. Die wichtigsten Überlegungen sind dabei::
- Das Inlandsprinzip misst unter Umständen nicht das, was gemessen werden soll, d.h. produziertes und verfügbares Einkommen können erheblich voneinander abweichen.
- Im BIP ist enthalten, was neu produziert wird, nicht aber, was durch Abnutzung, Abbau, Zerstörung etc. verloren geht.
- Das BIP kann innerhalb einer Volkswirtschaft regional erheblich variieren.
- Die Höhe des BIP sagt nichts über die Einkommensverteilung innerhalb der Gesellschaft aus.
- Im BIP ist nur enthalten, was entgeltlich produziert wird, d.h. unbezahlte Arbeit (z.B. familiäre Erziehung, ehrenamtliche Tätigkeit) bleibt per definitionem unberücksichtigt. [25]
- Die Lebensqualität ist letztlich von vielen Faktoren abhängig, etwa dem Grad der Umweltverschmutzung, der sozialen Sicherheit etc.
Bezüglich der beiden ersten der Punkte finden sich in der VGR alternative, für bestimmte Fragestellungen besser geeignete Größen als das BIP, worauf im Folgenden näher eingegangen wird. Für Fragen der regionalen Entwicklung bietet sich das Bruttoregionalprodukt als analoges Maß an, Fragen der Verteilung innerhalb einer Ökonomie und ihrer Messung können teilweise ebenfalls mittels der VGR beantwortet werden, worauf im zweiten Hauptkapitel eingegangen wird. Der fünfte und sechste Punkt gehen über die Thematik dieses Skriptums hinaus: Festgehalten sei hier allerdings, dass komplexe, in diesen Fällen interdisziplinäre Fragen nur in den seltensten Fällen mittels eines einzigen Indikators beantwortet werden können, sondern vielmehr fast immer zusätzliche Methoden benötigen. Es sei jedoch hervorgehoben, dass das BIP kein Maß für den allgemeinen Wohlstand ist und auch nicht dafür konzipiert wurde. Es kann den Wohlstand bestenfalls schätzen (als Indikator), was das BIP misst, ist die Produktion. Seine Stärke liegt v.a. darin, dass es relativ einfach zu messen und daher als statistische Größe vergleichsweise zuverlässig ist: Grob vereinfacht fließt ins BIP ein, was in einer Periode für Geldeinheiten verkauft wird – nicht mehr und nicht weniger.
Messung von Größe und Wachstum
Bei der rein theoretischen Auseinandersetzung mit dem Wirtschaftswachstum genügte die Unterscheidung „gesamt“ versus „je Beschäftigten“ bzw. “je Einwohner“. In der Praxis gibt es jedoch verschiedene Größen, die je nach Fragestellung das geeignete Maß darstellen. Im Folgenden werden verschiedene Größen der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung dargestellt; darüber hinaus werden einige Werte angegeben, um ein Gefühl für die Größenordnungen zu vermitteln. Zur Messung des gesamtwirtschaftlichen Geschehens ist eine ganze Reihe von Größen verbreitet, welche sich wiederum im Verhältnis zu verschiedenen, je nach Fragestellung adäquaten Bezugsgrößen (Einwohner, Beschäftigte etc.) darstellen lassen.
Bruttowertschöpfung (BWS): Sie ist die Grundlage der VGR und entspricht der Summe aller Produktionswerte abzüglich der Vorleistungen. In einer Welt ohne Ausland und ohne indirekte Steuern spiegelt sie das Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle Y} in den
Wachstumsmodellen wider. Die BWS entspricht der Produktion zu Herstellungspreisen oder Faktorkosten.Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) ergibt sich durch Addition der indirekten Steuern abzüglich der Subventionen. Die Unterschiede zur BWS sind folglich die zusätzlichen Einnahmen und Ausgaben des Staates, der durch seine Politik in die Preissetzung am Markt eingreift. Das BIP entspricht daher der Produktion zu Marktpreisen.
Manchmal finden sich auch Ausdrücke wie „BIP zu Faktorkosten“, was daher der BWS entspricht.
minus Gütersubventionen:
Tab. 1.1: Schematischer Überblick über die wichtigsten Größen der VGR zur Erfassung der Gesamtwirtschaft und die entsprechenden Daten für Österreich 2015 (in Mrd. Euro, Differenzen in den Summen ergeben sich aus Rundungsfehlern); Quelle: Statistik Austria
Diese ab- und zufließenden Primäreinkommen setzen sich aus Einkommen aus Besitz und Unternehmung sowie aus Arbeitseinkommen zusammen. Erstere entstehen insbesondere durch Vermögensbestände von Inländern im Ausland wie Beteiligungen an Unternehmen, ausländische Staatsanleihen etc. Letztere entstehen aus Arbeitseinkommen von Inländern im Ausland wie jene von Auslandspendlern (und jeweils umgekehrt von Ausländern im Inland). Man beachte, dass gemäß dem Europäischen System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen (ESVG) das Inländer-Konzept nicht Inländer im staatsrechtlichen Sinn umfasst, sondern dass sämtliche Erwerbspersonen, die ihren wirtschaftlichen Schwerpunkt
| Bruttoinlandsprodukt: 339,90 | |
|---|---|
| - | Arbeitnehmerentgelte an die übrige Welt: 2,72 |
| - | Vermögenseinkommen an die übrige Welt: 28,50 |
| - | Produktions- und Importabgaben an die Institutionen der EU: 0,42 |
| + | Arbeitnehmerentgelte aus der übrigen Welt: 2,29 |
| + | Vermögenseinkommen aus der übrigen Welt: 27,24 |
| + | Subventionen aus der EU: 0,74 |
| = | Bruttonationaleinkommen: 338,52 |
- Tab. 1.2: Schematische Darstellung des Übergangs vom Bruttoinlandsprodukt zum Bruttonationaleinkommen mit den entsprechenden Daten für Österreich 2015 (in Mrd. Euro, Differenzen in den Summen ergeben sich aus Rundungsfehlern); Quelle: Statistik Austria
im Inland haben, in der VGR als Inländer erfasst werden – auch wenn sie im staatsrechtlichen Sinn Ausländer sind. [26] Nicht zuletzt deshalb machen den größten Anteil der zu- und abfließenden Primäreinkommen Vermögenseinkommen aus bzw. an die übrige Welt aus. Hinzu kommen gemäß ESVG schließlich noch Überweisungen aus bzw. an die EU. Eine detaillierte Darstellung des Übergangs vom BIP zum BNE mit Daten für Österreich findet sich in Tab. 1.2.
Insbesondere in Ländern, die einen hohen Zufluss an Auslandsdirektinvestitionen aufweisen, kommt es daher notwendigerweise mittelfristig zu einer erheblichen Diskrepanz zwischen Inlands- und Inländer-Produkt bzw -Einkommen. Während in Österreich das Verhältnis absolutes BNE/BIP bei 0,996 liegt, beträgt selbiges in der Republik Irland 0,792. [27] Auch bei Vernachlässigung einiger Feinheiten der Berechnung bleibt der Schluss zulässig, dass in Österreich 0,4% des entstehenden Einkommens, in Irland hingegen 20,8% des produzierten Einkommens netto an das Ausland fließen.
| Quelle | AT | HU | AT/HU |
|---|---|---|---|
| Der Spiegel Länderlexikon (BNE/EW in US-$) | 32.300 | 8.270 | 391% |
| OECD (BIP/EW zu KKP) | 31.944 | 15.946 | 200% |
| Weltbank (BNE/EW in US-$) | 32.280 | 8.370 | 386% |
| Der Fischer Weltalmanach online (BNE/EW in US-$) | 32.300 | 8.270 | 391% |
| Economist Intelligence Unit (BIP/EW zu KKP) | 31.930 | 15.184 | 210% |
| Cambridge Econometrics (BIP/EW in ECU, fixe Preise) | 26.209 | 4.720 | 555% |
| Eurostat (BIP/EW in Euro, jeweilige Preise) | 29.390 | 7.978 | 368% |
| Eurostat (BIP/EW in ECU, fixe Preise, Basisjahr 1995) | 27.413 | 4.770 | 575% |
| Eurostat (BIP/EW in ECU, Verkettung, Referenzjahr 1995) | 27.756 | 4.884 | 568% |
| Eurostat (BIP/EW zu KKP, EU-25 = 100) | 122,6 | 60,2 | 204% |
- Tab. 1.3:. Das BIP und BNE je Einwohner (EW) in Österreich und Ungarn sowie das Verhältnis im Jahr 2004 nach verschiedenen Quellen und Berechnungsmethoden
Bei der Interpretation der Daten kommt es daher darauf an, was gemessen wird. Das bei Wachstumsfragen relevante Problem nomineller versus realer Größen [28] ist dabei ebenso zu berücksichtigen wie die sinnvolle Wahl einer Bezugsgröße. Bei internationalen Vergleichen üblich ist, das BIP je Einwohner (Österreich im Jahr 2015: 39.390 Euro) anzugeben. Die Zahl der Erwerbstätigen kann sowohl im Zeitverlauf wie auch von Land zu Land schwanken, weshalb häufig die die Arbeitsproduktivität von Interesse ist: Sie ist definiert als Output je Arbeitseinheit und wird üblicherweise berechnet als BIP oder BWS je Erwerbstätigen oder je Arbeitsstunde (BWS je Erwerbstätigen in Österreich im Jahr 2015: 81.500 Euro). Nettolöhne und -gehälter (AT 2015: 92,17 Mrd. Euro) werden üblicherweise je Arbeitnehmer ausgewiesen (AT 2015: 28.800 Euro), zu beachten ist hier u.a., ob Erwerbstätige und Arbeitnehmer lediglich gezählt oder zu Vollzeitäquivalenten erfasst werden (hier: Vollzeitäquivalente), oder inwieweit sich die Gruppe der Erwerbstätigen mit jenen der Arbeitnehmer überschneidet (hier: 3.205.661 der 3.713.442 Erwerbstätigen waren 2015 Arbeitnehmer). Eine weitere Kennzahl stellt die Kapitalintensität dar, die das Verhältnis von BIP zum Bruttoanlagevermögen (Wert zu Wiederbeschaffungspreisen in Österreich 2015: 2,168 Billionen Euro)
darstellt und somit angibt, wie viel eine Kapitaleinheit im Durchschnitt zur Herstellung einer Einheit Bruttoinlandsprodukt beiträgt (Österreich 2015: 15,68 Cent).
Zur Illustration der beträchtlichen Unterschiede, die sich aus verschiedenen Berechnungsmethoden ergeben können, dient ein einfacher Vergleich verschiedener Angaben zum BIP bzw. BNE je Einwohner in Österreich und Ungarn für das Jahr 2004 in Tab. 1.3: Je nach Methode und Quelle wird die wirtschaftliche Leistung Österreichs als doppelt bis nahezu sechsmal so hoch eingestuft. Die Unterschiede ergeben sich v.a. daraus, ob unterschiedliche Preisniveaus berücksichtigt werden (Kaufkraftparitäten) und ob mit preisbereinigten („realen“) oder nominellen Werten gerechnet wird. Während das Rechnen zu Kaufkraftparitäten bei internationalen Vergleichen die Qualität des BIP als Indikator für Wohlstand verbessert, sind reale Werte eher bei Vergleichen einer Ökonomie mit sich selbst im Zeitverlauf geeignet (wie in Abb. 1.1). Wie in Tab. 1.3 ersichtlich, verringert das BIP zu Kaufkraftparitäten den Unterschied zwischen Österreich und Ungarn, da in Ungarn viele Güter billiger sind als in Österreich, während Preisbereinigungen innerhalb eines Landes die Unterschiede zwischen Ländern grob nach oben verzerren können.
Globale Konvergenz?
>Die in Kapitel 1.3.1 aus der neoklassischen Wachstumstheorie hergeleitete Konvergenz-Hypothese zählt zu den meistdiskutierten makroökonomischen Themen der vergangenen 25 Jahre. Zu den Hauptergebnissen zählt die von Sala-i-Martin geprägte Zwei-Prozent-Regel als Resultat zahlreicher Studien, wonach Ökonomien entsprechend einem Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \tilde{\beta}} aus Gleichung (1.44) mit einer Geschwindigkeit von 2% pro Jahr zueinander konvergieren [29] Die beiden prominentesten Beispiele zur Stützung der Konvergenz-Hypothese sind einerseits die Aufholprozesse der großen westeuropäischen Ökonomien Deutschland, Frankreich und Italien gegenüber Großbritannien in den letzten 200 Jahren, sowie der Aufholprozess innerhalb der OECD gegenüber den USA in den vergangenen 50 Jahren. Betrachtungen dieser Art haben jedoch die Schwachstelle, dass sie ex post erfolgen: Verglichen wird, was heute ähnlich ist, um dann festzustellen, dass ein Angleichungsprozess zu beobachten war. Demgegenüber steht die Feststellung von Gunnar Myrdal, der bereits 1957 bemerkte, dass es die Industriestaaten sind, die sich weiter industrialisieren und in denen alle Indikatoren nach oben zeigen. Tatsächlich stimmen die wohlhabenden Ökonomien von heute mit jenen von 1957 weitgehend überein. Temporäre Aufholprozesse wie zurzeit der VR China oder Indiens können nicht darüber hinwegtäuschen, dass mit Ausnahme der Republik Korea seit Myrdals Analyse kein einziges Land das BIP-je-Einwohner-Niveau der etablierten Industriestaaten erreichen konnte (abgesehen von Stadtstaaten wie Singapur und Rohstoff exportierenden Ländern wie Kuwait).
Wenn die gesamte Weltwirtschaft empirisch verglichen werden soll, stellt sich zunächst das Problem, dass es einige sehr, sehr große Länder und viele kleinere gibt. Ist es sinnvoll, eher kleinen Ländern wie Dänemark oder Guatemala bei einer Länder übergreifenden Studie denselben Stellenwert zuzuweisen wie etwa Russland oder Brasilien? Ein Lösungsansatz ist, statt einzelner Länder ökonomische Zonen und Blöcke zu betrachten: Abb. 1.6 zeigt das BIP als Anteil am Weltprodukt (= die Summe des absoluten BIP aller Länder = die Summe des absoluten BNE aller Länder) in den Jahren 1970 und 2015 für sieben Zonen bzw. Blöcke: Die USA, die EU innerhalb der Grenzen von 1995 bis 2004 („EU-15“), Japan, die UdSSR und ihre Nachfolgestaaten, die neun südamerikanischen Mitglied- und assoziierten Staaten des Mercosur, die Volksrepublik China (zu Grenzen von 2015) sowie Indien. Wie aus der Abbildung zu sehen ist, wurde 1970 rund 83%, und 2005 rund 76% des Weltprodukts in diesen sieben Zonen erwirtschaftet. Die Anteile der führenden Industriestaaten der USA, der EU-15 sowie Japans gingen im Beobachtungszeitraum zwar zurück, jedoch um weit weniger als der Anteil der betreffenden Länder an der Weltbevölkerung – was bedeutet, dass die Produktion je Einwohner in den führenden Industriestaaten im Vergleich zum Rest der Welt sogar noch zunahm.
Am auffälligsten ist der Rückgang des Anteils der UdSSR und ihrer Nachfolgerstaaten sowie der Ausbau Chinas. Zwar könnte man den Aufholprozess Chinas hier als Beleg für Konvergenz heranziehen – doch genauso gut könnte man den Rückgang des Anteils der UdSSR und ihrer Nachfolgerstaaten als Beleg für Divergenz sehen, zumal dieser Block 1970 technologisch den führenden Industriestaaten am nächsten war. Indien und die Mercosur-Staaten konnten ihre Anteile zwar leicht ausbauen, aber im selben Zeitraum wuchsen auch die jeweiligen Anteile an der Weltbevölkerung, was insbesondere das viel kommentierte Wachstum Indiens der letzten Jahre erheblich relativiert. Auf globaler Ebene lässt sich daher konstatieren, dass trotz temporär spektakulärer Wachstumsprozesse in einigen Ländern kein systematischer Aufholprozess ärmerer gegenüber wohlhabenderer Staaten zu beobachten ist.
174.png|244x227px]]175.png|245x204px]]
Innerhalb Europas ist die Persistenz der geographischen Disparitäten sogar noch stärker ausgeprägt als auf globaler Ebene: Jene Regionen, die sich bereits im 19. Jahrhundert industrialisierten, sind bis heute die produktivsten und wohlhabendsten Regionen Europas. Insbesondere die geographische Ausbreitung der Industrialisierung ist bis heute nachvollziehbar: Ausgehend von England über die Benelux-Staaten, Ostfrankreich und Deutschland bis nach Norditalien zieht sich ein geographischer Ausschnitt, in dem sich bis heute bevorzugt Hochtechnologie-Betriebe ansiedeln, in dem bis heute überproportional viele wissenschaftliche und kulturell bedeutende Einrichtungen zu finden sind und wo ein permanenter Zufluss von hochqualifizierten Arbeitskräften dafür sorgt, dass es auf absehbare Zeit auch so bleiben wird. Auch innerhalb Europas bedeuten gelegentliche temporäre Aufholprozesse wie jene Südeuropas in den 1980er- und 1990er-Jahren oder Mittelosteuropas seit den 1990er-Jahren noch lange kein Einholen oder gar Übberholen.
Regionales Wachstum innerhalb der Europäischen Union
Die bisherige Analyse hat gezeigt, dass es erstens Gesetzmäßigkeiten hinsichtlich der Entwicklung einer Ökonomie gibt, jedoch zweitens Ökonomien sich unterschiedlich entwickeln, wobei es keine automatische Angleichung gibt. Was für Europa gilt, gilt auch für die Europäische Union, die mittlerweile rund zwei Drittel der Bevölkerung Europas umfasst. Unterschiede hinsichtlich der Produktivität und des Wohlstands sind sowohl durch Nord-Süd-Gefälle wie durch Ost-West-Gefälle charakterisiert. Abb. 1.7 visualisiert diesen Sachverhalt durch eine Darstellung des Bruttoregionalprodukts (BRP) [30] für die EU: Es zeigt sich ein geographisches Muster, wobei die im Zentrum gelegenen Regionen jene mit dem höchsten BRP sind, während jene in Randlage benachteiligt scheinen. Die Regionen und Staaten innerhalb der Europäischen Union sind jedoch Teil desselben Wirtschaftsraums und unterliegen daher denselben Rahmenbedingungen, sie haben durch den Binnenmarkt prinzipiell Zugang zur selben Technologie und können bis zu einem gewissen Grad als ähnlich eingestuft werden. Deshalb folgt ein möglicher innereuropäischer Konvergenzprozess anderen Bedingungen als ein globaler. Als die Europäischen Gemeinschaften 1957/1958 gegründet wurden, bestanden sie aus sechs Ländern der produktivsten Industrieregionen der Welt, die sich auf vergleichbarem Niveau befanden; lediglich in Süditalien war die Produktivität deutlich niedriger. Nichtsdestoweniger wurde bereits mit dem Vertrag von Rom (1957) auch die Gründung der Europäischen Investitionsbank festgelegt, um Investitionen in weniger entwickelten Regionen zu unterstützen. Mit den verschiedenen Beitrittsrunden der heutigen Europäischen Union haben die regionalen Disparitäten jedoch zugenommen, zunächst durch den Beitritt der Republik Irland 1973, in den 1980er-Jahren durch die Süderweiterungen 1981 (Griechenland) und 1986 (Portugal und Spanien) und schließlich durch die Osterweiterungen seit 2004. Parallel zu dieser Entwicklung wurden die Bemühungen um eine Verringerung der Disparitäten erhöht, zunächst 1975 mit der Gründung des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung.
Die Einheitliche Europäische Akte (1986) legte die Entwicklung hin zum Europäischen Binnenmarkt bis 1992 fest. Mit der unbeschränkten Niederlassung von Arbeit, Waren, Dienstleistungen und Kapital („vier Freiheiten“) wurde jedoch auch die Gefahr gesehen, dass einige Regionen und Länder Nachteile erfahren würden: Bei Liberalisierungen besteht grundsätzlich die Gefahr, dass bestimmte Ökonomien an Wettbewerbsfähigkeit einbüßen und eine Abwärtsspirale in Gang
gesetzt wird – einerseits, weil bei der Liberalisierung des Außenhandels ein in der Region produziertes Gut nun überlegener Konkurrenz von außen ausgesetzt wird,
176.png|495x423px|C:\Users\SES\Desktop\Abbildung 1_7 BMP.bmp]]
Abb. 1.7: Das BRP je Einwohner in den NUT2-Regionen der EU in Euro je Einwohner, 2013, Klasseneinteilung in Septilen [31]
andererseits, weil freier Verkehr von Arbeit und Kapital eine räumliche Konzentration der industriellen Produktion tendenziell noch verstärken. Um diese erwarteten negativen Auswirkungen abzufedern, wurde in der Einheitlichen Europäischen Akte explizit festgelegt, dass es Ziel der Gemeinschaft sei, die regionalen Disparitäten zu verringern. Die Regionalpolitik der Europäische Union wirkt demnach Entzugseffekten entgegen, indem über den Strukturfonds in benachteiligten Regionen insbesondere in die Infrastruktur investiert wird, wobei die Mittel aus dem EU-Haushalt stammen und somit überwiegend aus Steuern, die in den wohlhabenderen Regionen eingenommen werden.
Seit den 1980er-Jahren wurden die Mittel zur regionalen Förderung erheblich erhöht und erreichten 1993 bereits über 20 Mrd. ECU. Heute bilden die Mittel zur regionalen Förderung mittlerweile sogar den größten Ausgabeposten im EU-Haushaltsplan 2014-2020, das Budget beträgt im Durchschnitt 46,5 Mrd. Euro jährlich (zu Preisen von 2011), was rund einem Drittel des gesamten EU-Haushalts entspricht. Es stellt sich naturgemäß die Frage, ob diese Politik der Förderung rückständiger Gebiete erfolgreich ist. Einerseits wiesen die sogenannten Kohäsionsländer (d.h. von den EU-Förderungen besonders begünstigte Mitgliedstaaten) Griechenland, die Republik Irland, Portugal und Spanien seit den späten 1980er-Jahren relativ hohe Wachstumsraten des BIP auf und haben zum Mittelwert der EU aufgeschlossen oder ihn sogar übertroffen. Allerdings sind gerade diese Ökonomien von der 2008 ausgebrochenen Krise besonders betroffen und haben sich auch rund zehn Jahre danach noch nicht davon erholen können. Eine umfassende wissenschaftliche Analyse, inwieweit zwischen den hohen Wachstumsraten vor der Krise und der besonderen Betroffenheit von der Krise ein ursächlicher Zusammenhang besteht, steht bisher zwar noch aus. Die Krise macht jedoch deutlich, dass diese vier Länder, die bereits im 19. Jahrhundert im Verlauf der Industrialisierung den Anschluss verpassten, auf absehbare Zeit auch im 21. Jahrhundert ihre relativen Rückstande nicht wettmachen werden können.
Ähnliches wie für die Kohäsionsländer gilt im Prinzip auch für die seit 2004 der EU beigetretenen Staaten (neue Mitgliedstaaten, NMS): Diese weisen nach den durch die Transformation bedingten Rezessionen seit Mitte der 1990er-Jahre im Allgemeinen relativ hohe Wachstumsraten auf. Durch den Beitritt zum Binnenmarkt kam es zu einer regen Investitionstätigkeit von Unternehmen aus den EU-15, was nicht nur die industrielle Produktion, sondern durch den damit verbundenen Technologieschub auch die Produktivität erhöhte. Dieser Prozess kann jedoch nicht ewig fortgesetzt werden, auch wenn die NMS im Gegensatz zu den Kohäsionsländern seit Ausbruch der Krise weiterhin hohe Wachstumsraten aufweisen. Wie in Kapitel 1.2.3 gezeigt wurde, ist es bei hohem Sachkapitalbestand nötig, über einen hohen Humankapitalstand zu verfügen, um attraktiv für weitere Sachkapitalinvestitionen zu bleiben. Aufgrund der anhaltenden Abwanderung von Humankapitalträgern aus den NMS in Richtung EU-15 ist allerdings fraglich, ob die NMS ihren Aufholprozess fortsetzen werden können.
Von den 1980er-Jahren bis zum Ausbruch der Krise konnte für die Regionen der EU statistisch sowohl Beta- wie Sigma-Konvergenz gezeigt werden: Die Varianz nahm kontinuierlich ab, die Konvergenzgeschwindigkeit lag je nach ökonometrischer Spezifikation zwischen ein und zwei Prozent jährlich. Angesichts der vielen wirtschaftspolitischen Umwälzungen in dieser Zeit war der Konvergenzprozess bemerkenswert robust. Seit 2008 liegt jedoch weder Beta- noch Sigma-Konvergenz vor. Ein Grund für das Erliegen des Konvergenzprozesses ist, dass die ehemaligen Kohäsionsländer von der Krise besonders betroffen sind. Ein zweiter Grund ist jedoch innerhalb der NMS zu suchen; innerhalb dieser Länder sind Disparitäten stark ausgeprägt und verstärken sich tendenziell noch. So kommt es durch den Boom der Zentren innerhalb dieser Länder zwar einerseits zu einem Aufholprozess auf Ebene der Mitgliedstaaten, während sich innerhalb der Mitgliedstaaten die Disparitäten noch vergrößern.
Dieser Prozess ist nicht zuletzt deshalb problematisch, da die Persistenz der strukturellen Probleme größerer Regionen wie Süditalien oder Ostdeutschland zeigt, dass auch jahrzehntelange Förderungen nicht zwangsläufig erfolgreich sind.
Zusammenfassung
- Die Theorie langfristigen Wachstums unterscheidet sich grundlegend von Überlegungen zum kurz- bis mittelfristigen Wachstum, da Instrumente der Konjunkturpolitik unberücksichtigt bleiben. Stattdessen bestimmt in der neoklassischen Wachstumstheorie die Entwicklung der Produktionsfaktoren die langfristige Entwicklung. Hauptaussage der grundlegenden, auf Robert Solows Arbeiten basierenden Modelle ist, dass Kapitalakkumulation alleine nur in der mittleren Frist das Wachstum je Arbeitseinheit zu erhöhen in der Lage ist – langfristig tendiert die Ökonomie zu einem Gleichgewichtspfad, der der Rate des technologischen Fortschritts entspricht.
Aus der neoklassischen Theorie lassen sich drei wesentliche Kräfte identifizieren, die einen Ausgleich unterschiedlicher Produktionsniveaus unterschiedlicher Ökonomien bewirken können: Die Entwicklung zum eigenen Gleichgewichtspfad, die mit zunehmender Menge akkumulierten Kapitals abnehmende Grenzproduktivität des Kapitals, sowie technologische Aufholprozesse. Demgegenüber stehen Thesen zur regionalen Polarisation, die insbesondere für Regionalwirtschaften von Bedeutung sind: Sie beschrieben, wie ein Zentrum die Peripherie dominiert und sich die Disparitäten im Lauf der Zeit noch verstärken können.
Niveau und Wachstum einer Ökonomie werden über die Größen der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung erfasst, in welcher für verschiedene Fragestellungen eine Auswahl an Größen erfasst sind. Ein weltweiter Vergleich des Bruttoinlandsprodukts seit 1970 zeigt, dass eine allgemeingültige Konvergenz-Hypothese durch die Empirie generell nicht gestützt wird, wiewohl temporäre Aufholprozesse beobachtet werden können. Innerhalb der EU ließ sich bis zum Ausbruch der Krise ein allgemeiner Trend der interregionaler Konvergenz beobachten, der seit 2008 jedoch zum Erliegen gekommen ist.
Übungen
|
- Der stationäre Zustand bezeichnet eine Entwicklung, in der die Ökonomie nicht mehr wächst, da landwirtschaftliche Produktion und Kapitalakkumulation ihre theoretischen Maxima erreicht haben.
- Der Steady-State bezeichnet eine Entwicklung, in der die Ökonomie mit konstanter Rate wächst. Diese Rate kann positiv, gleich null, oder theoretisch auch negativ sein. Eine positive Wachstumsrate der Gesamtwirtschaft kann mit einer negativen Wachstumsrate je Einwohner zusammenfallen.
- Ab einer hinreichenden Größe kann eine Ökonomie von einer Spezialisierung nicht weiter profitieren: Die Verdopplung aller Inputs führt zu einer Verdopplung des Outputs.
- Ist noch relativ wenig von einem Faktor vorhanden, so wird eine zusätzliche Einheit die Produktion erheblich erhöhen. Nimmt die Menge des Faktors weiter zu, während der oder die anderen konstant bleiben, so werden weitere Einheiten immer weniger zur Produktion beitragen.
- Die Entwicklung des Kapitalstocks je Arbeitseinheit über die Zeit ist in der Differentialgleichung Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \dot{k}_{t}=s_{K} y_{t}-(n+\delta) k_{t}} beschrieben. Daraus folgt, dass Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \dot{k}_{t}>0} wenn Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle s_{K} y_{t}>(n+\delta) k_{t}} .
- Eine Senkung der Sparquote führt zu einem Rückgang des Wachstums, bis die Ökonomie beim neuen, niedrigeren Gleichgewichtspunkt angelangt ist.
- Der Output ist durch die Funktion Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \hat{y}_{t}=\hat{k}_{t}^{\alpha}} beschrieben. Die erste Ableitung ergibt Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \partial \hat{y}_{t} / \partial \hat{k}_{t}=\alpha \hat{k}_{t}^{\alpha-1}} und ist eindeutig positiv, da alle Variablen positiv sind.
- Aus Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle c Y_{t}=f\left(c K_{t}, c L_{t}\right)} folgt im Cobb-Douglas-Fall Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle f\left(c K_{t}, c L_{t}\right)=\left(c K_{t}\right)^{\alpha}\left(c L_{t}\right)^{1-\alpha}=c^{\alpha} c^{1-\alpha} K_{t}^{\alpha} L_{t}^{1-\alpha}=c f\left(K_{t}, L_{t}\right)}
- Die erste Ableitung ergibt Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \partial \hat{y}^{*} / \partial s_{K}=\alpha /\left[(1-\alpha) s_{K}^{1 /(1-\alpha)}(n+g+\delta)^{\alpha /(1-\alpha)}\right]} , da alle Variablen als positiv definiert sind und Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \alpha<1} gilt.
- Eine Verzehnfachung der Produktionsfunktion lässt sich anschreiben als Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 10 y_{t}=10 k_{t}^{\alpha}} , woraus folgt Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 10 y_{t}=\left(10^{1 / \alpha} k_{t}\right)^{\alpha}} . Aus Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \alpha=1/3} ergibt sich eine Kapitalausstattung je Arbeitseinheit um das Tausendfache.
- Die erste Ableitung ergibt Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \partial \hat{y}^{*} / \partial s_{H}=[1 /(1-\alpha-\beta)]\left[s_{K} s_{H}^{-\alpha-\beta}(n+g+\delta)^{-\alpha-\beta}\right]^{1 /(1-\alpha-\beta)}} , da alle Variablen als positiv definiert sind und Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \alpha+\beta<1} gilt, ist die Ableitung positiv.
- Aus der Produktionsfunktion folgt für das gesamte Lohnaufkommen Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle W_{t}=L_{t}\left(\partial Y_{t} / \partial L_{t}\right)+H_{t}\left(\partial Y_{t} / \partial H_{t}\right)=(1-\alpha-\beta) Y_{t}+\beta Y_{t}=(1-\alpha) Y_{t}} . Der Durchschnittslohn ergibt aus der Division des gesamten Lohnaufkommens durch das Arbeitsangebot: Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle W_{t} / L_{t}=w_{t}=(1-\alpha) A_{t} \hat{k}_{t}^{\alpha} \hat{h}_{t}^{\beta}}
- Das Lucas-Paradoxon bezeichnet die empirische Beobachtung, dass Investitionen größtenteils in Ökonomien stattfinden, die bereits über eine hohe Kapitalausstattung je Arbeitseinheit verfügen.
- Nicht-Rivalität: Die Anwendung einer Einheit Wissens vermindert nicht den Bestand an vorhandenem Wissen.
- Lokalisationsvorteile sind Kostenvorteile, die sich aus der räumlichen Ballung von Unternehmen der selben Industriebranche ergeben.
- Zentripetale Entzugseffekte bezeichnen negative Auswirkungen des Wachstums einer Region auf eine andere, was zu einer Vertiefung bereits bestehender Disparitäten führt.
- Das BIP entspricht der Wertschöpfung zu Marktpreisen nach dem Inlands-Prinzip, das BNE entspricht der Wertschöpfung zu Marktpreisen nach dem Inländer-Prinzip. Die Größen unterscheiden sich um den Saldo der Primäreinkommen zwischen Inländern und übriger Welt.
- Hinweise: 1. Das BIP misst nicht das Vermögen, sondern das Einkommen. 2. Das BIP misst nicht das erhaltene, sondern das produzierte Einkommen.
- U.a. Deutschland, Frankreich und Italien gegenüber Großbritannien im 19. und teilweise 20. Jh., europäische OECD gegenüber den USA in der zweiten Hälfte des 20. Jh., außerdem ostasiatische Länder wie Singapur oder die Republik Korea in den vergangenen 30 bis 40 Jahren.
- Die Abstände zwischen den produktiven, wohlhabenden Ökonomien und den weniger produktiven Ökonomien blieben seit 1970 in den meisten Fällen konstant oder vergrößerten sich.
- 1. Liberalisierung des Außenhandels können zu überlegener Konkurrenz von außen führen.2. Freier Verkehr von Arbeit und Kapital führt zu einer tendenziellen Verstärkung räumlicher Konzentration der industriellen Produktion.
- Innerhalb der Regionen und Länder der EU und EFTA lässt sich eine Konvergenz beobachten. Gleichzeitig zeigt sich jedoch eine Zunahme der regionalen Disparitäten innerhalb vieler Länder.
Arbeit, Löhne und Gewinne
Mit der Industrialisierung und der Lohnarbeit als wichtigste oder einzige Einkommensquelle breiter Bevölkerungsmassen verbunden ist seit jeher die Furcht vor Arbeitslosigkeit. Aber auch wer im Produktionsprozess als unselbständig Beschäftigter fest integriert ist, findet sich in seinem Selbstverständnis erheblich beeinflusst von seiner Stellung innerhalb dieses Prozesses – der Arbeitsmarkt ist folglich jener Markt, der in der öffentlichen Diskussion die meiste Beachtung findet. Durch die Doppelrolle der Arbeit als Produktionsfaktor und Konsumnachfrager kommt es zu einer Wechselwirkung von Arbeitsnachfrage und Produktion, welche in der keynesianischen Makroökonomie hervorgehoben wird. In Kapitel 2.1.1 wird erläutert, welche Auswirkungen diese Wechselwirkung auf den Arbeitsmarkt hat, bevor in Kapitel 2.1.2 die sich daraus ergebenden Konsequenzen für die Wirtschaftspolitik behandelt werden.
Fragen der Einkommensverteilung sind naturgemäß eng mit Arbeitsmärkten verbunden, weshalb die Arbeitslosigkeit die Einkommensverteilung beeinflussen kann. Zwar weicht der Arbeitsmarkt in seinen Gesetzen in einigen wesentlichen Punkten von Gütermärkten ab, doch ist auch hier grundsätzlich das Verhältnis von Angebot und Nachfrage für die Preisbestimmung entscheidend. Dieses beeinflusst sowohl die Einkommensverteilung zwischen Kapital und Arbeit sowie die Verteilung der Einkommen innerhalb der Arbeitnehmer. In den fortgeschrittenen Volkswirtschaften haben sich komplexe Systeme herausgebildet, die zur Aushandlung des Verhältnisses Kapital und Arbeit dienen. In Kapitel 2.2.1 werden die Grundlagen dieses Verhältnisses sowie die Grundzüge des österreichischen Systems erläutert, bevor in Kapitel 2.2.2 die Entwicklungen und Kräfte, welche dieses Verhältnis beeinflussen, diskutiert werden.
Um Aussagen zur Höhe der Arbeitslosigkeit zu bekommen, ist – ähnlich wie bei Fragen zum Wachstum – erst einmal nötig, zu definieren, was mit „arbeitslos“ gemeint ist. Nach der ökonomischen Definition von Arbeitslosigkeit sind all jene arbeitslos, die bereit sind, zum herrschenden oder zu einem geringfügig niedrigeren Lohn eine Arbeit zu akzeptieren und dennoch keine finden – diese Definition lässt jedoch mehrere empirische Konzepte zu. Auch bei der Einkommensverteilung gibt es unterschiedliche Konzepte, insbesondere muss die Verteilung auf die Faktoren nicht zwangsläufig mit der Verteilung auf Personen übereinstimmen. In Kapitel 2.3.1 werden die in Österreich zur Anwendung kommenden Konzepte der Arbeitskräfteerhebung, in Kapitel 2.3.2 jene der Einkommensverteilung präsentiert. In Kapitel 2.4.1 wird anschließend die jüngere Entwicklung von Beschäftigung und Arbeitslosigkeit in Österreich beleuchtet, ehe abschließend in Kapitel 2.4.2 das vorhandene Datenmaterial auf seine Aussagekraft zur Einkommensverteilung geprüft wird.
Unvollkommene Arbeitsmärkte
Auch der Arbeitsmarkt ist zunächst einmal ein Markt im ökonomischen Sinn, weshalb es als ersten Schritt sinnvoll ist, ihn entsprechend den Gesetzen zu untersuchen, die auch auf den Gütermärkten herrschen. Hier kann an Grundlagen der Volkswirtschaftslehre 3 angeknüpft werden, wo das Zusammenspiel von Angebot und Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt einführend behandelt wurde. In einer solchen Betrachtung wird v.a. auf die Rolle der Unternehmen als Nachfrager der Arbeit in einem kompetitiven Markt fokussiert. Diese gleichgewichtsorientierte Sichtweise ist naheliegend, denn auch der Arbeitsmarkt stellt eine Tauschinstitution dar, deren wichtigste Aufgabe die Allokation von Ressourcen – in diesem Fall des Faktors Arbeit – darstellt. Tatsächlich ist unmittelbar einsichtig, dass die Nachfrage der Unternehmen mit dem Preis abnimmt, und das Angebot der Arbeitenden mit dem Preis zunimmt.
Eine auf diese Weise in Analogie zu anderen Märkten erfolgende Betrachtung des Arbeitsmarktes abstrahiert jedoch von einer Reihe von Besonderheiten des Arbeitsmarktes. Die für die ökonomische Analyse wichtigste dieser Besonderheiten ist die Doppelrolle der Arbeit: Sie ist sowohl ein Produktionsfaktor, als auch die wichtigste Determinante der Kaufkraft und somit der Güter- und Geldnachfrage. Vor allem die keyensianischen Theorie beleuchtet Unvollständigkeiten auf Arbeitsmärkten und fokussiert auf die Wechselwirkungen zwischen der Nachfrage der Produzenten nach Arbeit und der Nachfrage der Arbeiter nach den Produkten (der Produzenten). Demnach wird das Ausmaß der Beschäftigung nicht auf dem Arbeitsmarkt am Schnittpunkt zwischen Arbeitsangebot und -nachfrage bestimmt, sondern auf dem Gütermarkt, hier am Schnittpunkt zwischen der aggregierten Angebotsfunktion und der aggregierten Nachfragefunktion.
Arbeitsangebot und Arbeitslosigkeit
Charakteristisch für einen gleichgewichtsorientierten Zugang ist die grundsätzliche Analogie des Arbeitsmarktes zu anderen Märkten. Angebot und Nachfrage mögen variieren, aber es gibt demnach immer einen Preis der Arbeit, der Vollbeschäftigung garantiert. Sollte dies nicht der Fall sein und sich der Arbeitsmarkt in einem Ungleichgewicht befinden, kommt es zu einem Anpassungsprozess: Durch die Konkurrenz der Arbeitnehmer untereinander kommt es bei einem aktuellen Lohn oberhalb des Gleichgewichtslohns so lange zu einer Lohnsenkung, bis das Gleichgewichtsniveau erreicht ist (und analog zu einer Lohnerhöhung im Falle eines aktuellen Lohn unterhalb des Gleichgewichtslohns). Eine Implikation dieses Zugangs ist die „freiwillige Arbeitslosigkeit“: Fällt das Lohnniveau, sind weniger Menschen bereit, ihre Arbeitskraft anzubieten; steigt das Lohnniveau, so steigt auch das Arbeitsangebot.
Die offensichtliche Schwäche der daraus resultierenden Modelle ist die Realität: Empirisch ist nicht zu beobachten, dass bei sinkenden Reallöhnen die Arbeitslosigkeit zurückgeht. Methodisch ist daher fraglich, wie realistisch die Annahme „freiwilliger Arbeitslosigkeit“ ist, d.h. ob die Abstrahierung des Arbeitszwangs, der für viele zur Bestreitung ihres Lebensunterhalts offenkundig gegeben ist, a priori zu geeigneten Ergebnissen führen kann. Darüber hinaus wird vernachlässigt, dass Löhne nicht nur Preise, sondern auch Einkommen darstellen: Wenn Letztere sinken, so werden bei konstanter Sparquote weniger Konsumgüter nachgefragt, was in weiterer Folge zu sinkenden Preisen führt. Dies führt wiederum zu einer Produktionssenkung der Anbieter der Konsumgüter, und konsequenterweise zu einem Rückgang der Beschäftigung.
Diese Doppelrolle der Arbeit als Produktionsfaktor einerseits und als Nachfrager nach Gütern andererseits ist einer der Ausgangspunkte in den Theorien von John Maynard Keynes. Methodisch handelt es sich als Ergänzung zur neoklassischen Theorie: Zentral für das Verständnis ist hierbei die Auffassung, dass das kapitalistische System in der Regel nicht einem Gleichgewichtszustand zustrebt. Ein solcher Zustand wird zwar nicht ausgeschlossen, doch der Normalzustand ist aus keynesianischer Perspektive der eines Ungleichgewichts. Hieraus leitet sich die Notwendigkeit für staatliche Eingriffe in Märkte ein.
Keynes’ Theorien sind v.a. für Fragestellungen der kurzen Frist relevant: Während die in Kapitel 1 behandelte Wachstumstheorie langfristiger Natur ist und daher von Fragen wie der Arbeitslosenrate oder der Geldpolitik absehen kann, sind nun hingegen Fragen der Kapitalakkumulation oder des technologischen Fortschritts vernachlässigbar. Kurzfristiges Wachstum ist folglich vor allem eine Frage der Auslastung bereits vorhandener Kapazitäten, wohingegen langfristiges Wachstum eher eine Frage des Aufbaus solcher Kapazitäten ist. Arbeitslosigkeit ist ein Symptom für eine Dysfunktionalität des Arbeitsmarktes, als das Nachfrage-Preis-System offensichtlich nicht funktioniert, da bei anhaltender Arbeitslosigkeit der betreffende Markt nicht geräumt ist: Ein Teil des Faktors Arbeit liegt brach. Daraus ergibt sich nicht nur ein ökonomisches, sondern auch ein politisches Problem, da Kapital und Arbeit keine sozial äquivalenten Produktionsfaktoren sind: Wenn Kapital im Produktionsprozess nur zum Teil eingesetzt wird, ergibt sich daraus kein unmittelbares soziales Problem; eine Unterauslastung des Faktors Arbeit hingegen wird als Arbeitslosigkeit sofort sichtbar und zur Herausforderung für die Politik.
Entscheidend in der keynesianischen Theorie ist die Annahme, dass der Beschäftigungsgrad von der Gesamtnachfrage bestimmt wird: Die gesamtwirtschaftliche Nachfrage muss zunehmen, um die Nachfrage nach dem Faktor Arbeit zu erhöhen, woraus sich eine Abhängigkeit des Beschäftigungsgrads von Konsumneigung und Neuinvestitionen (privat und staatlich) ergibt. Diese Berücksichtigung der Wechselwirkung zwischen den Märkten impliziert zunächst einmal, dass die Beschäftigungswirkung einer Lohnsenkung nicht eindeutig ist. Im Gegensatz zu Gütermärkten wird der Arbeitsmarkt nicht zwangsläufig geräumt, wenn der Preis für Arbeit bloß niedrig genug ist: Zwar sinken durch eine Nominallohnsenkung auch die Produktionskosten, was einen die Beschäftigung erhöhenden Effekt hat. Demgegenüber steht jedoch ein Rückgang der Nachfrage durch die sinkende Kaufkraft der Arbeitskräfte.
Eine weitere Auswirkung von Nominallohnsenkungen betrifft das erwartete Verhalten der Unternehmen: Eine Nominallohnsenkung führt zu niedrigeren Preisen, was bei Unternehmen die Erwartung weiterer Preissenkungen auslöst, was wiederum ihre Investitionsentscheidungen negativ beeinflusst. [32] Die Grenzproduktivitätstheorie bildet hierbei keinen Widerspruch, vielmehr behält die Annahme kurzfristig sinkender Grenzerträge ihr Erklärungsvermögen: Für einen einzelnen Betrieb behält die Ceteris-Paribus-Beziehung ihre Gültigkeit, wonach eine Ausweitung der Beschäftigung zu einem sinkenden Grenzprodukt des Faktors Arbeit führt und es folglich zu einem sinkenden Reallohn kommt. Unternehmen maximieren ihren Gewinn, indem sie die Produktion ausdehnen bis zu jenem Punkt, wo das Grenzprodukt der Arbeit gleich dem Reallohn ist, wobei sich die Grenzproduktivitätskurve mit unterschiedlichen Auslastungsgraden auch verschieben kann.
Wenn nun das tatsächliche Beschäftigungsausmaß nicht nur vom momentanen Preis des Faktors Arbeit, sondern in letzter Konsequenz am Gütermarkt bestimmt wird, so hängt das gleichgewichtige Beschäftigungsvolumen nicht vom Reallohn ab, sondern vielmehr von drei Faktoren:
- erstens von der gesamtwirtschaftlichen Angebotsfunktion, d.h. dem gesamtwirtschaftlichen Output;
- zweitens von der Konsum- und Sparneigung der privaten Haushalte, und
- drittens vom Investitionsvolumen.
Hier ist zu beachten, dass im Gegensatz zur in Kapitel 1 behandelten Wachstumstheorie die Gleichsetzung von Sparvolumen und Investitionsvolumen nun nicht gegeben ist. Für langfristige Betrachtungen stellt eine solche Gleichsetzung eine plausible Annahme dar, kurzfristig jedoch schwankt das Wachstum v.a. aufgrund der Schwankungen der Investitionstätigkeit.
Es kommt zu „unfreiwilliger Arbeitslosigkeit“, wenn Arbeiter bereit sind, für den laufenden Nominallohn zu arbeiten, auch wenn das zu möglichen Reallohneinbußen führt. Kurzfristig sind die Nominallöhne jedoch starr (etwa aufgrund bestehender Kollektivverträge) und der Produzent ist womöglich weder willens noch in der Lage, die Belegschaft unmittelbar anzupassen. Eine Nominallohnsenkung wäre jedoch aufgrund der oben skizzierten Effekte auf die Erwartungen der wirtschaftlichen Akteure keine Lösung des Problems, sondern würde es womöglich noch verschärfen.
Die Alternative liegt in einer Erhöhung der Nachfrage über eine Erhöhung der gesamtwirtschaftlichen Ausgaben, die durch eine Erhöhung der staatlichen Ausgaben herbeigeführt werden kann. Es lassen sich drei Hauptgründe finden, weshalb der Staat durch aktives Eingreifen versuchen soll, Arbeitslosigkeit zu reduzieren oder zu verhindern:
Die eigentlichen volkswirtschaftlichen Kosten der Arbeitslosigkeit sind der Wert der Güter und Leistungen, die von den Arbeitslosen produziert würden, wenn sie Arbeit hätten. Personen, die bereit sind zu arbeiten, aber keine Arbeit finden, sind der Ausdruck eines Allokationsproblems der Verschwendung ökonomischer Ressourcen. In unserer Notation bedeutet Arbeitslosigkeit, dass ein Teil des verfügbaren Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle L} nicht eingesetzt wird, und Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle Y} als in Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle L} steigende Funktion deshalb einen niedrigeren Wert aufweist als potenziell möglich.
-
Daraus folgt, dass die durch die Arbeitslosigkeit geringere Produktion das Steueraufkommen sinken lässt, während durch die Leistungen der Arbeitslosenversicherung sowie weiterer Unterstützungen die Ansprüche an die öffentlichen Budgets steigen. Ökonomisch gesehen kommt ein Teil des verfügbaren Faktors Arbeit zwar nicht zum Einsatz, muss aber erhalten werden. Politisch gesehen beeinträchtigen Defizite der öffentlichen Haushalte die Handlungsfähigkeit des Staates.
Es ist hierbei ökonomisch irrelevant, ob soziale Leistungen über das Steuersystem oder über andere staatliche Einrichtungen finanziert werden.
Arbeitslosigkeit führt auf der individuellen Ebene zu einem erhöhten Armutsrisiko, insbesondere dann, wenn das Einkommen bereits vor der Arbeitslosigkeit niedrig war. Wenn Arbeitslosigkeit regional gehäuft auftritt, wird das soziale Gefüge ganzer Regionen geschädigt. Bei lange anhaltender Massenarbeitslosigkeit droht dem Staat selbst die Gefahr einer politischen Destabilisierung.
Der Staat hat in einem marktwirtschaftlichen System prinzipiell drei Möglichkeiten, auf Arbeitslosigkeit zu reagieren, nämlich durch
- Beschäftigungspolitik, worunter das Bemühen des Staates fällt, durch gesamtwirtschaftliche Nachfrage eine hohe Beschäftigung zu sichern, z.B. durch Ausweitung der staatlichen Investitionen, Erhöhung des privaten Konsums durch Steuersenkungen etc.;
- passive Arbeitsmarktpolitik, worunter die Zahlung von Transfereinkommen an Arbeitslose fällt (Arbeitslosengeld), wobei der damit ermöglichte Konsum ebenfalls eine die Nachfrage erhöhende Wirkung hat; sowie
- Arbeitsmarktpolitik, welche insbesondere die Anpassung der (Qualifikations-)Struktur des Arbeitskräfteangebots an die Nachfrage bezeichnet, u.a. durch Schulungen, Förderungen etc.
Staatsausgaben und Multiplikator-Effekt
Im Folgenden wird der Multiplikator-Effekt, der aus einer Expansion der Staatsausgaben herrührt, formal dargestellt. Betrachtet wird eine offene Volkswirtschaft in der kurzen Frist, weshalb von der Zeit abstrahiert wird. Der private Konsum Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle C} setzt sich zusammen aus dem autonomen Konsum Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle c_o} und der Funktion Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle c_1 (Y-T)} mit Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle T} als dem gesamten Steueraufkommen, wobei der Parameter Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle c_1} die marginale Konsumquote (Grenzneigung zum Konsum) darstellt: Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle C=c_0+c_1 (1-t)Y }
(2.1)
wobei Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle T=tY} gilt, Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle t} daher die Steuerquote darstellt. Aus der Gleichsetzung der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle Z} mit der Produktion Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle Y} ergibt sich für eine offene Volkswirtschaft Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle Y=c_0+c_1 (1-t)Y+I+G+X }
(2.2)
wobei Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle I} das Investitionsvolumen und Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle G} das Ausmaß der Staatsausgaben darstellen. Das Volumen der Nettoexporte Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle X} ist die Summe der gesamten Exporte abzüglich der Summe der gesamten Importe, die Funktion der Nettoexporte wird dargestellt als Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle X=x_0-x_1 Y }
(2.3)
wobei Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle x_0} als autonomer Import und Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle x_1} als marginale Importquote (Grenzneigung zum Import) interpretiert werden können. Analog zur Konsumfunktion wird von der Annahme ausgegangen, dass neben einer gewissen Mindestimportmenge Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle x_0} die Menge der gesamten Importe abhängig vom Einkommen ist. Jedoch ist nun das Vorzeichen umgekehrt: Mit steigendem Einkommen steigen die Importe, weshalb die Netto-Exporte sinken. Mit anderen Worten: Mit jeder Geldeinheit, um die Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle Y} steigt, steigen die Importe (bzw. sinken die Nettoexporte) um Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle t} Geldeinheiten. Gleichung (2.3) kann in (2.2) eingesetzt werden und man erhält: Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle Y=c_0+c_1 (1-t)Y+I+G+x_0-x_1 Y }
(2.4)
Explizit für Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle Y} ausgedrückt ergibt dies Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle Y=\frac{c_{0}+I+G+x_{0}}{1-c_{1}(1-t)+x_{1}} }
(2.5)
Abgeleitet nach Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle c_0} , Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle I} , Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle G} oder Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle x_0} erhält man daher als Multiplikator für eine offene Volkswirtschaft Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 1/(1-c_1 (1-t)+x_1)} .
Zwar können grundsätzlich alle Variablen auf der rechten Seite in Gleichung (2.5) beeinflusst werden, von besonderem Interesse sind jedoch die Staatsausgaben Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle G} : Insbesondere in Krisensituationen steht hier ein Instrument zur Verfügung, das über die bloße Nachfrageerhöhung hinaus via Multiplikator-Effekt das BIP erhöht. Aus der Gleichung geht außerdem hervor, dass der Multiplikator mit der Grenzneigung zum Konsum steigt und mit der Grenzneigung zum Import sowie der Steuerrate sinkt. Daraus folgt, dass der Multiplikator-Effekt beispielsweise durch eine geeignete Steuerpolitik beeinflusst werden kann: Da Bezieher niedriger Einkommen tendenziell eine höhere Konsumquote und eine niedrigere Importquote aufweisen, wird durch eine progressive Steuerpolitik der Nachfrageimpuls noch erhöht. Das Wachstum wird demnach eher wieder steigen, die Arbeitslosigkeit sinken, die Wirtschaft sich stabilisieren.
Eine weitere Implikation des Multiplikators sind die Folgen auf den öffentlichen Haushalt und die Leistungsbilanz. Aus einer Erhöhung der Staatausgaben ohne vermehrte Steuereinnahmen in gleicher Höhe ergibt sich ein höheres Defizit (oder gegebenenfalls ein geringerer Überschuss) des öffentlichen Budgets: Die Staatsschulden steigen. Aus Gleichung (2.3) ist außerdem ersichtlich, dass durch den Nachfrageimpuls der erhöhten Staatsausgaben die Importe steigen, was sich bei konstanten Exporten negativ auf die Nettoexporte und somit negativ auf die Leistungsbilanz auswirkt. Hieraus ergibt sich eine Beziehung der beiden Saldi: Eine Erhöhung des Haushaltsdefizits zieht ein höheres Leistungsbilanzdefizit nach sich. Da Letzteres wiederum konkret bedeutet, dass sich Inländer im Ausland verschulden, wird somit ein Teil des erhöhten Haushaltsdefizits vom Ausland finanziert.
In Österreich war die Verschuldungspolitik lange Zeit von keynesianisch geprägten Überlegungen getragen (Austro-Keynesianismus), um durch staatliche Ausgaben Nachfragelücken zu reduzieren und so eine höhere Auslastung des Produktionspotenzials zu erreichen. Neben Stabilisierungseffekten kam es mittelfristig jedoch zu einer erheblichen Erhöhung des Staatsschuldenniveaus, insbesondere in den 1970er-Jahren während der beiden Ölpreisschocks 1973 und 1979. Der öffentliche Schuldenstand stieg bis 1980 auf 35,4% des BIP, und erreichte 1988 einen vorläufigen Höhepunkt mit 56,7%, 1995/1996 einen weiteren Höhepunkt mit 68,3%, ehe das Verhältnis zum BIP bis zum Ausbruch der Krise 2008 rückläufig war. [33] Von 2008 auf 2009 hat sich durch Maßnahmen zur Bewältigung der Krise (insbesondere umstrittener Unterstützungen für zahlungsunfähige Banken) der Schuldenstand schlagartig von 68,8% auf 80,1% erhöht und erreichte 2015 seinen vorläufigen Höhepunkt mit 85,5%.
Es zählt an sich zur Grundidee keynesianscher Wirtschaftspolitik, dass Budgetdefizite in Zeiten geringerer Nachfrage durch folgende Budgetüberschüsse ausgeglichen werden. Aus Gründen, auf die im Rahmen dieses Skriptums nicht näher eingegangen werden kann, zeigen die meisten mittel- und westeuropäischen Volkswirtschaften jedoch eine ähnliche Entwicklung wie Österreich, d.h. eine Erhöhung der öffentlichen Schulden seit den frühen 1970er-Jahren bis in die 1990er-Jahre. Im Verlauf der 2008 ausgebrochenen Krise flammte die Diskussion keynesianischer versus gleichgewichtsorientierter Politik neu auf. Während zahlreiche Ökonomen eine Ausweitung der Staatsausgaben zur Überwindung der Krise fordern, wird zumindest innerhalb der Eurozone bislang eine gleichgewichtsorientierte Politik verfolgt, die bestrebt ist, Arbeitslosigkeit und wirtschaftliche Stagnation durch Lohnsenkungen zu überwinden. Angesichts der fortwährenden Stagnation der Wirtschaft der Eurozone seit Ausbruch der Krise kann die praktizierte Politik nicht als erfolgreich bezeichnet werden. Es sei jedoch hinzugefügt, dass sich die meisten Länder der Eurozone (einschließlich Österreich) des Einsatzes des Multiplikators selbst beraubt hatten, als ihre Staatshaushalte auch in wirtschaftlich guten Jahren Defizite aufwiesen. Da der zweite wesentliche Aspekt keynesianischer Wirtschaftspolitik – Haushaltüberschüsse in prosperierenden Zeiten – nur selten (in Österreich: nie) umgesetzt wurde, fehlte den Ländern der Eurozone während der Krise ein entsprechender Spielraum: Die Länder der Eurozone hatten sich mit dem Vertrag von Maastricht verpflichtet, ihre Budgetdefizite auf maximal drei Prozent jährlich zu begrenzen und lagen schon vor der Krise oft nahe an dieser Grenze, mitunter sogar darüber.
Eine fortwährende Verschuldung des Staates auch in guten Zeiten ist jedoch nicht nur deshalb problematisch, weil in schlechten Zeiten weniger Spielraum für Haushaltsdefizite zur Verfügung steht. Zwar wird durch fortgesetztes Wirtschaftswachstum das Niveau der Staatsverschuldung relativiert. [34] Allerdings hat eine laufende Neuverschuldung, die über Jahre hinweg über dem Wirtschaftswachstum liegt, allgemein folgende Auswirkungen:
- Ein hohes Staatsschuldenniveau belastet künftige Generationen, insbesondere jene, die heute noch nicht wahlberechtigt sind und somit gar keine Möglichkeit haben, auf die Budgetpolitik Einfluss zu nehmen;
- die Zinszahlungen, die sich aus den Staatsschulden ergeben, sind selbst ein Teil des öffentlichen Haushalts und schränken den politischen Gestaltungsspielraum (auch in wirtschaftlich guten Zeiten) ein;
- diese Zinszahlungen wiederum bewirken eine Umverteilung in Richtung Kapitalbesitzer, da Vermögen im Allgemeinen stärker konzentriert sind als die Einkommen, aus denen diese Zahlungen finanziert werden.
Das früher hin und wieder diskutierte Problem eines möglichen Staatsbankrotts ist im Zuge der Euro-Krise aktuell geworden und hat im Falle Griechenlands bereits zu mehreren Schuldenschnitten geführt. Für Österreich ist dieses Thema bislang hypothetischer Natur, solange der Staat kreditwürdig ist und solange der Staat in der
Lage ist, in jener Währung, in der die Schulden zurückzuzahlen sind, Steuern einzuheben. [35] Von größerer Bedeutung sind die langfristigen Auswirkungen der Rückzahlung der Schulden und/oder der Zinszahlungen. Tatsächlich weisen die öffentlichen Haushalte in Österreich in den meisten Jahren einen Überschuss ohne Berücksichtigung der Zinszahlungen auf: Der Primärsaldo [36] ist in den meisten Jahren positiv, durch die Zinszahlungen für Schulden, die in der Vergangenheit gemacht wurden, kommt es jedoch insgesamt weiterhin zu einer Ausweitung der nominellen Staatsverschuldung.
Löhne und Gewinne
Mit der Einkommensentwicklung hängen naturgemäß Fragen der Einkommensverteilung zusammen, welche wiederum von der Situation am Arbeitsmarkt zumindest beeinflusst wird. Während in der klassischen Ökonomie die Folgen des Einsatzes von Maschinen untersucht werden und tendenziell eine Verteilungsentwicklung zugunsten des Kapitals erwartet wird, [37] wird die Verteilung in der neoklassischen Theorie vom Zusammenwirken der Grenzproduktentlohnung und dem Angebots- und Nachfrageverhältnis bestimmt. Letzteres ist wird wiederum maßgeblich beeinflusst von Überschuss oder Knappheit des Faktors Arbeit im Allgemeinen, und bestimmter Qualifikationen im Besonderen. Die Entwicklung auf den üblicherweise national organisierten Arbeitsmärkten kann dabei gerade im Zeitalter der Globalisierung von Entwicklungen im Ausland beeinflusst werden.
Fragen der Einkommensverteilung wurden bis zum Ausbruch der Krise von Politik und Medien nur selten diskutiert, haben aber seither an Aktualität gewonnen. So hebt Anfang 2017 selbst das Weltwirtschaftsforum die "wachsende Ungleichheit bei Einkommen und Vermögen" sowie die zunehmende "Polarisierung der Gesellschaften" als Gefahren für die politische Stabilität und den sozialen Zusammenhalt hervor. [38] Allerdings ist die Ungleichheit von heute nichts anderes als das Ergebnis wirtschaftlicher Prozesse und politischer Entscheidungen der Vergangenheit. In diesem Sinn ist Politik stets von Fragen der Verteilung betroffen und letztlich auch beeinflusst, da jede wirtschaftspolitische Maßnahme die Einkommensverteilung beeinflusst und folglich danach bewertet werden kann, wer von ihr profitiert und wer verliert. Aus diesem Grund werden Maßnahmen von Interessensgruppen begrüßt oder abgelehnt, abhängig davon, welche erwarteten Folgen diese haben werden. In Österreich sind es insbesondere die Wirtschaftskammer Österreich und der Österreichische Gewerkschaftsbund, die über die Kollektivvertragsverhandlungen die Einkommensverteilung beeinflussen.
Lohnpolitik
Wie gezeigt wurde, erlaubt die neoklassische Modellierung Rückschlüsse auf die Verteilung des Gesamteinkommens auf die Produktionsfaktoren: Die Entlohnung des Faktors Arbeit entspricht der Grenzproduktivität, oder tendiert zu dieser. Gleichzeitig muss der Lohn zumindest dem Reservationslohn ansprechen, d.h. die Entschädigung muss mindestens dem Lohnsatz entsprechen, zu dem der Beschäftigte gerade indifferent ist zwischen den Alternativen Arbeitslosigkeit und Beschäftigung (d.h. das aus der Arbeit resultierende Arbeitsleid muss zumindest ausgeglichen werden). Auf diese Weise können ökonomische Phänomene und Verhältnisse erklärt werden, ohne das Konzept der Macht einbringen zu müssen; vielmehr wird das Prinzip der Gleichsetzung der Grenzwerte zur Basis für eine allgemeine Wert- und Verteilungstheorie. Entspricht der Lohn dem Grenzprodukt, so realisiert das Unternehmen sein Gewinnmaximum.
Es ist allerdings offenkundig, dass die Annahme vollkommenen Wettbewerbs auf Arbeitsmärkten nicht erfüllt ist, bzw. aus verschiedenen Gründen gar nicht erfüllt sein kann. Die Lohnbildung unterscheidet sich daher von der Preisbildung auf anderen Märkten beträchtlich, und in der Realität werden Löhne auf vielfältige Weise festgesetzt. Charakteristisch ist, dass neue Arbeitsverträge zu dem Lohn abgeschlossen werden, der von den bisherigen Kontraktpartnern vereinbart wurde: Nicht diejenigen, die einen neuen Arbeitsvertrag suchen (Anbieter und Nachfrager) bilden den Lohn, sondern diejenigen, die schon seit Längerem miteinander einen Vertrag haben.
Löhne werden in den fortgeschrittenen Ökonomien häufig in kollektiven Verhandlungen ausgehandelt: Vertreter von Arbeitnehmern und Arbeitgebern vereinbaren einen Lohn, der für alle vertretenen Unternehmen und Beschäftigten maßgeblich ist. Solche Verhandlungen können grundsätzlich auf Unternehmensebene, auf Branchenebene, auf regionaler Ebene oder auf nationaler Ebene stattfinden; sie haben in unterschiedlichen Ländern zwar unterschiedliche Relevanz und betreffen in einigen Ländern (Österreich, Deutschland) mehr, in anderen (USA) weniger Arbeitnehmer. Für alle Länder gilt aber, dass mit dem Anforderungsprofil der Arbeitsplätze auch die Wahrscheinlichkeit steigt, dass direkte Verhandlungen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer stattfinden, d.h. je spezieller die Qualifikation eines einzelnen Arbeitnehmers, umso weniger ist ein existierender Kollektivvertrag für die tatsächlichen Arbeitsbedingungen einschließlich der Lohnhöhe relevant.
Die Art und Weise, wie Löhne bestimmt werden, kann sich insgesamt erheblich unterscheiden sowohl über unterschiedliche Epochen, unterschiedliche Qualifikationsniveaus und unterschiedliche Länder. Zwei verallgemeinernde Beobachtungen lassen sich jedoch feststellen:
- Im Normalfall erhalten Beschäftigte einen Lohn, der über ihrem Reservationslohn liegt. Dieser Reservationslohn wiederum entsteht aus Abwägungen des (potenziellen) Arbeitsnehmers, der überlegt, ob der zusätzliche Konsum an Gütern, den er sich durch die Annahme einer Beschäftigung leisten könnte, den Verlust an Freizeit ausgleicht. Daraus folgt, dass der Reservationslohn umso höher sein wird, je mehr Konsumgüter sich der Arbeitnehmer auch ohne Beschäftigungsverhältnis leisten kann: Eine mögliche alternative Einnahmequelle (privates Vermögen bzw. Arbeitslosen- oder andere Unterstützung) oder wird daher die Entscheidungsfindung beeinflussen.
- Die individuelle Lohnhöhe hängt von der Lage am Arbeitsmarkt ab – je niedriger die Arbeitslosenquote, umso höher die Löhne. Mit sinkender Arbeitslosigkeit steigt die Knappheit des Faktors Arbeit und sein Preis erhöht sich: Wenn die Arbeitslosenquote niedrig ist, ist es leicht, einen alternativen Arbeitsplatz zu finden. Das bedeutet, dass Unternehmen einen höheren Lohn zahlen müssen, um ihre Beschäftigten zu halten. Auch die Verhandlungsmacht der Gewerkschaften ist daher abhängig vom aktuellen Ausmaß der Arbeitslosigkeit.
Über wie viel Verhandlungsmacht ein Arbeitnehmer tatsächlich verfügt, ist vom Anforderungsprofil des Arbeitsplatzes abhängig: Je höher die erforderliche Qualifikation und je spezialisierter der Arbeitsplatz ist, umso schwieriger ist der Arbeitnehmer zu ersetzen und umso höher wird der Lohn sein, der ausgehandelt wird. Die Lage am Arbeitsmarkt wird die Verhandlungsmacht ebenfalls beeinflussen, als bei hoher Arbeitslosigkeit es generell für Unternehmen einfacher ist, einen Ersatz zu finden. Diese Einflüsse behalten sowohl bei individueller wie bei kollektiver Verhandlung ihre Gültigkeit.
In der Praxis bedeutet das, dass der individuelle Verhandlungsspielraum sowohl von Seiten des Arbeitgebers wie des Arbeitnehmers eingeschränkt ist. Der Lohnsatz ist durch einen Kollektivvertrag und eventuell eine Betriebsvereinbarung vorgegeben, in deren Verhandlungen sie nicht einbezogen sind. In Österreich werden die Arbeitnehmer in den Kollektivvertragsverhandlungen den Gewerkschaften vertreten, die Arbeitgeber werden von der Wirtschaftskammer vertreten. Alle Unternehmen sind Mitglied der Wirtschaftskammer (Pflichtmitgliedschaft), der Österreichische Gewerkschaftsbund hat rund 1,2 Millionen Mitglieder (freiwillige Mitgliedschaft). [39]
Lohnverhandlungen finden im Allgemeinen jährlich statt (Lohnrunden), wobei der Metallbranche eine spezifische Rolle zukommt, als deren Lohnerhöhung meist von den anderen Gewerkschaften als Richtgröße herangezogen wird. In den Lohnverhandlungen werden zwei Löhne festgelegt:
- Die Kollektivvertragslöhne: Sie bilden die untere Grenze der Lohnsätze. Es gibt in Österreich zwar keinen gesetzlichen Mindestlohn, doch sind die ausgehandelten Kollektivverträge zwingend für alle Unternehmen und Arbeitnehmer (einschließlich jener, die nicht Mitglied einer Gewerkschaft sind). Die Kollektivvertragslöhne sind ökonomisch insofern als Mindestlöhne interpretierbar, als auch unter Zustimmung des Arbeitnehmers kein niedrigerer Lohn als der im Kollektivvertrag vorgesehene bezahlt werden darf.
- Die Erhöhung der Löhne, die über dem Kollektivvertrag liegen („Ist-Löhne“): Durch ihre Beeinflussung können die Gewerkschaften in Österreich auch die tatsächliche Lohnhöhe (nicht nur die Mindestlöhne) beeinflussen.
Durch die Lohnverhandlungen können nur die Nominallöhne vereinbart werden, obwohl sowohl für Arbeitgeber wie Arbeitnehmer der Reallohn die entscheidende Größe ist. Die Entwicklung der diese bestimmenden Güterpreise kann naturgemäß nicht vorhergesehen werden, allerdings spielen die Erwartungen darüber eine große Rolle. Das führt u.a. zum Effekt, dass eine erwartete höhere Inflation aufgrund der dadurch induzierten höheren Nominallohnforderungen zu einer tatsächlichen Inflation führen wird. [40]
Die Komplexität des Arbeitsmarktes führt dazu, dass ein theoretisch sinnvoller und nachvollziehbarer Gleichgewichtslohn in der Realität schwierig zu bestimmen ist. Die Rolle der Gewerkschaften ist ökonomisch nicht darauf beschränkt, analog zur Kartellbildung auf Gütermärkten für den Faktor Arbeit einen höheren Preis zu erzielen, als dies bei individuellen Lohnverhandlungen der einzelnen Arbeitnehmer möglich wäre, sondern stellt auch eine wesentliche Erleichterung für alle Akteure auf dem Arbeitsmarkt dar: Ohne Kollektivertragsverhandlungen wäre es notwendig, dass das Management eines jeden Unternehmens individuell gestaltete Verträge mit seinen Beschäftigten schließt. Für beide Seiten würden sich die Informationskosten erhöhen, allerdings wären die Nachteile für den Arbeitnehmer wesentlich größer als für den Arbeitgeber: Während das Management relativ häufig Arbeitsverträge abschließt und über die Vertragsbedingungen anderer Arbeitnehmer gut informiert ist, kommt ein einzelner Arbeitnehmer nur selten in die Situation, einen neuen Arbeitsvertrag abzuschließen. Die Folge ist eine Informationsasymmetrie, bei der der Arbeitnehmer deutlich benachteiligt ist.
Durch die kollektiven Verhandlungen werden beide Seiten mit wichtigen Informationen versorgt, darüber hinaus wird das Machtverhältnis zu Gunsten des Arbeitnehmers korrigiert.
In bereits bestehenden Arbeitsverhältnissen verfügt hingegen häufig der Arbeitnehmer über einen Informationsvorsprung, während der Arbeitgeber nur unvollständig über die Qualität seiner Mitarbeiter informiert ist. Arbeitskräfte müssen motiviert werden, gut zu arbeiten, weshalb von Seiten des Arbeitgebers ein gewisses Maß an Zufriedenheit der Arbeitnehmer angestrebt wird. Kernstück der Effizienzlohntheorie ist, dass hohe Löhne die Effizienz im Sinne des Arbeitseinsatzes der Belegschaft steigern, was die Arbeitsproduktivität erhöht. Je höher der Lohn, umso unangenehmer wird ein Arbeitsplatzverlust sein, und desto größer das Bemühen, durch gute Arbeit den Arbeitsplatz zu behalten. [41]
Ein weiterer Grund für den Arbeitgeber, höhere Löhne zu bezahlen, ist die Abhängigkeit der Arbeitsleistung von der Tätigkeit in einem Betrieb, da viele Kenntnisse erst im Unternehmen selbst erworben bzw. verbessert werden. Daher werden Unternehmen längerfristige Arbeitsverhältnisse vorziehen, wenn damit der Erwerb von spezifischen Kenntnissen verbunden ist, die die Produktivität erhöhen: Nur dann ist eine betriebsinterne Ausbildung der Arbeitskräfte rentabel, und nur dann werden die Arbeitskräfte bereit sein, für den Betrieb spezifisches Wissen zu erwerben. Von diesen Gedanken ausgehend versuchen Insider-Outsider-Modelle zu erklären, warum Arbeitslose auch dann nicht eingestellt werden, wenn sie bereit sind, zu einem niedrigeren Lohnsatz als dem im Betrieb herrschenden zu arbeiten: Die Produktivität der Insider ist ausreichend hoch, um die Lohndifferenz zu den Outsidern zu rechtfertigen.
Lohntheorie
Die Lohnbildung auf den Arbeitsmärkten hat naturgemäß Einfluss auf die Einkommensverteilung sowohl zwischen Kapital und Arbeit, sowie innerhalb der beiden Faktoren. Der technologische Fortschritt und das dadurch bedingte Wirtschaftswachstum führen zu einem stetigen Anstieg des gesamten Wohlstands; wie in Kapitel 1 gezeigt wurde, lässt sich dieser steigende Wohlstand wiederum auf eine steigende Produktivität des Faktors Arbeit reduzieren. Jedoch ist es in der Praxis erstens schwierig bis unmöglich, den exakten Wert einer Arbeitseinheit zu ermitteln, und wird zweitens der Preis des Faktors Arbeit von weiteren Einflussfaktoren wie bspw. Verhandlungsmacht bestimmt.
In einer Ökonomie, die durch Produktivitätssteigerungen gekennzeichnet ist, gibt es grundsätzlich drei Möglichkeiten der relativen Lohnentwicklung:
Der Lohnsatz steigt in gleicher Höhe wie die Produktivität: In diesem Fall steigt auch der Gewinn in der gleichen Höhe und die Verteilung zwischen Kapital und Arbeit ändert sich nicht.
Die Lohnsteigerung ist höher als die Produktivitätssteigerung: Die Verteilung verändert sich zugunsten der Anbieter des Faktors Arbeit.
Die Lohnsteigerung ist geringer als die Produktivitätssteigerung: Die Verteilung verändert sich zugunsten der Eigentümer des Faktors Kapital.
Aufgrund der Inflation muss hier sowohl bei den Löhnen wie bei der Produktivität zusätzlich das Preisniveau berücksichtigt werden. Steigt demnach der reale Lohnsatz im selben Ausmaß wie die Produktivität, so muss der nominelle Lohnsatz um die gleiche Höhe wie die Produktivität plus der Inflation steigen. Eine mögliche Folge bei stetiger Produktivitätssteigerung ist daher, dass zwar die Reallöhne steigen, und sich zugleich die Verteilung des Volkseinkommens zum Nachteil des Faktors Arbeit verschiebt. Da die Inflation der Zukunft nicht bekannt ist, wird bei Lohnverhandlungen von Erwartungen ausgegangen – ein tatsächlicher Verteilungseffekt der Kollektivvertragsverhandlungen kann folglich erst im Nachhinein festgestellt werden.
Wie bereits gezeigt wurde, sind die Kollektivvertragsverhandlungen ihrerseits von den Markt- und den daraus resultierenden Machtverhältnissen beeinflusst: Höhere Arbeitslosigkeit oder auch nur die Angst vor ihr schwächen die Verhandlungsmacht der Arbeitnehmer und ihrer Vertreter und beeinflussen auf diese Weise die Verteilung zu Gunsten des Kapitals. Die Diskussion, ob technologischer Fortschritt zu Arbeitslosigkeit führen kann oder nicht, wird seit den Anfängen der Industrialisierung geführt und hat im Zuge des Aufkommens der als „Industrie 4.0“ bezeichneten Vernetzung von Fabriken wieder aufgeflammt. Zwar hat die Empirie bislang eindeutig widerlegt, wonach schnellerer technologischer Fortschritt langfristig zu Arbeitslosigkeit führt. Relativ unbestritten ist jedoch, dass es kurzfristig zu Arbeitslosigkeit kommen kann, da sowohl Prozess- wie Produktinnovationen unterschiedliche Gruppen betreffen. Wenn es durch die rasche Veränderung der Produktionsstruktur zu einer Diskrepanz in der Qualifikation bzw. in der regionalen Verfügbarkeit zwischen Arbeitskräfteangebot und Arbeitskräftenachfrage kommt, entsteht strukturelle Arbeitslosigkeit. Eine Rückwirkung auf die Lohnverhandlungen ist insbesondere in den von struktureller Arbeitslosigkeit betroffenen Branchen möglich.
Mit der zunehmenden Globalisierung der Weltwirtschaft eng verknüpft sind Verteilungsfragen auf mehreren Ebenen: Einerseits zwischen Regionen und Ländern, andererseits innerhalb dieser. Auch wenn mitunter umstritten ist, welche der jüngeren Phänomene den Begriff Globalisierung definieren, so herrscht doch Einigkeit darüber, dass die Liberalisierung der Kapitalmärkte und der grenzüberschreitenden Investitionsmöglichkeiten wesentliche Merkmale darstellen Im Gegensatz zum technologischen Fortschritt handelt es sich bei Änderungen im Regelwerk jedoch nicht um ein evolutionäres Phänomen, sondern um beabsichtigte (multilaterale) Vereinbarungen zur Organisation (nationaler) ökonomischer Rahmenbedingungen. Eine Folge der Politik der Liberalisierung der Finanzströme ist eine erhöhte Freiheit des Produktionsfaktors Kapital, dort investiert zu werden, wo der erwartete Gewinn am höchsten ist. Daraus ergeben sich zwei mögliche Folgen für die Einkommensverteilung innerhalb der Volkswirtschaften:
- Durch die Internationalisierung des Kapitals hat sich die Verhandlungsposition der Arbeitnehmer verschlechtert. Erstens ist der Faktor Arbeit aus ökonomischen, technischen, soziologischen und kulturellen Gründen auch dann weniger mobil, wenn ihm rechtlich die gleiche Migrationsfreiheit offen steht wie dem Faktor Kapital. Zweitens sind Gewerkschaften nach wie vor in der Regel national organisiert, und ihr Handlungsspielraum folglich im Gegensatz zu den Vertretern der Arbeitnehmerseite erheblich eingeschränkt. Aus beiden Gründen ergibt sich im Zuge der Globalisierung das Drohpotenzial der Abwanderung, das die Arbeitgeber dem Drohpotenzial der Arbeitnehmer, dem Streik, in Konfliktsituationen entgegensetzen können.
- Aus der Möglichkeit der Wanderung ergibt sich zusätzlich ein Druck auf das Steuersystem. Auch hier führt die höhere Mobilität des Faktors Kapital dazu, dass dieser besser in der Lage ist, die Steuerlast auf den Faktor Arbeit abzuwälzen als umgekehrt. Allerdings ist der Faktor Arbeit seinerseits beim Wanderungspotenzial relativ heterogen, als manche Gruppen eine höhere Migrationsneigung aufweisen als andere und folglich das Steueraufkommen innerhalb der Faktoren beeinflussen können. Für beide Fälle gilt, dass es sich hier um Fragen der Einkommensverteilung handelt, die die am Markt zustande gekommene Einkommensverteilung korrigieren soll (die sog. Sekundärverteilung, vgl. Kapitel 2.3.2).
Mittlerweile ist relativ unumstritten, dass die beiden in Möglichkeitsform angegebenen Folgen für die Einkommensverteilung im Zuge der Globalisierung tatsächlich eingetreten sind. In vielen fortgeschrittenen Industriestaaten fallen die Lohnsteigerungen seit den 1980er-Jahren in den meisten Jahren geringer aus als die Produktivitätssteigerung. Langfristig führt eine solche Entwicklung zwangsläufig zu einer Umverteilung vom Faktor Arbeit zum Faktor Kapital. In manchen Ökonomien, darunter den USA, ist dieser Effekt so stark, dass – trotz fortlaufenden Wirtschaftswachstums – für viele Arbeitnehmergruppen selbst die Reallöhne an sich stagnieren oder sogar fallen. [42] Gleichzeitig wird es immer schwieriger, diesen Prozess über die Steuern zu korrigieren, da global agierende Unternehmen verschiedene
Steuersysteme ausnützen können, um insgesamt kaum Steuern zu zahlen.
Diese Möglichkeiten bestehen selbst innerhalb der EU, was 2016 schließlich zum offenen Konflikt zwischen Mitgliedstaaten geführt hat, die entsprechende Steuerfluchtmöglichkeiten bieten (darunter die Republik Irland und Luxemburg), und solche, die sich um die entsprechenden Einnahmen übervorteilt sehen.
Von der Verteilung zwischen den Produktionsfaktoren grundsätzlich zu unterscheiden ist die Verteilung innerhalb der Produktionsfaktoren. Die Verteilung innerhalb der Einkommen aus Arbeit wird Lohnspreizung genannt; sie resultiert im Wesentlichen aus der Heterogenität des Faktors Arbeit und den daraus resultierenden Unterschieden hinsichtlich der Produktivität. Da sich die Anforderungen an den Faktor Arbeit im Zeitverlauf ändern, ist davon auszugehen, dass sich auch das Ausmaß der Lohnspreizung ändern kann. Relativ hohe Lohnsätze für bestimmte Gruppen von Arbeitnehmern spiegeln in der Regel Knappheitsrenten wider, umgekehrt zeigen relativ niedrige Lohnsätze ein Überschussangebot an. [43] Die Lohnspreizung wird erheblich von der technologischen Entwicklung beeinflusst, als bestimmte Fähigkeiten mehr, und andere weniger nachgefragt werden, was das Angebots- und Nachfrageverhältnis beeinflussen wird. Auch die internationale Verflechtung einer Ökonomie (mit der Globalisierung als einer Ausprägung) kann die Lohnspreizung beeinflussen, als sich das Arbeitsangebot in seiner Struktur verändert. Schließlich können auch gesellschaftliche Entwicklungen wie Veränderungen der Erwerbstätigkeit bestimmter Gruppen (z.B. Frauen) die Lohnspreizung beeinflussen.
Empirische Konzepte
Um zu geeigneten Aussagen zu Fragen der Beschäftigung, der Arbeitslosigkeit und der Einkommensverteilung zu kommen, ist es jeweils nötig, über ein geeignetes Messkonzept zu verfügen, da die Begriffe unterschiedlich definiert werden können, worauf insbesondere bei internationalen Vergleichen zu achten ist. Innerhalb der Europäischen Union sind alle Mitgliedstaaten verpflichtet, Daten zur wirtschaftlichen Lage gemäß dem ESVG zu veröffentlichen. Dies ermöglicht sowohl bei Arbeitsmarktdaten wie bei der Einkommensverteilung bis zu einem gewissen Grad eine europaweite Vergleichbarkeit amtlicher Daten. Allerdings werden bei weitem nicht alle Konzepte über das ESVG erfasst, wobei sich die Datenlage insbesondere bei der Einkommensverteilung in Österreich seit Einführung teilweise sogar verschlechtert hat.
Arbeitskräfteerhebung
Innerhalb der EU und weiteren Ländern, darunter den EFTA-Mitgliedstaaten, werden die Daten zur Lage auf den Arbeitsmärkten regelmäßig im Rahmen der Arbeitskräfteerhebung (Labour Force Survey, LFS) erhoben. Methodisch handelt es sich um eine Stichproben-Haushaltsbefragung, die in Österreich im Rahmen des Mikrozensus durchgeführt wird: Pro Quartal werden 22.500 zufällig ausgewählte Haushalte in Österreich befragt. Zur Vergleichbarkeit zwischen Ländern und Regionen bzw. über die Zeit sind folgende Größen etabliert und werden in Europa von allen Mitgliedstaaten erhoben:
Erwerbspersonen (= Arbeitskräfte) entsprechen dem Arbeitsangebot in der ökonomischen Theorie und umfassen den Teil der arbeitsfähigen Bevölkerung, der im Produktionsprozess eingesetzt werden kann: Erwerbstätige und Erwerbslose.
Erwerbstätige sind Personen (in Österreich: Personen ab 15 Jahren), die eine Produktionstätigkeit ausüben: Selbständige, Mithelfende und Arbeitnehmer (oder gleichlautend: Erwerbspersonen minus Erwerbslose). Sie zählen auch dann zu den Erwerbstätigen, wenn sie während der Referenzwoche nur eine Stunde gegen Entgelt gearbeitet haben.
Arbeitnehmer (= Beschäftigte) sind Personen, die auf vertraglicher Basis abhängig arbeiten und dafür eine Vergütung erhalten;
Selbständige sind alleinige oder gemeinsame Eigentümer eines Unternehmens, in dem sie arbeiten;
Mithelfende sind Personen, die im Familien-Betrieb arbeiten.
Erwerbslose (= Arbeitslose) sind jene Erwerbspersonen, auf die sämtliche der drei folgenden Kriterien während der Berichtswoche zutreffen:
Sie zählen nicht zu den Erwerbstätigen laut obiger Definition,
sie stehen innerhalb der nächsten zwei Wochen für eine Arbeitsaufnahme zur Verfügung, und
sie haben innerhalb der letzten vier Wochen aktiv Arbeit gesucht.
Nichterwerbspersonen sind diejenigen, die weder zu den Erwerbstätigen noch zu den Erwerbslosen zählen, darunter insbesondere
- Pensionisten,
Kinder bis 15 Jahre,
Personen ab 15 Jahren, die sich in Ausbildung befinden,
ausschließlich im Haushalt Tätige,
Arbeitsunfähige,
karenzierte Personen,
nicht erfasste Arbeitslose.
Man beachte, dass nach dieser Definition drei wichtige Personengruppen zu den Nichterwerbspersonen gezählt werden, die sich selbst womöglich als arbeitslos einstufen:
- Unterbeschäftigte, da als erwerbstätig gilt, wer in der Referenzwoche zumindest eine Stunde gearbeitet hat;
- in irgendeiner Form von Ausbildung Befindliche;
- resignierte Arbeitslose, wobei es sich um Personen handelt, die arbeiten möchten, aber die aktive Suche aufgegeben haben; da nur als in der Arbeitskräfteerhebung nur als arbeitslos gilt, wer der letzten vier Wochen aktiv Arbeit gesucht hat, werden resignierte Arbeitslose in der Statistik nicht als arbeitslos erfasst.
Präsenz- und Zivildiener werden gar nicht berücksichtigt und rechnerisch von der Bevölkerung abgezogen. Weitere Begriffe, die verschiedene der oben genannten Gruppen umfassen, aber nicht Teil der amtlichen Statistik sind, sind:
- Versteckte Arbeitslosigkeit: Hierunter fallen alle erwerbsfähige, Arbeit suchende Personen, die in der Statistik nicht aufscheinen, da sie nach den oben genannten Kriterien nicht als arbeitslos klassifiziert werden (insbes. resignierte Arbeitslose oder Unterbeschäftigte, ebenso in Ausbildung befindliche, aber aktive Arbeit suchende Personen).
- Verdeckte Arbeitslosigkeit: Damit sind Arbeitnehmer gemeint, die vom Arbeitsgeber nicht (mehr) benötigt werden, aber aus bestimmten Gründen nicht gekündigt werden.
- Stille Reserve: Dieser Begriff umfasst Personen, die prinzipiell bereit wären, eine Arbeit aufzunehmen, aber gegenwärtig nicht aktiv suchen. Zu dieser Gruppe zählen einerseits resignierte Arbeitslose, aber auch arbeitsfähige Personen, die sich temporär vom Arbeitsmarkt zurückgezogen haben (z.B. Hausfrauen und -männer).
Aus diesen Größen lassen sich berechnen:
- Die Erwerbsquote, die den prozentualen Anteil der Arbeitskräfte an der arbeitsfähigen Bevölkerung (EU: 15 bis 64 Jahre) darstellt:
Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle Erwerbsquote = Arbeitskraefte/arbeitsfaehige Bevoelkerung } (2.6)
- Die Arbeitslosenquote, die als Zahl der Arbeitslosen in Prozent der Erwerbspersonen definiert ist:
Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle Arbeitslosenquote = Arbeitslose/Erwerbspersonen }
(2.7)
Neben den oben beschriebenen Definitionen nach dem ESVG (auch als „EU-Methode“, „EU-Berechnung“ oder „internationale Methode“ bezeichnet) wird in Österreich die Arbeitslosenquote regelmäßig auch basierend auf den beim Arbeitsmarktservice (AMS) gemeldeten Arbeitslosen (im Zähler) und den beim Hauptverband der Sozialversicherungsträger erfassten unselbständig Beschäftigten (im Nenner) veröffentlicht (auch: „österreichische Berechnung“ oder „nationale Methode“). Dabei handelt es sich methodisch um eine Vollerhebung, d.h. abgesehen von Erfassungs- und Übertragungsfehlern ist die Arbeitslosenquote im Gegensatz zur Arbeitskräfteerhebung eine exakte Zahl ohne statistische Schwankungsbreite.
Welche Methode zu bevorzugen ist, indem sie die ökonomische und gesellschaftliche Realität besser widerspiegelt, kann nicht eindeutig beantwortet werden. Einerseits ist Arbeitslosigkeit nach der EU-Methode so eng gefasst, dass die entsprechende Arbeitslosenquote niedriger ausfällt, als sie der ökonomischen Definition „unfreiwilliger Arbeitslosigkeit“ entspricht. Andererseits stellt sich bei der österreichischen Methode die Frage, ob die Anzahl der registrierten Arbeitslosen tatsächlich die ökonomisch interessierende Größe ist. Zwar fällt die gemessene Arbeitslosenquote nach der österreichischen Methode höher aus, allerdings erfasst diese auch viele „freiwillige Arbeitslose“, bspw. Saisonarbeiter oder in Ausbildung Befindliche. Andere Gruppen werden nach der österreichischen Methode nicht, wohl aber nach der EU-Methode erfasst, bspw. Personen, die gerade in das Erwerbsleben eingetreten sind (etwa nach Beendigung eines Studiums) und keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld haben, weshalb sie sich nicht als arbeitslos registrieren lassen (vgl. auch Kap. 2.4.1). [44]
Einkommensverteilung
Grundsätzlich zu unterscheiden sind die primäre Einkommensverteilung, welche jene Einkommensverteilung meint, die auf den Märkten entsteht; und die sekundäre Einkommensverteilung, die nach der Umverteilung durch den Staat entsteht. Es ist allerdings davon auszugehen, dass zwischen den beiden Einkommensverteilungen eine Wechselwirkung besteht, d.h. dass Umverteilungsmaßnahmen ihrerseits die primäre Einkommensverteilung beeinflussen. Die beiden Konzepte lassen sich daher empirisch strikt voneinander abgrenzen, aber sie sind theoretisch nicht voneinander unabhängig.
Es werden weiter unterschieden die
- funktionelle Einkommensverteilung, welche die Verteilung des produzierten Einkommens auf die Produktionsfaktoren bezeichnet, und die
- personelle Einkommensverteilung, welche die Verteilung des produzierten Einkommens auf einzelne Personen oder Haushalte bezeichnet.
Einen besonderen Stellenwert bei der Einkommensverteilung betrifft die Aufteilung auf die Faktoren Arbeit und Kapital. Auch hier gibt es jedoch verschiede Konzepte, die von der VGR berücksichtigt werden und gemäß ESVG zu unterscheiden sind:
- Das Arbeitnehmerentgelt (= Einkommen der unselbständig Erwerbstätigen) bezeichnet die Summe aller Geld- und Sachleistungen von Arbeitgebern an Arbeitnehmer inklusive der Sozialbeiträge der Arbeitgeber („Lohnnebenkosten“)
- Die Bruttolöhne und -gehälter entsprechen dem Arbeitnehmerentgelt abzüglich der Sozialbeiträge der Arbeitgeber.
- Die Nettolöhne und -gehälter entsprechen den Bruttolöhnen und -gehältern abzüglich der Sozialbeiträge der Arbeitnehmer und der Lohnsteuern.
- Produktionsabgaben sind Steuern, die von Unternehmen unabhängig von der Menge der produzierten oder verkauften Güter zu entrichten sind (z.B. Kommunalsteuer, Arbeitgeberbeiträge zum Familienlastenausgleichsfonds)
- Bruttobetriebsüberschuss und Selbständigeneinkommen (= Einkommen aus Besitz und Unternehmung) entsprechen den Produktionswerten abzüglich der Vorleistungen, des Arbeitsnehmerentgelts, aller Produktions- und Importabgaben zuzüglich aller Subventionen.
Abb. 2.1: Schematischer Überblick der Verteilungsrechnung in der VGR und die entsprechenden Daten für Österreich 2015; Quelle: Statistik Austria, eigene Darstellung
In Abb. 2.1 werden diese Konzepte der VGR zur Erfassung der Verteilungsrechnung übersichtlich dargestellt, zusammen mit den entsprechenden Zahlen für Österreich 2015. Aus dieser Darstellung lässt sich in Verbindung mit Tab. 1.1 die Lohnquote als Maß für den Anteil der unselbständig Beschäftigten am Volkseinkommen berechnen: Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle Lohnquote = Arbeitnehmerentgelt/Volkseinkommen } (2.8)
Die Lohnquote stellt das bei weitem wichtigste Maß der Einkommensverteilung dar, was auch damit zusammenhängt, dass sie die einzige Größe ist, die aus dem amtlichen Datenmaterial berechnet werden kann. Bei der Interpretation ist jedoch zu beachten, dass das Arbeitnehmerentgelt der VGR nur teilweise dem Term Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle w_t L_t} in Gleichung (1.8) entspricht. Demnach kann die Lohnquote nicht einfach mit der Entlohnung des Faktors Arbeit gleichgesetzt werden, da unter der Position „Bruttobetriebsüberschuss und Selbständigeneinkommen“ auch alle Einkommen Selbständiger erfasst sind (und nicht nur Kapitaleinkünfte im engeren Sinn): Ökonomisch gesehen entspricht der tatsächliche Arbeitseinsatz eines Selbständigen (Bauern, Ärzte, Gastwirte usw.) dem Faktor Arbeit.
Ein Problem, das sich daraus ergibt, ist die Interpretation der Lohnquote im Zeitverlauf: Infolge des Strukturwandels ändert sich das Verhältnis der unselbständig Erwerbstätigen zu den selbständig Erwerbstätigen, insbesondere ist durch den Rückgang der Zahl der Bauern sowie der Gewerbstreibenden die Zahl der Selbständigen in Österreich lange Zeit stetig zurückgegangen, eine um diesen Einfluss unbereinigte Lohnquote wird hier zwangsläufig steigen. Aus diesem Grund wird bei Betrachtungen über die Zeit die bereinigte Lohnquote ausgewiesen: Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle bereinigte Lohnquote\; in\; t_1 = unbereinigte Lohnquote\; in\; t_1 \cdot \frac{((Arbeitnehmer\; in\; t_0)/(Erwerbstaetige\; in\; t_0 ))}{((Arbeitnehmer\; in \; t_1)/(Erwerbstaetige\; in\; t_1))} } (2.9)
wobei Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle t_0} und Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle t_1} jeweils zwei Perioden des Beobachtungszeitraums bezeichnen: Die bereinigte Lohnquote gibt also die Lohnquote in der Periode Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle t_1} an, die eingetreten wäre, wenn der Anteil der Arbeitnehmer an allen Erwerbstätigen im Vergleich zu Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle t_0} konstant gebelieben wäre. Bei internationalen Vergleichen der Lohnquote ergibt sich als zusätzliches Problem, dass verschiedene Länder unterschiedliche Wirtschaftsstrukturen aufweisen. Aber auch eine unterschiedliche Organisation der Wirtschaft wird die Lohnquote beeinflussen – nämlich dann, wenn vergleichbare Tätigkeiten in einer Ökonomie von rechtlich Selbständigen, in anderen von Unselbständigen ausgeführt werden (Landwirtschaft, Einzelhandel, Gesundheitswesen, Justizwesen etc.).
Da es keine amtliche Statistik zur personellen Einkommensverteilung gibt, empfiehlt es sich, die Lohnquote gemeinsam mit anderen Statistiken zu interpretieren. Die Aussagekraft der Lohnquote auf die personelle Einkommensverteilung ist zwar begrenzt, allerdings kann diese durch Hinzuziehen von Daten zur Verteilung innerhalb der beiden Produktionsfaktoren potenziell verbessert werden.
- Daten zur Verteilung des Arbeitnehmerentgelts (Lohnspreizung) sind in Österreich über die Lohnsteuerstatistik sowie der Einkommensstatistik des Hauptverbandes der Sozialversicherungsträger relativ gut erfasst.
- Die Einkommen aus Besitz und Unternehmung sind sehr heterogen und umfassen sowohl Gewinne von Kapitalgesellschaften und Gewerbebetrieben sowie Einkommen von Freiberuflern, Einkünfte aus Finanzvermögen sowie Mieten und Pachten, die Daten liegen jedoch nur als Gesamtgröße vor. [45] Dadurch ist es nicht möglich, aus dem amtlichen Datenmaterial Schlussfolgerungen über die Verteilung innerhalb dieser Kategorie zu ziehen.
Empirische Analysen zur personellen Einkommensverteilung werden noch weiter durch den Umstand erschwert, dass Teile der Einkommen aus Besitz und Unternehmung Personen zufallen, die auch Einkommen aus unselbständiger Beschäftigung erzielen, und umgekehrt.
Aus diesem Grund kann auch nicht sicher gesagt werden, wie sich die personelle Einkommensverteilung im Zeitverlauf entwickelt: Auf der einen Seite können Arbeitseinkommen nicht einfach mit niedrigen, und Gewinneinkommen mit hohen Einkommen gleichgesetzt werden. Auf der anderen Seite kann aus der Tatsache, dass Personen Einkommen aus Arbeit und Besitz beziehen, nicht auf eine Nivellierung der funktionellen Einkommensverteilung geschlossen werden.
Entwicklung in Österreich
Beschäftigung und Arbeitslosigkeit sind in Österreich seit den 1950er-Jahren gut dokumentiert, wobei die doppelte Erfassung sowohl nach österreichischer Methode wie nach EU-Methode auch jeweilige Schwächen der Methoden kontrollierbar macht. Das vorhandene Datenmaterial spiegelt daher erstens Entwicklungen innerhalb Österreichs wider und erlaubt zweitens einen internationalen Vergleich. Bei der Einkommensverteilung stehen die Lohnquote sowie die Lohnsteuerstatistik als langfristige Maßzahlen der Entwicklung zur Verfügung.
Beschäftigung und Arbeitslosigkeit
Tab. 2.1 zeigt die Entwicklung der Erwerbstätigkeit in Österreich seit 1951 nach nationalen Definitionen laut Volkszählungen. Hier fallen v.a. zwei Trends ins Auge:
- Erstens ist der Anteil der Unselbständigen an den Erwerbspersonen kontinuierlich gestiegen und erreicht seit den 1980er-Jahren knappe 90 Prozent. Dies ist v.a. auf die Rückgänge der Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe und der Zahl der kleinen Gewerbebetriebe zurückzuführen.
- Zweitens ist die Erwerbsquote gestiegen, was v.a. auf die Erwerbsbeteiligung von Frauen und Jugendlichen sowie den Saldo der Zu- und Abwanderung zurückzuführen ist:
- Während die Erwerbsquote der Männer im erwerbsfähigen Alter seit jeher sehr hoch liegt und abzüglich in Ausbildung Befindlicher annähernd hundert Prozent erreicht, hat sich die Erwerbsquote der der Frauen in den letzten Jahrzehnten kontinuierlich erhöht. Waren 1971 noch 38,4 Prozent aller Erwerbstätigen weiblich, so lag dieser Wert 2011 bei 46,9 Prozent. Insbesondere ist ihr Anteil unter den Arbeitnehmern kontinuierlich gestiegen, in der Untergruppe der Angestellten liegt er 2011 bereits bei 56,1 Prozent. Die Gründe hierfür sind im gestiegenen Bildungsniveau und in der gesunkenen Fertilität sowie dem Wandel im Rollenverständnis zu finden, als die (eigenständige) Teilnahme am Erwerbsleben heute für einen größeren Teil der Frauen üblich ist. [46]
| 1951 | 1961 | 1971 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erwerbspersonen (Tsd.) | 3.347 | 3.370 | 3.133 | 3.412 | 3.684 | 3.861 | 4.271 |
| Erwerbstätige* (Tsd.) | 3.270 | 3.307 | 3.088 | 3.312 | 3.469 | 3.599 | 4.021 |
| Arbeitslose, nat. Methode (Tsd.) | 77 | 63 | 45 | 99 | 216 | 261 | 250 |
| Selbständige (Tsd.) | 588 | 533 | 428 | 399 | 350 | 363 | 414 |
| Mithelfende (Tsd.) | 593 | 450 | 228 | 68 | 47 | 23 | 38 |
| Erwerbsquote** | 68,0% | 69,5% | 66,8% | 69,1% | 69,7% | 73,0% | 80,3% |
| Arbeitslosenquote, nat. Methode | 2,3% | 1,9% | 1,5% | 2,9% | 5,9% | 6,8% | 5,9% |
- exkl. geringfügig Beschäftigte, inkl. Präsenz-, Zivildienst und Elternkarenz
- (bezogen auf) 15-64jährige
Tab. 2.1: Erwerbssituation in Österreich seit 1951 laut Volkszählungen nach nationaler Definition; Quelle: berechnet nach Statistik Austria
- Die Nettozuwanderung (= Zuwanderung minus Abwanderung) ist in Österreich seit 1962 in fast jedem Jahr positiv. Dadurch hat sich das absolute Arbeitskräfteangebot erhöht. Die Erwerbsquote der Zuwanderer ist jedoch trotz der ursprünglichen Intention, das Arbeitsangebot zu erhöhen (Gastarbeiter) heute innerhalb mancher Immigrantengruppen tatsächlich niedriger als in der Gruppe der eingesessenen Bevölkerung.
Die Arbeitslosigkeit war bis in die 1970er-Jahre niedrig und ist zunächst infolge des Konjunktureinbruchs von 1980 bis 1983 angestiegen. Die Zahl der Arbeitslosen ging anschließend auch mit der Hochkonjunktur der späten 1980er-Jahre nicht wesentlich zurück und hat bis heute nicht wieder das Niveau der 1960er- und 1970er-Jahre erreicht. Im Gegenteil, sie ist während der 2010er-Jahre weiter gestiegen und erreichte 2016 das höchste Niveau seit Gründung der Zweiten Republik.
Abb. 2.2: Arbeitslosenquote in Prozent nach internationaler Methode im Jahresschnitt für vier Jahre für die EU (jeweils bezogen auf 28 Mitgliedstaaten) und ausgewählte Mitgliedstaaten; Quelle: Eurostat, eigene Darstellung
Wegen der damit verbundenen sozialen und politischen Probleme nimmt die Arbeitslosigkeit einen besonderen Stellenwert ein. Die in Kapitel 2.3.1 erläuterten unterschiedlichen Definitionen und Erhebungsmethoden der Arbeitslosigkeit verdeutlichen, dass die Höhe der Arbeitslosenquote keineswegs eindeutig ist. Ein alltägliches Beispiel eignet sich hier zur Veranschaulichung: Wer etwa sein Studium beendet hat und aktiv Arbeit sucht, wird zwar nach der internationalen, nicht aber nach der österreichischen Methode als arbeitslos erfasst. Ist die Person jedoch (eventuell noch im Studentenjob) geringfügig beschäftigt, wird sie von keiner der beiden Methoden erfasst, selbst wenn sich die Person in ihrem Selbstverständnis als arbeitslos bezeichnet. Ein anderes Beispiel: Wer eine Vollzeitbeschäftigung verliert, aber über eine Teilzeitbeschäftigung unter der Geringfügigkeitsgrenze verfügt, wird sich höchstwahrscheinlich arbeitslos melden und folglich nach der österreichischen Methode erfasst, nicht aber nach der internationalen. Ein drittes Beispiel: Wer hingegen seine Arbeit verliert und aus welchen Gründen auch immer momentan keine Aussicht auf eine Einstellung sieht, wird von der internationalen Methode nicht erfasst, und von der österreichischen allerdings so lange er oder sie
als arbeitslos gemeldet ist. Ein abschließendes Beispiel: Jene als arbeitslos Gemeldeten, die sich in Schulungen des AMS befinden, werden nach der internationalen Methode nicht gezählt.
Abb. 2.2 zeigt die offiziellen Arbeitslosenquoten nach der internationalen Methode in Österreich im Vergleich zu anderen EU-Staaten sowie der EU als Ganzes für 2000, 2005, 2010 und 2015. Sie liegt in der EU im Jahr 2015 bei 9,4 Prozent und damit erheblich über dem österreichischen Wert von 5,7 Prozent. Unter Berücksichtigung der engen Definition von Arbeitslosigkeit ist nach EU-Methode eine Quote in dieser Größenordnung als hoch einzustufen. Die hohe Arbeitslosigkeit prägt die soziale und wirtschaftliche Lage in fast allen Mitgliedstaaten, mit den entsprechenden Auswirkungen auf Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Das von der Politik in der Regel angestrebte Vollbeschäftigungsniveau wird nur in einigen wenigen Regionen erreicht. [47]
Einkommensverteilung
Verteilung zwischen Arbeit und Kapital
Die in Gleichung (2.8) definierte Lohnquote ist das einzige Maß der Einkommensverteilung, das direkt aus der VGR berechnet werden kann. In ihrem Kern spiegelt sie den Antagonismus zwischen Kapital und Arbeit wider, der bereits von Marx und Engels einprägsam beschrieben wurde. Tatsächlich ist es auch heute so, dass jedes erzielte Einkommen einem der beiden Faktoren Arbeit oder Kapital zugeordnet werden kann, entsprechend den Gleichungen (1.7) und (1.8). Die in Abb. 2.1 ausgewiesene Größe Bruttobetriebsüberschuss und Selbständigeneinkommen entspricht dabei den Einkommen des Faktors Kapital, das Arbeitnehmerentgelt den Einkommen des Faktors Arbeit. Allerdings werden Kapitaleinkommen statistisch systematisch nach oben verzerrt, da die Arbeit, die Selbständige und Mithelfende tatsächlich verrichten, unter „Bruttobetriebsüberschuss und Selbständigeneinkommen“ gemeinsam mit Kapitaleinkommen i.e.S. (d.h. Gewinnen) verbucht wird. Tatsächlich müsste man jedoch den Marktwert der Arbeit, den Selbständige und Mithelfende verrichten, von dieser Größe abziehen und zum Arbeitnehmerentgelt kommen, um zu einer Einkommensverteilung zu kommen, die Gleichungen (1.7) und (1.8) entspricht. Eine solche Berechnung wird in Österreich jedoch nicht vorgenommen.
Somit ist, wie in Kapitel 2.3.2 diskutiert, die Lohnquote zwar das wichtigste Maß der Einkommensverteilung, aber lediglich ein Indikator für die Frage nach arm und reich. Da es keine offiziellen Daten zur personellen Einkommensverteilung gibt, müssen verschiedene Statistiken entsprechend geschätzt und in Bezug zueinander gesetzt werden. Wofür die Lohnquote für sich jedoch gute Dienste leistet, ist die Interpretation der Entwicklung der Einkommensverteilung zwischen Arbeit und Kapital im Zeitverlauf.
Abb. 2.3: Bereinigte und unbereinigte Lohnquote in Österreich 1980-2015; Quelle: Statistik Austria, eigene Berechnungen und Darstellung
Der Verlauf der Lohnquote wird kurzfristig von der Konjunktur bestimmt: Die Lohnquote sinkt in hochkonjunkturellen Phasen und steigt in Krisenzeiten. Diese Beobachtung ist darauf zurückzuführen, dass die Gesamtsumme der Löhne und Gehälter viel weniger schwankt als die Gesamtsumme der Gewinne, was wiederum auf zwei Gründe zurückzuführen ist: Erstens sind die individuellen Löhne größtenteils fix und kaum vom Unternehmenserfolg abhängig, zweitens zögern Unternehmen in schlechten Zeiten Arbeiter zu entlassen, um entstehende Suchkosten in besseren Zeiten zu vermeiden. Diese beiden Phänomene können durch die Entstehungsweise von Lohn- und Gewinneinkommen erklärt werden: Arbeitsverträge werden üblicherweise für einen längeren Zeitraum abgeschlossen. Zwar gibt es einen bestimmten Spielraum bei der tatsächlichen Lohnhöhe (Kurzarbeit, Überstunden, Prämien, Gewinnbeteiligungen etc.), die Einkommen der Arbeitnehmer sind jedoch am Anfang jeder Periode durch die vertragliche Festlegung der Löhne und Gehälter weitgehend festgelegt. Die Einkommen der Unternehmen sind am Anfang jeder Periode hingegen weitgehend unsicher und deshalb insgesamt konjunkturabhängig.
In Abb. 2.3 ist der Verlauf der bereinigten und unbereinigten Lohnquoten in Österreich seit 1980 zu verfolgen. Die bereinigte Lohnquote ist dabei so definiert, dass sie zu Beginn der Beobachtungsperiode mit der unbereinigten Lohnquote übereinstimmt (d.h. Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle t_0} entspricht dem Jahr 1980). Die unbereinigte Lohnquote liegt durchwegs höher als die unbereinigte Lohnquote, was mit dem Rückgang der Selbständigen und Mithelfenden an den Erwerbstätigen erklärt werden kann. Allerdings hat sich diese Entwicklung seit den 1980er-Jahren stabilisiert, die Zunahme der Zahl der unselbständig Erwerbstätigen war in den Jahrzehnten davor viel stärker (vgl. Tab. 2.1); das Verhältnis unbereinigter versus bereinigter Lohnquote hat sich anschließend seit den 1990er-Jahren kaum noch verschoben. Die bereinigte Lohnquote zeigt im Beobachtungszeitraum von den frühen 1980er-Jahren bis in die frühen 1990er-Jahre eine bemerkenswerte Konstanz. Ab 1995 weist die bereinigte Lohnquote einen kontinuierlichen Rückgang auf und fällt bis zum Ausbruch der Krise um über halben Prozentpunkt jährlich. Mit dem Ausbruch der Krise steigt die Lohnquote und zeigt seither einen Aufwärtstrend. Dieses Bild ist kein Zufall, sondern wird von verschiedenen nationalen und internationalen Trends beeinflusst:
- In den frühen 1990er-Jahren hat sich Österreich gleich auf zweifache Weise mit anderen Ökonomien integriert, einerseits durch die voranschreitende Globalisierung, andererseits durch die Beitritte zum EWR 1993 und zur EU 1995. Durch den damit verbundenen Standortwettbewerb gerieten die Arbeitnehmer unter Druck, was ihre Verhandlungsmacht geschwächt hat und zu realen Lohnerhöhungen führte, die regelmäßig unter dem Zuwachs der Produktivität lagen (vgl. Kap. 2.2.2).
- Der Ausbruch der Krise führte zu einem temporären Rückgang der Gewinne, was den Anteil der Löhne am Volkseinkommen ansteigen ließ.
- Die 2010er-Jahre sind bislang von einem niedrigen Produktivitätszuwachs in Österreich gekennzeichnet, die Ursachen hierfür sind bislang unklar.
Mit der Entwicklung der Lohnquote zwangsläufig verbunden ist die Gewinnquote als ihrem Gegenstück, die Verteilung der Einkommen aus Besitz und Unternehmung selbst kann jedoch aufgrund fehlender Daten nur grob skizziert werden. [48] So stiegen etwa Einkommen aus Finanzvermögen von 1964 bis 1997 insgesamt um rund das 30fache, wobei aufgrund der weiten Verbreitung bei gleichzeitiger Vielfalt dieser Einkommen (darunter Sparbücher, Lebensversicherungen etc.) nur wenige Schlüsse auf die Verteilung gezogen werden können. Allerdings ist prinzipiell davon auszugehen, dass aufgrund besserer Startbedingungen Personen, die bereits über Vermögen verfügen, dieses eher vermehren können als Personen, die einen Anteil ihrer Arbeitseinkommen sparen müssen, um es anlegen zu können. Somit ist die Zunahme der Einkommen der Finanzvermögen in Verbindung mit generellen Zunahme der Gewinnquote ein starker Hinweis darauf, dass sich die Einkommensverteilung zuungunsten des Faktors Kapital entwickelt hat.
Verteilung innerhalb des Faktors Arbeit
Die Entwicklung innerhalb der Einkommen aus Arbeit sind in der Lohnsteuerstatistik dokumentiert und somit wesentlich besser verfügbar als Einkommen aus Besitz und Unternehmung. Korrigiert man um die Verzerrung durch unterschiedliche Arbeitszeiten, so wird in Österreich wie in anderen Industriestaaten seit den 1980er-Jahren eine tendenzielle Zunahme der Lohnspreizung beobachtet. Diese Entwicklung lässt sich in erster Linie auf einen relativen Überschuss an wenig qualifizierten Arbeitskräften (d.h. das Angebot ist größer und/oder steigt rascher als die Nachfrage) bei gleichzeitiger Verknappung bestimmter Qualifikationen zurückzuführen. Zusätzlich prägen auch gesellschaftliche Entwicklungen wie die oben skizzierte Frauenerwerbsquote und Zuwanderung die Lohnspreizung, indem sie das relative Angebot bestimmter Qualifikationen beeinflussen. Generell können in den fortgeschrittenen Industriestaaten seit den 1980er- und 1990er-Jahren drei Phänomenen beobachtet werden:
- Der Abstand zwischen den Gruppen am oberen und am unteren Ende der Verteilung hat sich vergrößert, d.h. die Spannweite zwischen niedrigen und Spitzengehältern ist größer geworden;
- die Abstände zwischen Personen mit unterschiedlicher Ausbildung, Erfahrung und Alter haben sich vergrößert;
- Lohndifferenziale haben sich auch innerhalb demografischer Gruppen und Personen mit vergleichbaren Ausbildungsniveaus vergrößert.
Ein weiterer Aspekt, dem sehr viel mediale Aufmerksamkeit gewidmet wird, ist die Lohnspreizung zwischen Männern und Frauen. So verdienen unselbständig erwerbstätige Frauen in Österreich brutto rund 19 Prozent, netto rund 16 Prozent weniger als Männer (bezogen auf Medianlöhne und -gehälter). Ebenso können signifikante Unterschiede zwischen verschiedenen ethnischen Gruppen existieren. Die Gründe für Ungleichheit zwischen Arbeitnehmern aufgrund des Geschlechts, der Zugehörigkeit zu einer Ethnie, Religion oder anderen Merkmalen sind vielfältig, sie lassen sich für die in Österreich intensiv diskutierte Ungleichheit zwischen Männern und Frauen v.a. auf die folgenden fünf Gründe zurückführen:
- Bildungsabschlüsse: Die wichtigste Determinante für Einkommen aus Arbeit ist der formale Bildungsabschluss, wobei grundsätzlich gilt, dass höhere Abschlüsse einen positiven Effekt auf das erwartete Einkommen haben. In Österreich haben Frauen der jüngeren Generationen zu Männern zwar aufgeschlossen und sie zuletzt sogar überholt, allerdings sind die formalen Abschlüsse bei Männern älterer Generationen im Durchschnitt höher. Dieser Effekt wird Bestand haben bis jene Generationen, innerhalb derer Männer im Durchschnitt höhere Abschlüsse haben, in Pension gegangen sein werden.
- Ausbildungsfelder: Bildungsabschlüsse bilden eine erste Annäherung, allerdings unterscheiden sich die Löhne und Gehälter zwischen formal identischen Bildungsabschlüssen ganz erheblich. Da Männer öfter Ausbildungsfelder wählen, die später mit höheren Löhnen und Gehälter verbunden sind (z.B. technische Lehren und Studien), erzielen sie auch bei formal identischen Bildungsabschlüssen im Durchschnitt mehr Einkommen.
- Unannehmlichkeiten: Bereits Adam Smith hat hervorgehoben, dass Unternehmen mit relativ unangenehmen Arbeitsbedingungen ihre Arbeiter für die Unannehmlichkeiten kompensieren müssen - andernfalls würden sie keine Arbeiter finden. Daraus folgt umgekehrt, dass Arbeitnehmer mit niedrigen Bildungsabschlüssen und Ausbildungsfeldern durch die Annahme relativ unangenehmer Arbeit dennoch relativ hohe Einkommen erzielen können. Dazu zählen auch gefährliche Arbeiten, die in Österreich eher von Männern durchgeführt werden.
- Erfahrung: Mit Erfahrung im Beruf erwirbt ein Arbeitnehmer auch nach vollzogenem Bildungsabschluss weiterhin Humankapital, indem er durch Erfahrung produktiver wird, wodurch er wiederum eine höhere Entschädigung durchsetzen kann. Dieser Gewinn ist tendenziell umso höher, je höher die formale Bildung ist und je länger die Person berufstätig ist. Da Frauen öfter als Männer ihre Erwerbszeit durch Kinderbetreuung unterbrechen, wird im selben Zeitraum dementsprechend weniger Humankapital akkumuliert.
- Statistische Diskriminierung: Wenn – aus welchen Gründen auch immer – eine Gruppe im Durchschnitt bessere Leistungen im Beruf zeigt, und wenn eine Person aufgrund äußerlicher Merkmale einer Gruppe eindeutig zuzuordnen ist, dann profitieren alle Mitglieder dieser Gruppe. Der Grund dafür ist, dass der Arbeitgeber nicht wissen kann, wie die Leistungsbereitschaft eines einzelnen Arbeitnehmers aussieht. Er wird daher versuchen, einen Vertreter der Gruppe mit höherer Leistungsbereitschaft einzustellen und bereit sein, die wahrscheinlich höhere Leistungsbereitschaft entsprechend höher zu entlohnen. Dabei gilt, dass sich der Arbeitnehmer trotz der Unkenntnis über die tatsächliche Leistungsbereitschaft rational agiert. Hierbei spielt auch die bei Frauen höhere Wahrscheinlichkeit der Arbeitsunterbrechung durch Elternkarenz eine Rolle, da Arbeitgeber bspw. eher in die Weiterbildung von männlichen Angestellten investieren werden, da bei diesen die Erträge dieser Humankapitalinvestition im Durchschnitt höher sind.
Studien zeigen, dass die Unterschiede zwischen Männern und Frauen bei Berücksichtigung der Punkte eins bis vier (abhängig vom Studiendesign) auf zirka acht Prozent (aus Sicht der Frauen) reduziert werden – diese Größe wird auch bereinigte Geschlechter-Lohnlücke genannt. Die ersten vier der genannten Punkte sind grundsätzlich von der Gesellschaft beeinflussbar, was den Unterschied zwischen bereinigter und unbereinigter Geschlechter-Lohnlücke variabel macht und theoretisch auch zu höheren Durchschnittslöhnen und -gehältern für Frauen führen kann. Allerdings ist der fünfte Punkt besonders problematisch: Solange Frauen eher Elternkarenz beanspruchen haben Arbeitgeber einen rationalen Grund zu diskriminieren.
Dieses Dilemma ist mit den Instrumenten der Marktwirtschaft nicht lösbar, weil diese ihrem Wesen nach darauf basiert, dass Entscheidungsträger die Freiheit der Wahl haben und Entscheidungsträger ihre Entscheidungen bei Unsicherheit grundsätzlich auf Wahrscheinlichkeiten basieren lassen.
Gesamte Verteilung
Unabhängig von Geschlecht weist eine sinkende Lohnquote bei gleichzeitiger Zunahme der Lohnspreizung insgesamt auf eine zunehmende Ungleichverteilung der personellen Einkommensverteilung hin. Die Ungleichheit der Bruttoeinkommen wird über Steuern und Beiträge sowie finanzielle Transfers bis zu einem gewissen Grad durch den Staat korrigiert, wobei Studien darauf hindeuten, dass die Nettohaushaltseinkommen insgesamt gleichmäßiger verteilt sind als es der primären Verteilung entsprechen würde. [49] Als Umverteilungsinstrumente in Österreich von größter Bedeutung sind jedoch die Bereitstellungen öffentlicher Dienstleistungen, wobei hier insbesondere das Gesundheitswesen und das Bildungssystem zu nennen sind. Diese Instrumente betreffen freilich in erster Linie Umverteilungen zwischen Beziehern mittlerer, niedriger oder gar keiner Einkommen.
Wie in Abb. 2.3 dargestellt, hat sich die Lohnquote seit den 1990er-Jahren reduziert. Allerdings hat sich im selben Zeitraum auch die Abgabenbelastung der Produktionsfaktoren zulasten des Faktors Arbeit verschoben. [50] So nahm die effektive Lohnsteuerbelastung (sie entspricht dem Anteil der Lohnsteuer an den lohnsteuerpflichtigen Einkommen inkl. Pensionen) von 1990 bis 2007 von 10,9 auf 15,4 Prozent zu, während das Aufkommen an Einkommen- und Kapitalertragsteuer von 10,9 auf 10,3 Prozent abnahm. Somit hat sich nicht nur die primäre Einkommensverteilung, sondern auch die sekundäre Einkommensverteilung zugunsten der Bezieher von Einkommen aus Besitz und Unternehmung verschoben. In Ergänzung zur Lohnquote aus. Gl. (2.8) lässt sich auch die Nettolohnquote berechnen: Sie entspricht dem Löhnen abzüglich der Lohnsteuer und der Sozialabgaben dividiert durch das Volkseinkommen abzüglich aller Sozialabgaben und direkten Steuern. Für 1988 stand demnach einer Bruttolohnquote von rund 73 Prozent eine Nettolohnquote von 67 Prozent gegenüber, bis zum Ausbruch der Krise sank die Bruttolohnquote auf 66 Prozent, die Nettolohnquote auf 59 Prozent. Demnach hat sich die steuerliche Benachteiligung unselbständig Erwerbstätiger im Zeitverlauf noch verstärkt.
Zusammenfassung
Für die makroökonomische Politik von besonderer Bedeutung ist die Entwicklung am Arbeitsmarkt, welche umgekehrt die makroökonomische Entwicklung beeinflusst. Aufgrund der Doppelrolle der Arbeit als Produktionsfaktor einerseits und Nachfrager am Gütermarkt andererseits ist die Analogie des Arbeitsmarkts zu anderen Märkten begrenzt. Vielmehr kommt es zu einer Wechselwirkung von Gütermarkt und Arbeitsmarkt, die im Mittelpunkt der keynesianischen Theorie steht.
Sowohl das gesamte Arbeitsangebot im Verhältnis zur Nachfrage wie Überschüsse und Knappheiten einzelner Qualifikationen beeinflussen die funktionelle Einkommensverteilung sowie die Lohnspreizung. Die Situation am Arbeitsmarkt wirkt daher auf die Kollektivertragsverhandlungen zwischen Arbeitnehmer- und Arbeitgeberseite. Interessensvertretungen beeinflussen auch die Politik, da fast jede wirtschaftspolitische Maßnahme auch auf die Einkommensverteilung wirkt.
In Österreich zeigt die Entwicklung auf den Arbeitsmärkten in den letzten Jahrzehnten mehrere Trends, darunter einen Rückgang der Selbständigen und der Mithelfenden bis in die 1980er-Jahre bei gleichzeitiger Zunahme der Erwerbspersonen bis in die 2000er-Jahre. Die Arbeitslosenquote befand sich bis in die 1970er-Jahre auf niedrigem Niveau und steigt seither an, ist im EU-europäischen Vergleich dabei relativ niedrig. Hinsichtlich der Einkommensverteilung zeigen sich sowohl zwischen den Faktoren Arbeit wie Kapital wie innerhalb der Bezieher von Löhnen und Gehältern seit den 1980er- und 1990er-Jahren Zunahmen der Ungleichheit.
Übungen
|
- Arbeit ist einerseits Produktionsfaktor, andererseits als Nachfrager die wichtigste Determinante der Kaufkraft. Dadurch ist die Analogie des Arbeitsmarkts zu anderen Märkten begrenzt: Eine sinkende Nachfrage nach dem Faktor Arbeit bewirkt eine sinkende Güternachfrage.
- Im keynesianischen Modell wird der Beschäftigungsgrad einer Ökonomie von der Gesamtnachfrage bestimmt: Die gesamtwirtschaftliche Nachfrage muss demnach zunehmen, um die Nachfrage nach dem Faktor Arbeit zu erhöhen. Daraus folgt, dass der Beschäftigungsgrad von Konsumneigung und Neuinvestitionen abhängig ist.
- Die Ableitung des Multiplikators Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 1 /\left(1-c_{1}(1-t)+x_{1}\right)} nach Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle c_{1}} ergibt Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle (1-t) /\left[\left(1-c_{1}(1-t)+x_{1}\right)\right]^{2}} ; da Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle t<1} gelten muss, ist die Ableitung eindeutig positiv.
- Der Primärsaldo beziffert den Saldo der öffentlichen Haushalte abzüglich der Zinszahlungen für in der Vergangenheit aufgenommene Schulden.
- Der Reservationslohn entspricht jenem Lohnsatz, zu dem ein Arbeitnehmer gerade indifferent ist zwischen den Alternativen Arbeitslosigkeit und Beschäftigung.
- Insider-Outsider-Modelle versuchen zu erklären, warum Arbeitslose von Betrieben auch dann nicht eingestellt werden, wenn sie bereit sind, zu einem niedrigeren Lohnsatz als dem im Betrieb herrschenden zu arbeiten.
- Prozess- und Produktinnovationen betreffen unterschiedliche Gruppen, durch eine rasche Veränderung der Produktionsstruktur kann es zu einer Diskrepanz in der Qualifikation bzw. in der regionalen Verfügbarkeit zwischen Arbeitskräfteangebot und Arbeitskräftenachfrage kommen.
- Die Lohnspreizung bezeichnet die Verteilung innerhalb der Einkommen aus Arbeit.
- Erwerbstätige und Erwerbslose bilden die Summe der Erwerbspersonen. Erwerbstätige setzen sich zusammen aus den Selbständigen, den Mithelfenden und den Arbeitnehmern.
- Die stille Reserve umfasst jene Personen, die prinzipiell bereit wären, eine Arbeit aufzunehmen, aber gegenwärtig nicht aktiv suchen: u.a. resignierte Arbeitslose, Hausfrauen und -männer.
- Die funktionelle Einkommensverteilung bezeichnet die Verteilung des produzierten Einkommens auf die Produktionsfaktoren, die personelle Einkommensverteilung bezeichnet die Verteilung des produzierten Einkommens auf einzelne Personen oder Haushalte.
- Die bereinigte Lohnquote korrigiert die unbereinigte Lohnquote um Veränderungen im Anteil der Arbeitnehmer an den Erwerbstätigen: Sie gibt die Lohnquote zu einem bestimmten Zeitpunkt an, die eingetreten wäre, wenn der Anteil der Arbeitnehmer an allen Erwerbstätigen konstant geblieben wäre.
- Der Anteil ist seit den 1950er-Jahren kontinuierlich bis auf knapp 90 Prozent in den 1980er-Jahren angestiegen. Hauptgründe sind die Rückgänge der landwirtschaftlichen Betriebe und der kleinen Gewerbebetriebe.
- Beispiele: geringfügig Beschäftigte; momentan nicht Arbeit Suchende, aber als arbeitslos registrierte Personen; in Schulung befindlich und gleichzeitig als arbeitslos registrierte Personen
- Die Einkommen der Arbeitnehmer sind weitgehend festgelegt, die Einkommen der Unternehmen sind hingegen weitgehend unsicher und deshalb stärker von der Konjunktur abhängig.
- Hinweise: Relative versus reale Einkommenszuwächse, funktionelle versus personelle Einkommensverteilung, Vermögenseinkommen und Lohnspreizung, primäre und sekundäre Einkommensverteilung.
- Die statistische Diskriminierung bezeichnet das rationale Verhalten von Arbeitgebern, aufgrund äußerer Merkmale wie Geschlecht oder ethnischer Zugehörigkeit unterschiedliche Löhne zu bezahlen. Die Ursache liegt in der Unkenntnis des Arbeitgebers über die wahren Eigenschaften des Arbeitnehmers begründet. Wenn jedoch eine Gruppe im Durchschnitt bessere Leistungen im Beruf zeigt, dann hat der Arbeitgeber bei Vertretern dieser Gruppe eine höhere Wahrscheinlichkeit für bessere Leistungen.
- Die Nettolohnquote entspricht dem Löhnen abzüglich der Lohnsteuer und der Sozialabgaben dividiert durch das Volkseinkommen abzüglich aller Sozialabgaben und direkten Steuern.
Weiterführende und vertiefende Literatur
Gudrun Biffl: Theorie und Empirie des Arbeitsmarktes am Beispiel Österreich, Springer, 1994
Olivier Blanchard und Gerhard Illing: Makroökonomie [5. Aufl.], Pearson, 2009
Peter Bofinger: Grundzüge der Volkswirtschaftslehre [2. Aufl.], Pearson, 2007
Heinz-Josef Bontrup: Lohn und Gewinn [2. Aufl.], Oldenbourg 2008
George J. Borjas: Labor Economics [5. Aufl.], New York, 2010
Peter Dicken und Peter E. Lloyd: Standort und Raum – Theoretische Perspektiven in der Wirtschaftsgeographie [dt. Aufl.], Ulmer, 1999
Franz Haslinger: Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung [7. Aufl.], Oldenbourg, 1998
Reinhard Neck und Ewald Nowotny (Hrsg.): Grundzüge der Wirtschaftspolitik Österreichs [3. Aufl.], Manz, 2001
David Romer: Advanced Macroeconomics [3. Aufl.], McGraw-Hill, 2006
Sascha Sardadvar: Economic Growth in the Regions of Europe: Theory and Empirical Evidence from a Spatial Growth Model, Physica, 2011
Statistik Austria: Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen: Hauptergebnisse 1995 – 2015, Statistik Austria, 2016
Internetquellen
Eurostat http://ec.europa.eu/eurostat/web/main/home
Statistik Austria http://statistik.gv.at
Vereinte Nationen: http://unstats.un.org/unsd/snaama/dnlList.asp
[jeweiliger Stand: 11. Jänner 2017]
- ↑ Siehe insbesondere Grundlagen der Volkswirtschaftslehre 3.
- ↑ Vgl. Grundlagen der Volkswirtschaftslehre 3, Tab. 1.1.
- ↑ Smith geht auf Wirtschaftswachstum im heutigen Sinne v.a. im ersten und zweiten Buch ein in: Adam Smith: An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations [1. Aufl. 1776], Deutscher Taschenbuch Verlag, 2003.
- ↑ Vgl. auch Grundlagen der Volkswirtschaftslehre 3, Kap. 1.2.2.
- ↑ Unter dem Eindruck der rasch voranschreitenden Industrialisierung hat Ricardo seine Werke mehrmals revidiert, 1821 mit der Einfügung des Kapitels „On Machinery“ des in der ersten Auflage 1817 erschienenen Werks: David Ricardo: On the Principles of Political Economy and Taxation [3. Aufl 1821], Prometheus, 1996.
- ↑ Die Analysen Marx’ zum Wirtschaftswachstum finden sich insbesondere im siebenten Abschnitt in: Karl Marx: Das Kapital – Kritik der politischen Ökonomie; Erster Band: Der Produktionsprozeß des Kapitals [2. Aufl. 1872], Parkland, 2003.
- ↑ Die ersten Ausführungen Solows finden sich unter: Robert M. Solow: A Contribution to the Theory of Economic Growth, Quarterly Journal of Economics 70, 1956
- ↑ Man beachte, dass in der Makroökonomik die Begriffe Kapital und Sachkapital zumeist synonym gebraucht werden, wiewohl es zahlreiche andere Kapitalformen gibt. Auch im vorliegenden Skriptum ist mit „Kapital“ ohne spezifische Bezeichnung stets das Sachkapital gemeint, d.h. die Begriffe Kapital und Sachkapital werden als Synonyme verwendet.
- ↑ In Abb. 1.1 wäre somit das BIP identisch mit dem BNE.
- ↑ In Österreich lag der Anteil der Land- und Forstwirtschaft inkl. Fischerei an der Bruttowertschöpfung (zu den Begriffen siehe Kapitel 1.4.1) im Jahr 2015 bei 1,29%, der Anteil des Bergbaus bei 0,39% (Berechnung nach Daten der Statistik Austria).
- ↑ Man kann sagen, dass das Modell nur anwendbar ist, wenn diese Annahmen erfüllt sind. Für Ökonomien, deren Realität von den Modellannahmen drastisch abweicht, hat das Modell folglich nur eingeschränkte Aussagekraft. Beispiele wären Ökonomien, die durch den Export von Rohstoffen sehr rasch wachsen wie etwa die OPEC-Länder in den 1970er- und 1980er-Jahren, oder Ökonomien, die die makroökonomischen Rahmenbedingungen wie Zinssatz, Inflation oder Staatsverschuldung nicht in den Griff bekommen, beispielsweise Japan oder die Ukraine in den 2000er- und 2010er-Jahren. Auch für die Ökonomien der Eurozone stellt sich angesichts der Euro-Dauerkrise zum Zeitpunkt der Drucklegung des vorliegenden Studienhefts schön langsam die Frage, ob die Modellannahmen noch zutreffen.
- ↑ Vgl. im Zusammenhang mit einzelnen Betrieben hierzu Grundlagen der Volkswirtschaftslehre 2 (Kapitel 1.1.4).
- ↑ Vgl. Grundlagen der Volkswirtschaftslehre 2 (Kapitel 1.1.1).
- ↑ Vgl. hierzu Grundlagen der Volkswirtschaftslehre 2, Gleichung (1.10).
- ↑ Die in den späten 1980er-Jahren entstandene endogene Wachstumstheorie (ausgehend von Arbeiten von Paul M. Romer sowie Robert E Lucas Jr.) versucht, die Determinanten der Höhe des technologischen Fortschritts zu modellieren und somit den technologischen Fortschritt als solchen zu bestimmen.
- ↑ Robert E. Lucas Jr.: Why Doesn’t Capital Flow from Rich to Poor Countries?, American Economic Review 80, 1990
- ↑ Dieses Phänomen wird auch Lucas-Paradoxon genannt.
- ↑ N. Gregory Mankiw, David Romer, David N. Weil: A Contribution to the Empirics of Economic Growth, Quarterly Journal of Economics 107, 1992
- ↑ Ausgenommen ist hier ein Ausgangspunkt mit Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \hat{k}=0} oder ; ein solcher Ausgangspunkt entspricht jedoch einer nicht existierenden Ökonomie und ist daher für die weitere Betrachtung belanglos.
- ↑ Für das Mankiw-Romer-Weil-Modell ist dieser Zusammenhang in Abb. 1.5 dargestellt.
- ↑ Für eine ausführlichere Diskussion des Konzepts siehe: Robert J. Barro und Xavier X. Sala-i-Martin: Convergence, Journal of Political Economy 100, 1992
- ↑ Im Mankiw-Romer-Weil-Modell ergibt sich als Konvergenz-Geschwindigkeit Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \beta \approx (1-\alpha -\beta )(n+g+\delta )}
- ↑ Gunnar Myrdal: Economic Theory and Under-Developed Regions [1. Aufl. 1957]. Duckworth, 1964
- ↑ Paul Krugman: Geography and Trade [1. Aufl. 1991]. Leuven University Press, 1992
- ↑ Dass Schwarzarbeit nicht erfasst würde, ist hingegen ein weit verbreiteter Irrtum. Als entgeltliche Arbeit ist sie definitionsgemäß Teil des Sozialprodukts; sie wird in Österreich auf ca. 4% des BIP geschätzt.
- ↑ Daher wird das Inländerkonzept treffender auch als „Wohnortkonzept“ bezeichnet.
- ↑ Angabe für Irland berechnet laut Central Statistics Office Ireland, nach Daten für 2015.
- ↑ Vgl. Grundlagen der Volkswirtschaftslehre 1, Kapitel 1.3.3.
- ↑ Siehe hierzu: Xavier X. Sala-i-Martin: The Classical Approach to Convergence Analysis, The Economic Journal 106, 1996
- ↑ Das Bruttoregionalprodukt ist konzeptionell identisch mit dem Bruttoinlandsprodukt.
- ↑ Quelle: Sascha Sardadvar: Vertiefen sich die räumlichen Wohlstandsgefälle innerhalb der Europäischen Union?, Wirtschaft und Gesellschaft 42, 2016
- ↑ Keyens hat sich auch ausführlich mit den Auswirkungen auf und dem Einfluss des Geldes auf den Produktionsprozess auseinandergesetzt, worauf hier jedoch nicht weiter eingegangen wird.
- ↑ Daten nach Statistik Austria
- ↑ Aus diesem Grund wird die Staatsverschuldung bei internationalen Vergleichen meistens relativ zum absoluten BIP angegeben.
- ↑ Es steht übrigens jeder privaten Person frei, durch den Erwerb österreichischer Staatsanleihen selbst zum Gläubiger der Republik Österreich zu werden und so in den Genuss entsprechender Zinszahlungen zu kommen.
- ↑ Analog definiert ist das Primärdefizit; vgl. Grundlagen der Volkswirtschaftslehre 1, Kapitel 1.3.5.
- ↑ Siehe hierzu insbesondere die Theorien von Ricardo und Marx.
- ↑ zitiert nach Handelsblatt, 11. Jänner 2017
- ↑ Eine übersichtliche Darstellung der österreichischen Regelungen und Entscheidungsfindung findet sich bei: Ingrid Kubin und Peter Rosner: Arbeitsmarktpolitik: Theoretische Grundlagen und österreichische Institutionen, in: Neck und Nowotny (2001)
- ↑ Aus diesem Grund wird eine höhere Arbeitslosenquote dämpfend auf die Inflation wirken, und eine niedrige Arbeitslosigkeit die Inflation erhöhen. Daraus folgt, dass eine angestrebte Senkung der Inflation mit einer temporär höheren Arbeitslosenquote verbunden ist. Dieser Zusammenhang ist für die Geldpolitik von entscheidender Bedeutung und wurde 1958 von A. W. Phillips aufgezeichnet (Phillips-Kurve).
- ↑ Eine praktische Entsprechung dieser Theorie sind „Dienst-Nach-Vorschrift“-Kampfmaßnahmen bei Arbeitskonflikten, die die Bedeutung individueller Motivationskomponenten für die Effizienz des Betriebs zum Ausdruck bringen.
- ↑ Der Reallohn bezeichnet – analog zum realen BIP – jenen Lohn, der um Preiseffekte korrigiert wird. Wie beim BIP ist er eher für Vergleiche einer Ökonomie mit sich selbst im Zeitverlauf geeignet, weniger für internationale Vergleiche. Ein sinkender Reallohn bedeutet, dass sich der betreffende Arbeitnehmer weniger Güter leisten kann als in der Vergangenheit, und vice versa für steigende Reallöhne.
- ↑ Daraus folgt, dass eine formal hohe Qualifikation eines Arbeitnehmers nicht zwangsläufig mit einem höheren Lohnsatz verbunden ist, wenn das Angebot an dieser spezifischen Qualifikation relativ hoch ist.
- ↑ Wie aus Gleichung (2.7) ersichtlich ist jedoch beiden Methoden gemein, dass sie zur Ermittlung der Arbeitslosenquote die Zahl der Arbeitslosen durch die Zahl der Erwerbspersonen (nicht: der Bevölkerung) dividieren. In Zeitungen immer wieder zu lesende Formulierungen wie „zehn Prozent der Franzosen sind ohne Job“ sind daher meistens nicht korrekt: Wenn z.B. die Arbeitslosenquote nach EU-Definition zehn Prozent beträgt, sind weit weniger als zehn Prozent Franzosen nach EU-Definition arbeitslos, da die Bevölkerungszahl wesentlich größer ist als die Zahl der Erwerbspersonen.
- ↑ Bis 1997 wurden diese Einkommen in sechs Kategorien untergliedert: Land- und Forstwirtschaft; Gewerbebetriebe; freie Berufe; Kapitalvermögen, Vermietung, Verpachtung; Staatlicher Besitz und Unternehmung; unverteilte Gewinne der Kapitalgesellschaften.
- ↑ Bei der Interpretation ist zu beachten, dass Mithelfende sowohl ökonomisch wie statistisch zu den Erwerbstätigen zählen. Mit den Rückgängen der landwirtschaftlichen Betriebe und der kleinen Gewerbebetriebe ist nicht nur die Zahl der Selbständigen, sondern auch der (häufig weiblichen) Mithelfenden zurückgegangen (vgl. Tab. 2.1). Hinsichtlich der weiblichen Beschäftigung sind seit den 1950er-Jahren somit zwei Trends parallel zu beobachten: Erstens eine allgemeine Zunahme der Erwerbsquote, zweitens eine Zunahme der unselbständig Beschäftigten unter den Erwerbstätigen.
- ↑ Der Begriff Vollbeschäftigung ist nicht eindeutig definiert und auch abhängig von der Definition der Arbeitslosigkeit. Theoretisch herrscht Vollbeschäftigung, wenn Arbeitslose zwischen zwei Beschäftigungsverhältnissen lediglich kurzfristig beschäftigungslos sind; im empirischen Kontext spricht man meist dann von Vollbeschäftigung, wenn die Arbeitslosenquote unter drei Prozent beträgt.
- ↑ Einkommen, die dem Staat aus Besitz und Unternehmung entstehen, werden definitionsgemäß zur Gewinnquote gerechnet.
- ↑ Zur Einkommensverteilung siehe auch: Alois Guger und Markus Marterbauer: Langfristige Tendenzen der Einkommensverteilung in Österreich, WIFO Monatsberichte 9/2005
- ↑ Siehe hierzu und den weiteren statistischen Angaben in diesem Absatz: Alois Guger u.a.: Umverteilung durch den Staat in Österreich, 2016, Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung