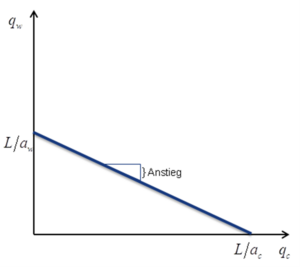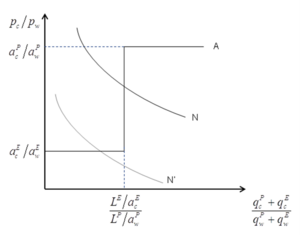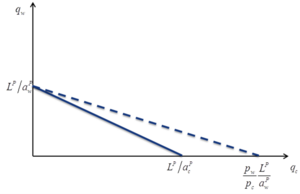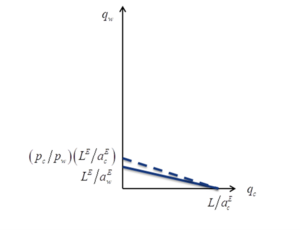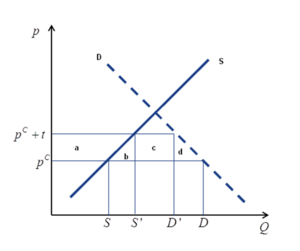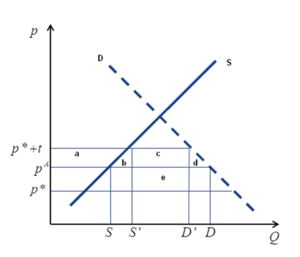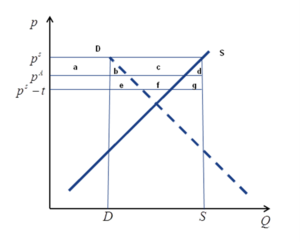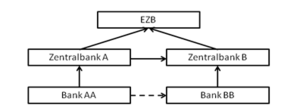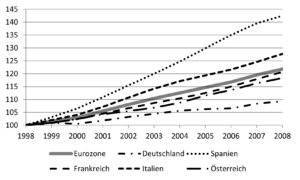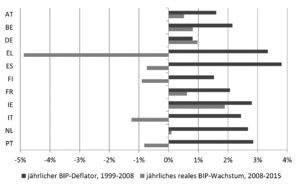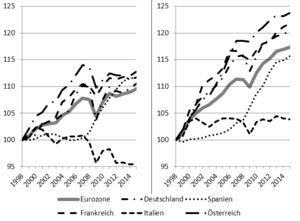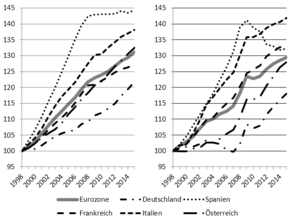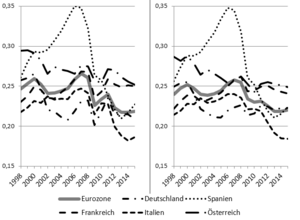Internationale Wirtschaft - Gesamt
Sascha Sardadvar studierte Volkswirtschaft an der Universität Wien, der FU Berlin und der Wirtschaftsuniversität Wien. Er hat zahlreiche Artikel in regional- und wirtschaftswissenschaftlichen Fachzeitschriften veröffentlicht und habilitierte sich im Sommer 2015 im Fach Economic Geography and Regional Science. Zu seinen Forschungsschwerpunkten zählen Theorie und Empirie regionalen Wirtschaftswachstums, Ursachen und Auswirkungen interregionaler Arbeitsmigration sowie Fragen der Innovationsökonomik.
Einleitung
Das vorliegende Studienheft und die damit verbundene Lehrveranstaltung befassen sich mit verschiedenen Aspekten, für die Globalisierung und die europäische Integration kennzeichnend sind. Wie in den vorangegangenen Lehrveranstaltungen aus dem Fach Volkswirtschaftslehre, Angewandte Mikroökonomie und Angewandte Makroökonomie, steht auch hier die Anwendungsorientiertheit im Vordergrund: Das Ziel ist, allgemeine und alltäglich gebrauchte Konzepte, die zur Beschreibung der eigenen Volkswirtschaft im internationalen Vergleich herangezogen werden, verständlich und nutzbar zu machen. Das betrifft insbesondere theoretische Fragen des internationalen Handels, Möglichkeiten der Handelspolitik, empirische Daten zum Außenhandel, das Zustandekommen und die Aussagekraft von Wechselkursen, Vor- und Nachteile einer Währungsunion, das Konzept der Wettbewerbsfähigkeit und Fragen der Arbeitsmigration. Die Lehrveranstaltung gliedert sich in zwei Lektionen, wobei die erste Lektion dem internationalen Handel gewidmet ist, während sich die zweite Lektion mit Währungen, Wettbewerbsfähigkeit und Migration auseinandersetzt.
In Lektion 1.1 wird zunächst die wichtigste theoretische Begründung für den sich seit Jahrzehnten vollziehenden Abbau von Handelsbarrieren besprochen: Das Ricardo-Modell zeigt, wie auch jene Ökonomien vom Freihandel profitieren, die technologisch und/oder aufgrund ihrer natürlichen Ressourcen unterlegen sind. Dennoch kann es Gründe geben, den Handel einzuschränken, worauf in Lektion 1.2 eingegangen wird. Im Mittelpunkt von Lektion 1.3 stehen empirische Konzepte zur Erfassung des Außenhandels, wobei der Zahlungsbilanz besondere Aufmerksamkeit geschenkt wird.
Das Zustandekommen von Wechselkursen bildet den ersten Schwerpunkt von Lektion 2.1, bevor auf Währungsunionen im Allgemeinen und die Eurozone im Besonderen eingegangen wird. Fragen der ökonomischen Wettbewerbsfähigkeit stehen häufig im Mittelpunkt öffentlicher Diskussionen, weshalb den damit verbundenen Konzepten mit Lektion 2.2 ein eigener Abschnitt gewidmet wird. Schließlich behandelt Lektion 2.3 die Ursachen und Auswirkungen der Arbeitsmigration.
Handelsströme
Seit Ende des Zweiten Weltkriegs, insbesondere aber seit den frühen 1990er-Jahren hat sich das Welthandelsvolumen beständig erhöht – nicht nur in absoluten Zahlen, sondern auch relativ zum Weltwirtschaftswachstum. Damit verbunden ist der Begriff der Globalisierung, der in den 1990er-Jahren populär und Teil des allgemeinen Sprachgebrauchs wurde. Zwar ist umstritten, was mit Globalisierung nun tatsächlich gemeint ist: Manche zählen auch den globalen Massentourismus und kulturelle Aspekte dazu, andere fokussieren vor allem auf Fortschritte der Informations- und Kommunikationstechnologien wie dem Internet in Verbindung mit einer Reduktion der Transportkosten. Diese Phänomene mögen sich in den 1990er-Jahren verstärkt haben, sie setzten jedoch nur Trends fort, die sich bereits seit dem 19. Jahrhundert beobachten lassen und mit den Erfindungen des Telegrafen und der Eisenbahn ihren Ausgang genommen haben. In diesem Sinn wäre Globalisierung nichts genuin Neues.
Seit Ende des Zweiten Weltkriegs haben die etablierten („westlichen“) Industriestaaten unter Führung der USA eine kontinuierliche Politik betrieben, die grenzüberschreitenden Handel und Investitionen erleichtern sollte und mit der Gründung der Welthandelsorganisation (World Trade Organization, WTO) 1995 ihren Abschluss fand. [1] Parallel zu dieser Entwicklung haben sich weite Teile der Weltwirtschaft von diesem System des globalen Kapitalismus abgeschottet und einen eigenen Weg der Entwicklung gesucht, insbesondere die Sowjetunion und die mit ihnen verbündeten Staaten (Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe, RGW), die Volksrepublik China nach ihrer Gründung 1949 sowie Indien nach der Erlangung der Unabhängigkeit 1947. Was die 1990er-Jahre so besonders macht, ist die Öffnung dieser Ökonomien für das globale kapitalistische System, die praktisch zeitgleich erfolgte. Somit lässt sich der Begriff der Globalisierung einengen auf die Ausweitung des globalen Handels- und Investitionssystems auf den überwiegenden Teil der Erde. Gleichzeitig hat die EU mit dem Vertrag von Maastricht den Europäischen Binnenmarkt verwirklicht und so die wirtschaftliche Integration vertieft. Durch den EU-Beitritt 1995 war Österreich beiden Entwicklungen gleichzeitig ausgesetzt, was das Land nachhaltig geprägt und verändert hat.
Aus dieser Sicht ist das Fach der Internationalen Wirtschaft eng mit dem Phänomen der Globalisierung verwoben. Globalisierung ist im obigen Sinn kein natürliches Phänomen oder eine zwangsläufige Entwicklung technologischen Fortschritts, sondern politisch gewollt und durchgeführt. Berücksichtigt man, dass sich Russland, die Volksrepublik China und Indien die ursprüngliche Loslösung vom globalen kapitalistischen System unter großen Opfern erkämpft haben, so wird offensichtlich, dass es nicht nur einen determinierten, „natürlichen“ Weg der Entwicklung gibt. Gerade weil diese Länder sich dem globalen kapitalistischen System wieder geöffnet haben, wird allerdings deutlich, dass von den damit verbundenen Entwicklungen Vorteile erwartet werden. Hinsichtlich des Handels gilt dies insbesondere für Effizienzgewinne als Folge der internationalen Arbeitsteilung. Die theoretische Grundlage für den Abbau von Handelshemmnissen bis zur Gründung von Freihandelszonen bildet das Ricardo-Modell, das in Lektion 1.1 vorgestellt wird. Argumente für und wider den Freihandel und Instrumente der Handelspolitik, werden in Lektion 1.2 diskutiert, bevor in Lektion 1.3 empirische Konzepte zur Erfassung des Handels vorgestellt werden.
Komparative Vorteile
Grundlegend für das Verständnis des Ricardo-Modells ist das Prinzip der komparativen Vorteile. Im Unterschied zu den absoluten Vorteilen geht es hier nicht darum, welche Ökonomie etwas Bestimmtes im Unterschied zu anderen Ökonomien besser macht, sondern was eine Ökonomie verglichen mit sich selbst am besten macht. Die Hauptaussage ist: Jede Ökonomie soll sich auf das spezialisieren, was sie am besten kann. Aufgrund der daraus resultierenden komparativen Vorteile soll eine Ökonomie auch dann mit anderen Ökonomien handeln, wenn sie nichts besser als andere Ökonomien kann. Die intellektuelle Leistung des Ricardo-Modells besteht darin, zu zeigen, dass auch in diesem Fall beide Ökonomien vom Handel profitieren.
Opportunitätskosten
Die Basis des Ricardo-Modells [2] bildet das Konzept der Opportunitätskosten (auch: Alternativkosten), definiert als entgangener Nutzen oder Ertrag im Vergleich zur besten nicht realisierten Alternative. In einer Ökonomie bedeutet das, dass bei Produktion eines Gutes ein anderes nicht produziert werden kann. Auch wenn eine Volkswirtschaft eine sehr große Entität darstellt, in der Millionen Güter produziert werden, sind die Mittel dennoch begrenzt: Maschinen und Arbeiter*innen, die zur Produktion von Gut X eingesetzt werden, können nicht gleichzeitig Gut Y produzieren. Bei Berücksichtigung von steigenden Skalenerträgen wird deutlich, warum Größeneffekte die Relevanz dieser Feststellung noch unterstreichen, da sich aus der Konzentration auf ein Gut besondere Vorteile ergeben können. [3] So kann man sich beispielsweise vorstellen, dass Österreich weniger als halb so viele Maschinenteile produzierte, würde die Hälfte der derzeitigen Kapazitäten zur Produktion anderer Güter verwendet. Das Konzept der Skalenerträge unterstreicht die Bedeutung der komparativen Vorteile im globalen Handel, es ist jedoch für das Verständnis des Grundprinzips nicht unmittelbar erforderlich.
Betrachtet werde stattdessen zur Einführung die Produktion von Äpfeln und Orangen in den beiden Ländern Österreich und Italien. Angenommen werde ferner, dass die Produktion beider Obstsorten grundsätzlich in beiden Ländern möglich ist. Wenn die Opportunitätskosten zur Herstellung des einen Guts – hier Äpfel – niedriger sind als in einem anderen Land, dann besitzt das Land einen komparativen Vorteil.
Angenommen, in Österreich können mit denselben Ressourcen entweder 10 Äpfel oder 1 Orange produziert werden. Das heißt, in Österreich 10 Äpfel zu produzieren bedeutet, auf die Produktion von 1 Orange zu verzichten. Analog bedeutet in Österreich 1 Orange zu produzieren auf die Produktion von 10 Äpfeln zu verzichten. Innerhalb Italiens können mit denselben Ressourcen entweder 10 Äpfel oder 5 Orangen produziert werden. Das heißt, in Italien 10 Äpfel zu produzieren bedeutet, auf die Produktion von 5 Orangen zu verzichten, und umgekehrt.
Die Opportunitätskosten von Äpfeln sind in Österreich somit niedriger. Das heißt nicht, dass innerhalb Italiens die Produktion von Orangen billiger ist als jene von Äpfeln. Es heißt, dass bei der Produktion von Äpfeln in Österreich auf weniger Orangen verzichtet werden muss als bei der Produktion in Italien.
Produktionsmöglichkeiten
Ricardo selbst hat in seinen Ausführungen die Produktionsmöglichkeiten einer Volkswirtschaft anhand der Güter Tuch (engl. cloth) und Wein dargestellt. Das Modell lässt sich problemlos auf mehr Güter erweitern, die zweidimensionale Darstellung erleichtert allerdings das Verständnis. Selbiges gilt für die Annahme, dass als Produktionsfaktor nur Arbeit benötigt wird. Alternativ kann man mehrere Produktionsfaktoren berücksichtigen und in Geldeinheiten (GE) bewerten, um zum selben Ergebnis zu kommen.
In einer Ökonomie gebe es nun den Produktionsfaktor Arbeit, der zur Produktion der Güter Tuch und Wein in beliebigen Einsatzverhältnissen verwendet werden kann. Da nicht unendlich viele Arbeitseinheiten (AE) zur Verfügung stehen, muss eine Entscheidung darüber getroffen werden, was produziert werden soll. Eine Arbeitseinheit kann gleichzeitig nur einmal eingesetzt werden, also entweder nur für Tuch oder Wein, oder gar nicht eingesetzt werden. Die folgende Ungleichung verdeutlicht das Problem:
(1.1.1)
wobei den Arbeitskoeffizienten darstellt, definiert als nötigen Arbeitsaufwand für die Produktion einer Einheit eines Guts. bezeichnet die produzierte Menge eines Guts, und symbolisieren die beiden Güter Tuch und Wein, das gesamte verfügbare Arbeitsangebot der Ökonomie.
Die Transformationskurve in der unteren Abbildung stellt diesen Zusammenhang als Produktionsmöglichkeiten grafisch dar. [4] In der Ökonomie gibt es insgesamt AE, die auf die Produktion von Tuch und Wein verteilt werden können. Die Punkte auf der Kurve repräsentieren Produktionsmöglichkeiten, die das Arbeitsangebot zur Gänze ausschöpfen; Punkte unter der Kurve sind ebenfalls erreichbar, lassen jedoch einen Teil des Arbeitsangebots ungenutzt; Punkte über der Kurve können nicht erzielt werden. Der Anstieg der Kurve ist gleich den Opportunitätskosten von Tuch in Wein: Aus dem Anstieg der Kurve kann abgelesen werden, wie viele Einheiten (EH) von Wein bei voller Arbeitsauslastung aufgegeben werden müssen, um 1 EH mehr Tuch zu erzeugen. Die Kurve entspricht in der Grafik einer Geraden, da die Opportunitätskosten unabhängig von der jeweils produzierten Menge über den gesamten Bereich konstant sind.
Ist zB , und , so können maximal EH Tuch oder EH Wein produziert werden, und die Produktion von 1 EH Tuch entspricht Opportunitätskosten von 0,5 EH Wein. Die Steigung der Transformationskurve ist entsprechend dem Verhältnis des nötigen Arbeitsaufwands, : Um 1 EH mehr Tuch produzieren zu können, muss auf 0,5 EH Wein verzichtet werden. Die Transformationskurve kann natürlich auch umgedreht und entsprechend interpretiert werden: Um 1 EH mehr Wein produzieren zu können, muss auf die Produktion von 2 EH Tuch verzichtet werden.
Relative Preise
Die Transformationskurve bildet alle möglichen Produktions-Kombinationen ab; was tatsächlich produziert wird, hängt in einer Marktwirtschaft von den relativen Preisen ab. Wenn Arbeit der einzige Produktionsfaktor ist und es keine Gewinne gibt, dann entsprechen die Preise den Kosten der eingesetzten Arbeit, d.h. den Löhnen. Die Arbeiter*innen werden in einer Marktwirtschaft natürlich dort arbeiten wollen, wo die Löhne höher sind. Ohne Profit werden die Löhne allein durch die Produktivität bestimmt. Der Lohn im jeweiligen Sektor entspricht dem Wert, der von 1 AE produziert werden kann. Definiert man und als Preise für Tuch und Wein, ergeben sich als jeweilige Löhne und .
Wenn die Produktivität der Arbeiter*innen nur vom jeweiligen Sektor abhängt, die Arbeiter*innen selbst sich jedoch hinsichtlich ihrer Eigenschaften nicht weiter voneinander unterscheiden, so muss in einer Marktwirtschaft gelten:
wobei einem landesweiten, einheitlichen Lohnsatz entspricht. Der Grund dafür ist, dass bei sektoral unterschiedlichen Löhnen die Arbeiter solange in den besser bezahlenden Sektor wechseln würden, bis sich die Unterschiede ausgeglichen haben. Gleichung (1.1.2) entspricht somit dem Preisverhältnis ohne Außenhandel und sagt aus, dass die relativen Güterpreise den relativen Produktionskosten entsprechen.
Was würde passieren, wenn sich die Ökonomie für den Welthandel öffnet und der Weltmarktpreis dergestalt ist, dass ? Daraus würde folgen, dass . Wenn aber die Arbeiter*innen in jenem Sektor arbeiten, in dem der Lohn höher ist, dann wird im Welthandel nur in einem Sektor produziert. Die Ökonomie wird sich daher auf jenes Gut spezialisieren, für das das Preisverhältnis günstiger ist als der nötige Arbeitsaufwand, d.h. bei auf die Produktion von Wein und vice versa. Anders formuliert: Betreibt eine Ökonomie Handel und richtet sich nach den Weltmarktpreisen, so wird sie sich in einer Marktwirtschaft automatisch auf jenes Gut mit dem für sie günstigeren Preisverhältnis spezialisieren.
Absolute und komparative Vorteile
In einem Szenario mit Außenhandel lassen sich die nötigen Arbeitseinsatzverhältnisse vergleichen. Im Folgenden werden die Ökonomien in Anlehnung an Ricardo mit wie England und wie Portugal bezeichnet. Es lassen sich zwei Konzepte unterscheiden:
- Wenn eine Ökonomie 1 EH eines Guts mit weniger Arbeitseinsatz produzieren kann als eine andere Ökonomie, dann hat die erste Ökonomie einen absoluten Vorteil bei der Produktion dieses Guts.
- Wenn eine Ökonomie 1 EH eines Guts mit geringeren Opportunitätskosten produzieren kann als eine andere Ökonomie, dann hat die erste Ökonomie einen komparativen Vorteil bei der Produktion dieses Guts.
Der Unterschied kann durch folgendes Beispiel veranschaulicht werden: Wenn die oben beschriebene Ökonomie repräsentiert, so lassen sich die Variablen umformulieren als , und . Angenommen seien für die folgenden Werte: , und . Daraus folgt, dass einen absoluten Vorteil bei der Produktion beider Güter hat, da und : Die gleiche Menge beider Güter kann in mit weniger Arbeitsaufwand produziert werden als in .
Der relative Arbeitsaufwand ist jedoch unterschiedlich, da : Für die gleiche produzierte Menge von muss in auf mehr verzichtet werden als in . Diese Ungleichung lässt sich umformen zu , wodurch das Kostenverhältnis ausgedrückt wird. Daraus folgt, dass einen komparativen Vorteil bei der Produktion von hat, und vice versa.
Es ist wichtig, zu betonen, dass der komparative Vorteil nur identifiziert werden kann, wenn alle vier Arbeitseinsatzkosten bekannt sind. Werden lediglich die Arbeitseinsatzkosten für ein Gut zweier Länder verglichen, so erfährt man nur den absoluten Vorteil. Wie im Folgenden gezeigt wird, sind für den Handel die komparativen Vorteile von Bedeutung, aus den absoluten Vorteilen können hingegen keine Schlüsse bzgl. der Handelsströme gezogen werden. Das dennoch zu tun, ist einer der häufigsten Fehler bei der Interpretation des Welthandels und entsprechenden Schlussfolgerungen für die Handelspolitik.
Entstehen von Handel
Durch Handel werden die Preise auf den Gütermärkten nicht mehr nur durch die Arbeitseinsatzverhältnisse innerhalb der jeweiligen Länder bestimmt, sondern vom Handel selbst beeinflusst. Gerade beim Handel ist wichtig, die Gütermärkte gemeinsam zu betrachten, da sie sich durch die komparativen Vorteile gegenseitig beeinflussen. Die folgende Abbildung zeigt die Kurven des relativen Weltangebots und der relativen Weltnachfrage nach Tuch relativ zu Wein als Funktion der Preisverhältnisse von Tuch relativ zu Wein: Je höher der relative Preis von Tuch, umso niedriger die nachgefragte Menge, skizziert durch die Kurve N. Je höher der Preis von Tuch relativ zu Wein, umso höher auch das Angebot, skizziert durch Kurve A.
Wie weiter oben argumentiert, wird sich auf die Produktion von Tuch spezialisieren, wenn . Für gilt das gleiche, wenn . Wenn
, so sind die Arbeiter*innen in Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle P}
indifferent, in welchem Sektor sie arbeiten – bei diesem Verhältnis wird in Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle P}
beides zu beliebig variierbaren Mengen produziert, im Diagramm wird die Angebotskurve daher an dieser Stelle flach, und analog bei Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle \frac{p_{c}}{p_{w}} = \frac{a_{c}^{E}}{a_{w}^{E}}}
für Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle E}
. Wenn der Weltmarktpreis unter den Punkt Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle \frac{a_{c}^{E}}{a_{w}^{E}}}
fällt, dann gibt es überhaupt kein Angebot an Tuch – niemand ist bereit, zu diesem Preis zu produzieren.
Der entscheidende Bereich in der oberen Abbildung liegt zwischen den beiden markierten Punkten der Achse der Preisverhältnisse: Wenn Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle \frac{p_{c}}{p_{w}} > \frac{a_{c}^{E}}{a_{w}^{E}}} , wird sich Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle E} auf Tuch spezialisieren. So lange jedoch Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle \frac{p_{c}}{p_{w}} < \frac{a_{c}^{P}}{a_{w}^{P}}} , wird sich Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle P} auf die Produktion von Wein spezialisieren. Die in diesem Bereich von Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle P} produzierte Menge beträgt Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle \frac{L^{P}}{a_{w}^{P} = 10}} EH Wein und die von Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle E} produzierte Menge beträgt Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle \frac{L^{E}}{a_{c}^{E} = 10}} EH Tuch. Die relative Menge an Tuch, die insgesamt produziert wird, ergibt sich aus der Produktion von Tuch dividiert durch die Produktion von Wein, Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle \frac{\frac{L^{E}}{a_{c}^{E}}}{\frac{L^{P}}{a_{w}^{P} = 1}}} .
Beim Schnittpunkt der Kurven N und A produzieren beide Länder daher jenes Gut, bei dem sie einen komparativen Vorteil haben: Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle P} produziert nur Wein, Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle E} produziert nur Tuch. Fällt die Nachfragekurve auf N’, so entspricht der Weltmarktpreis von Tuch Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle \frac{p_{c}}{p_{w}} = \frac{a_{c}^{E}}{a_{w}^{E}}} und somit exakt den Opportunitätskosten von Tuch, ausgedrückt in Wein in Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle E} , und es wird in Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle E} beides produziert, während sich Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle P} völlig auf die Produktion von Wein spezialisiert. Das Gesetz der komparativen Vorteile wird hier besonders deutlich, denn abgesehen von diesem Spezialfall liegt der Weltmarktpreis immer irgendwo zwischen den beiden Preisen, die sich auf autarken Heimmärkten ergeben, und jedes Land spezialisiert sich bei Handel auf jenes Gut, für das es relativ weniger Arbeitseinsatz braucht.
Auswirkungen des Handels
Der Import und Export, der unter den skizzierten Bedingungen (Schnittpunkt der Kurven N und A innerhalb des entscheidenden Bereichs in der oberen Abbildung) stattfindet, übt natürlich auch einen Druck auf die Preise aus. Aus Sicht von Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle E} wird nun Wein aus Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle P} importiert (neues Angebot) und Tuch nach Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle P} exportiert (neue Nachfrage) – und vice versa für Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle P} . Durch das vergrößerte Angebot gibt es einen Druck nach unten für den relativen Preis von Wein in Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle E} sowie für Tuch in Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle P} . Analog erfolgt ein Druck nach oben für die relativen Preise von Wein in Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle P} und Tuch in Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle E} . Abgesehen vom Fall, in dem sich eines der Länder nicht vollständig spezialisiert, wird der relative Preis für Wein am Weltmarkt stets zwischen den relativen Preisen unter Autarkie liegen:
Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \frac{a_{c}^{E}}{a_{w}^{E}} < \frac{p_{c}}{p_{w}} < \frac{a_{c}^{P}}{a_{w}^{P}}\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ (1.1.3)}
wobei sich mit den Variablenwerten Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle a_{c}^{P} = 1} , Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle a_{w}^{P} = 2} , Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle a_{c}^{E} = 2} , Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle a_{w}^{E} = 8} ein kritischer Bereich von Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle \frac{0,25 < p_{c}}{p_{w}} < 0,5} ergibt. Das Modell hat somit gezeigt, dass Ökonomien mit unterschiedlichen Produktivitätsniveaus sich spezialisieren werden – nämlich auf jenes Gut, bei dem sie einen komparativen Vorteil haben.
Inwieweit beide Ökonomien davon profitieren, kann auf zweierlei Arten gedacht werden. Die erste Weise bezieht sich auf die Produktion: Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle P} könnte Tuch auch direkt selbst produzieren, aber indem es Wein exportiert, kann Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle P} Tuch gewissermaßen indirekt „produzieren“, indem es zuerst Wein tatsächlich herstellt und dann gegen Tuch mit Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle E} tauscht. Dass diese Methode der „indirekten Tuchproduktion“ für Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle P} vorteilhafter weil effizienter ist, kann man erkennen, indem man den jeweils nötigen Arbeitsaufwand vergleicht.
Einerseits kann Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle P} eine Arbeitsstunde verwenden, um Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle \frac{1}{a_{c}^{P}} = 1} EH Tuch direkt zu produzieren. Andererseits kann Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle P} diese Arbeitsstunde benutzen, um Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle \frac{1}{a_{w}^{P}} = 0,5} EH Wein zu produzieren. Dieser Wein kann dann verwendet werden, um ihn mit Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle E} gegen Tuch zu tauschen. Am Weltmarkt wird Wein zum relativen Preis Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle \frac{p_{w}}{p_{c}}} gehandelt, d.h. 1 EH Wein wird gegen Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle \frac{p_{w}}{p_{c}}} EH Tuch getauscht. Daraus ergibt sich, dass eine Arbeitsstunde in Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle P} nun Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle \left( \frac{p_{w}}{p_{c}} \right)\left( \frac{1}{a_{w}^{P}} \right)} EH Tuch einbringt. Damit erhält Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle P} mehr Tuch, als wenn es Tuch selbst produziert hätte, solange die aus Ungl. (1.1.3) abgeleitete Bedingung Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle \frac{p_{w}}{p_{c}} > \frac{a_{w}^{P}}{a_{c}^{P}}} erfüllt ist. Sind bspw. Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle p_{w} = 3} und Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle p_{c} = 1} , so kann Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle P} mit gleichem Einsatz 1,5mal so viel Tuch „produzieren“ wie ohne Handel.
In einer Welt ohne Handelsbilanzdefizite kann ein Land grundsätzlich nur konsumieren, was es produziert. Die zweite Weise zu zeigen, wie Länder vom Handel profitieren, liegt in der Betrachtung des Konsums. Folgende Abbildungen zeigen die erweiterten Konsummöglichkeiten für beide Länder, wobei die durchgehenden Kurven den möglichen Konsum ohne Handel, die strichlierten Kurven den Konsum mit Handel anzeigen. Das linke Diagramm zeigt, wie sich der potenzielle Tuch-Konsum in Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle P} bei Handel erhöht, mit den bisher angenommenen Variablen von Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle \frac{L^{P}}{a_{c}^{P}} = 20} auf Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle \left( \frac{p_{w}}{p_{c}} \right)\left( \frac{L^{P}}{a_{w}^{P}} \right) = 30} EH Tuch, was einem Wachstum von 50% entspricht. Das rechte Diagramm zeigt analog den Anstieg des potenziellen Wein-Konsums in Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle E} , in diesem Fall von Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle \frac{L^{E}}{a_{w}^{E}} = 2,5} auf Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle \left( \frac{p_{c}}{p_{w}} \right)\left( \frac{L^{E}}{a_{c}^{E}} \right) = 3,33} , was 33,3% Wachstum entspricht. In beiden Diagrammen repräsentieren die Flächen zwischen den beiden Kurven die jeweiligen Güterbündel, die unter Handel erzielbar sind und unter Autarkie nicht erreicht werden können. [5] Aus diesem Grund kann gesagt werden, dass es den Konsument*innen mit Handel besser gehen muss als ohne Handel, weil sie mehr konsumieren können.
Implikationen
Vergleicht man die Ergebnisse unter Handel und unter Autarkie, so folgt erstens, dass in Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle P} ausschließlich Wein produziert wird, obwohl Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle P} im Vergleich zu Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle E} auch Tuch billiger produzieren kann (d.h. einen absoluten Vorteil genießt) und konsequenterweise in Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle E} ausschließlich Tuch produziert wird, weil Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle E} im Vergleich zu Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle P} bei diesem Gut niedrigere Opportunitätskosten hat (d.h. einen komparativen Vorteil genießt). Zweitens kann nun in beiden Ländern bei gleichem Arbeitsaufwand mehr konsumiert werden, und zwar auch in jenem Land, das aufgrund seiner technologischen und/oder natürlichen Ressourcen unterlegen ist (hier: Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle E} ).
Aus dem Modell heraus lassen sich auch die relativen Löhne der Arbeiter*innen in beiden Ländern berechnen. In der Beispielrechnung arbeiten alle Arbeiter*innen in Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle P} konsequenterweise in der Weinproduktion, und alle Arbeiter in Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle E} in der Tuchproduktion. Da es 2 AE braucht, um 1 EH Wein zu produzieren, beträgt der Lohn je AE in Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle P} , Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle \omega^{P}} , den Gegenwert von 0,5 EH Wein, aus der Beispielrechnung ergibt sich somit Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle \omega^{P} = 1,5} . Analog ergibt sich Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle \omega^{E} = 0,5} , da dies dem Gegenwert der Tuchproduktion je AE in Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle E} entspricht. Ein*e Arbeiter*in in Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle P} verdient somit dreimal so viel wie ein*e Arbeiter*in in Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle E} .
Zu beachten ist, dass der relative Lohn zwischen den Verhältnissen der beiden Ökonomien in den beiden Sektoren liegt: Arbeiter*innen in Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle P} sind bei Wein 4-mal so produktiv wie jene in Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle E} , aber nur 2-mal so produktiv bei Tuch. Der Lohn ist 3-mal so hoch, wie oben berechnet. Gerade weil der relative Lohn zwischen den beiden relativen Produktivitätsniveaus liegt, haben beide Länder einen Kostenvorteil für jeweils ein Gut: Aufgrund seines niedrigeren Lohnniveaus hat Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle E} einen Kostenvorteil bei der Produktion von Tuch, obwohl die Produktivität niedriger ist. Analog hat Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle P} einen Kostenvorteil bei Wein, obwohl das Lohnniveau höher ist: Der höhere Lohn wird durch die höhere Produktivität mehr als kompensiert.
Dass trotz des niedrigeren Lohns die Arbeiter*innen in Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle E} vom Handel profitieren, lässt sich anhand dessen demonstrieren, was sie sich vorher und nachher leisten können: Unter Autarkie können mit dem Lohn für eine Arbeitseinheit 0,5 EH Tuch oder 0,125 EH Wein erworben werden, oder beliebige Güterbündel im Austauschverhältnis 4:1. Mit Handel kann mit dem Lohn für eine Arbeitseinheit immer noch 0,5 EH Tuch oder nun 0,167 EH Wein erworben werden, oder beliebige Güterbündel im Austauschverhältnis 3:1.
Diese Werte gelten freilich für den*die durchschnittlichen Arbeiter*in und werden aus diesem Grund auch durch die Diagramme in den oberen Abbildungen repräsentiert. Es stellt sich als letzte Frage, wie es um den Nutzen von Arbeiter*innen in Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle P} bestellt ist, die lieber Wein konsumieren, da der Preis von Wein relativ zu Tuch nun höher ist? Im konkreten Beispiel hat sich der Weinpreis von 2 auf 3 GE erhöht. Die Antwort liegt einerseits im obigen Absatz, da entscheidend ist, was eine Arbeitseinheit kaufen kann: Das war vor und nach der Öffnung für Handel eine 0,5 EH Wein. Ein*e Arbeiter*in, der*die nur Wein konsumiert (und nur dieser!), ist daher zwar nicht besser, aber auch nicht schlechter gestellt. Alle anderen können nun bei gleichem Weinkonsum mehr Tuch konsumieren, oder von beidem mehr konsumieren.
Eine Umrechnung in das Bruttoinlandsprodukt zeigt schließlich, wie durch den Handel beide Länder Wirtschaftswachstum erfahren: Angenommen, beide Länder haben unter Autarkie jeweils die Hälfte der Ressourcen für die Produktion der beiden Güter eingesetzt. Dann betrug das BIP zu Weltmarktpreisen in Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle P} unter Autarkie Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle p_{w}\left( \frac{\left( \frac{L^{P}}{2} \right)}{a_{w}^{P}} \right) + p_{c}\left( \frac{\left( \frac{L^{P}}{2} \right)}{a_{c}^{P}} \right)} , was mit den eingesetzten Variablenwerten 25 GE entspricht. Nach der Öffnung für Handel und der Spezialisierung auf die Weinproduktion beträgt das BIP Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle p_{w}\left( \frac{L^{P}}{a_{w}^{P}} \right)} und somit 30 GE. Für Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle E} ergeben sich analog die Werte von 8,75 GE und 10 GE.
Handelspolitik
Wie bei so vielen Fragen in den Sozial- und Wirtschaftswissenschaften gibt es gerade beim Außenhandel bei vielen Antworten ein sowohl-als-auch. Das Ricardo-Modell zeigt eindrucksvoll, warum Ökonomien vom Handel profitieren, wobei das zugrundeliegende Prinzip so zu verstehen ist: Der Schlüssel liegt im Prinzip der Arbeitsteilung, wonach jeder machen soll, was er am besten kann. Wie für Mitarbeiter*innen eines Betriebs gilt das auch für die Weltwirtschaft und folgt damit dem Grundprinzip allen ökonomischen Denkens, nämlich jenem des geringsten Aufwands zur Erreichung eines bestimmten Ziels, oder – gleichlautend – die Maximierung des Ertrags bei gleichem Aufwand. Wie gezeigt wurde, wird in der Welt mit Handel bei gleichem Arbeitseinsatz mehr produziert, und somit ist mehr für alle da. Dennoch gibt es Einwände gegen internationalen Handel, manche basieren auf Missverständnissen, manche sind berechtigt. Von entsprechender Bedeutung sind Instrumente zur Steuerung des Außenhandels, von denen das wichtigste Instrument Zölle darstellen. Sie führen in der Regel zu Wohlfahrtsverlusten, können unter Umständen dennoch sinnvoll sein.
Die Bedeutung des Ricardo-Modells
Gerade das Ricardo-Modell ist ein gutes Beispiel dafür, wie häufig zu hörende Argumente in der öffentlichen Diskussion relativ leicht widerlegt werden, wenn man sich mit dem Sachverhalt auseinandersetzt. Drei Aussagen begegnet man dabei besonders häufig:
- Aussage 1: „Freier Handel lohnt nur dann, wenn das eigene Land stark genug ist, um gegenüber ausländischem Wettbewerb zu bestehen.“
- Dahinter steht die Annahme, dass eine Ökonomie, die alles teurer produziert als eine andere, im Freihandel zwangsläufig untergehen müsse. Doch dieses Argument ist in etwa so zutreffend wie die Vorstellung, dass zwei Personen eine beliebige Arbeit nur dann sinnvoll aufteilen können, wenn jede*r bei zumindest einer Tätigkeit besser ist als der*die andere. Es ist nicht schwierig, sich vorzustellen, dass eine Person sowohl Tätigkeit A und Tätigkeit B besser verrichten kann als eine andere Person. Heißt das, dass die Zusammenarbeit produktiver wird, wenn die zweite Person gar nichts tut? Wohl kaum! Der Schlüssel liegt folglich darin, zu verstehen, dass auch eine Ökonomie, die in allem besser ist, davon profitiert, Tätigkeiten auszulagern, in denen sie komparativ schlechter ist. Analog profitiert auch eine Ökonomie, die in allem schlechter ist, davon, jene Tätigkeiten auszuführen, in denen sie komparativ besser ist – um dann vom gestiegenen Gesamtprodukt zu profitieren.
- Aussage 2: „Globaler Wettbewerb ist ungerecht und schadet anderen Ländern, wenn er auf niedrigen Löhnen basiert.“
- Dieses Argument ist gerade in der Globalisierungskritik weit verbreitet und bezieht sich häufig auf Lohndumping und damit der Angst, dass niedrig bezahlte Arbeiter*innen im Ausland die Industriearbeit der etablierten Industriestaaten übernehmen. Das Argument hat einen korrekten Ausgangspunkt, da die Verlegung der Industriearbeit tatsächlich ein wesentliches Merkmal der Globalisierung darstellt. Obendrein ist die Ungerechtigkeit hinsichtlich der weltweiten Unterschiede bei Arbeitseinkommen evident. Falsch ist allerdings der Schluss, diese Prozesse wären schädlich – zumindest, wenn man als Kriterium die gesamte Wohlfahrt heranzieht. Wie oben gezeigt wurde, steigt das BIP beider Länder, und somit profitieren sowohl das produktivere wie das weniger produktive Land.
- Aussage 3: „Handel beutet ein Land aus und bringt es in eine schlechtere Position, wenn die Arbeiter*innen in diesem Land niedrigere Löhne erhalten als in anderen Ländern.“
- Dieses Argument taucht unweigerlich auf, wenn man sich etwa die Löhne und Arbeitsbedingungen von Näherinnen in Bangladesch ansieht und sie mit dem eigenen Lohn vergleicht. Richtig ist aus marxistischer Sicht, dass Arbeiter*innen ausgebeutet werden und unbestritten ist wohl, dass irgendjemand in den importierenden Ländern vom Handel profitiert, denn sonst fände er nicht statt; das Argument hat allerdings zwei Schwächen. Erstens ist nicht zu sehen, inwieweit die Ausbeutung auf niedrigerem Niveau sich qualitativ von jener auf höherem Niveau unterscheidet. Anders formuliert: Wenn eine Näherin in Bangladesch durch eine in Österreich ersetzt wird (oder umgekehrt), inwieweit ändert sich das Grundprinzip der Ausbeutung? Es ändert sich gar nicht, es findet nur auf unterschiedlichem Niveau statt, entsprechend den Entwicklungsniveaus der jeweiligen Ökonomien. Zweitens wird übersehen, dass sich – wie in der Einleitung zu Lektion 1.1 besprochen – die meisten Länder, die von niedrigen Löhnen geprägt sind, freiwillig geöffnet haben, um diese Arbeiten durchzuführen. Das Ricardo-Modell zeigt, dass sich auch die Konsument*innen im weniger produktiven Land nach der Öffnung mehr Güter leisten können.
Die begrenzte Aussagekraft des Ricardo-Modells
So schlüssig die aus dem Ricardo-Modell abgeleiteten Gegen-Gegen-Freihandels-Argumente auch sein mögen, sie haben ihrerseits Schwächen. Im Sinne der Erkenntnis ist die erste Entwicklungsstufe, das Ricardo-Modell zu verstehen und die zweite, seine Limitationen zu erkennen. Das Grundproblem des Ricardo-Modells ist dabei, dass es seinem Wesen nach statisch ist: Zwei Ökonomien werden beschrieben und ändern sich nicht. Als wichtigstes Gegen-Gegen-Gegen-Freihandels-Argument genügt ein schlichter Verweis auf die Geschichte: Die heute führenden, exportorientierten Industriestaaten – Deutschland, Japan, USA – haben ihre Wirtschaft zunächst abgeschottet, bevor sie eine international konkurrenzfähige Industrie aufbauten. Auch die Republik Korea als letzter (und seit Japan einziger) Neuling im exklusiven Klub reicher Nationen, die ihren Wohlstand auf einer exportorientierten Industrie aufgebaut haben, schottet ihre Wirtschaft bis heute in vielen Bereichen vor ausländischer Konkurrenz ab. Gar nicht zu reden von Ökonomien, die zu diesem Klub zumindest temporär aufgeholt (aber ihn noch lange eingeholt) haben wie etwa die Sowjetunion in den 1950er- und 1960er-Jahren, oder aktuell die Volksrepublik China seit den 1990er-Jahren.
Allgemeiner formuliert liegt die erste Schwäche des Ricardo-Modells darin, dass es impliziert, dass die Ökonomien ihre Rollen einnehmen und darin verharren – und Entwicklungsländer für immer Entwicklungsländer bleiben. Skeptisch sollte in diesem Zusammenhang machen, dass die etablierten Industriestaaten seit dem 19. Jahrhundert bis heute den globalen Freihandel mitunter auch mit Gewalt durchsetzen. Wenn sich wirtschaftlich schwache Länder wie Bulgarien oder Rumänien dem Gemeinsamen Markt der EU anschließen, so ist dies nicht zwangsläufig ein Beleg für die Richtigkeit der aus dem Ricardo-Modell abgeleiteten Argumente, sondern zeigt bloß, dass in diesem bestimmten Fall die Vorteile der Mitgliedschaft gegenüber der Nicht-Mitgliedschaft überwiegen. Aus dem Ricardo-Modell den Schluss ziehen zu wollen, dass Bulgarien und Rumänien allein dank des innereuropäischen Freihandels dereinst zu reichen Ländern würden, ist aufgrund des statischen Charakters des Modells jedenfalls nicht zulässig! Bezeichnend ist in diesem Kontext, dass sehr große und mächtige Länder – meistens zum Missfallen der etablierten Industriestaaten – in der Regel ihre eigenen Wege der Entwicklung suchen und häufig unter großen Opfern auch durchsetzen, bspw. die China, Indien, Iran, Russland. Dass die Volksrepublik China im letzten Vierteljahrhundert sehr stark vom Außenhandel profitiert hat, heißt eben nicht, dass es noch mehr profitierte, wenn es die Kontrolle völlig aufgäbe.
Die Statik des Ricardo-Modells ignoriert zweitens die Kosten, die durch Anpassung entstehen. Öffnet sich eine Ökonomie und stellt ihre Wirtschaft entsprechend der komparativen Vor- und Nachteile um, so passiert dies nicht von heute auf morgen. Vielmehr werden jene Branchen, in denen die Ökonomie von komparativen Nachteilen betroffen ist, von Pleiten und Arbeitsplatzverlust gekennzeichnet sein. Im Modell passiert die Anpassung ohne Übergangszeit, in der realen Welt kann sie für Individuen lebenslange Arbeitslosigkeit nach sich ziehen, mit den entsprechenden Folgen für die Gesellschaft. Ein besonders prägnantes Beispiel ist der Niedergang der Industrie im Gebiet der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik (DDR), die im Zuge der deutschen Vereinigung praktisch über Nacht der Konkurrenz der gesamten Europäischen Gemeinschaft ausgesetzt war. Hohe Arbeitslosigkeit, Bevölkerungsrückgang und Deindustrialisierung mögen im Gebiet der ehemaligen DDR noch verkraftbar sein, weil sie innerhalb Deutschlands passieren und durch innerdeutsche Transfers erheblich abgemildert werden. Allerdings waren alle RGW-Staaten mit vergleichbaren Problemen konfrontiert, die zwar zumeist langsamer abliefen als im Fall der DDR, von denen sich einige jedoch bis heute nicht erholt haben; Länder wie Tadschikistan oder die Ukraine haben bis heute nicht das Produktions- und Wohlstandsniveau erreicht, dass sie vor ihrer Öffnung im Zuge der Auflösung der Sowjetunion bereits hatten.
Ein dritter, vom Ricardo-Modell ausgeklammerter Effekt, der jedoch ein wesentliches Merkmal der Globalisierung darstellt, ist die Frage, was mit den erzielten Wohlfahrtsgewinnen passiert. So zeigt die Entwicklung der USA im letzten Vierteljahrhundert, die von einem starken Rückgang des Anteils der Industrie gekennzeichnet ist, dass viele vergleichsweise gut bezahlte Arbeitsplätze im industriellen Sektor durch vergleichsweise schlecht bezahlte Arbeitsplätze im Dienstleistungssektor ersetzt wurden. Gleichzeitig hat sich der Anteil der Unternehmensgewinne am Volkseinkommen deutlich erhöht. [6] Offensichtlich hat sich in den USA im Rahmen der Globalisierung die Verteilung des Wohlstands zugunsten des Kapitals verschoben. Diese Entwicklung widerlegt nicht die Aussage des Ricardo-Modells, sie zeigt allerdings seine Grenzen auf: Im Ricardo-Modell sind die Arbeiter zugleich die Eigentümer der Produktionsfaktoren, da es nur den Faktor Arbeit gibt. In der realen Welt spielen freilich auch Machtverhältnisse eine große Rolle, und die jüngere Geschichte zeigt, dass vom Freihandel verschiedene Gruppen innerhalb der Gesellschaften unterschiedlich betroffen sind. [7]
Zölle
Zölle gehören zu den ältesten wirtschaftspolitischen Instrumenten und lassen sich bis ins Altertum rückverfolgen. Ihre Bedeutung geht zwar seit dem GATT zurück, dennoch sind sie auch heute allgegenwärtig und eine wichtige staatliche Einnahmenquelle. [8] Bei einem Zoll handelt es sich aus ökonomischer Sicht schlicht um eine Steuer auf ein importiertes Gut. Man unterscheidet:
- Spezifische Zölle: Diese werden in einer festen Höhe auf jede importierte Gütereinheit erhoben (z.B. 1 GE je EH Wein).
- Wertzölle: Diese werden anteilig auf den Wert des Güterimports erhoben (z.B. 25% auf den Warenwert des eingeführten Weins).
Für Konsument*innen sind die Auswirkungen analog zu indirekten Steuern: Sie reduzieren die Konsumentenrente und verlagern den Konsum auf andere, weniger hoch besteuerte Güter. Der Lenkungseffekt wird offensichtlich, da nach Einführung eines Zolls auf ein bestimmtes Gut andere Güter vermehrt konsumiert werden. Handelt es sich dabei um die Produkte einheimischer Anbieter*innen, so können Letztere ihre Preise anheben und die Produktion ausweiten. Aus Sicht der ausländischen Anbieter*innen können Zölle mit Transportkosten verglichen werden: Man ist auf einem Exportmarkt nur dann konkurrenzfähig, wenn man zum Preis der einheimischen Anbieter*innen zuzüglich der Transportkosten seine Produkte anbieten kann.
Angenommen, ein homogenes Gut x wird von zwei Ländern A und B produziert und auf beiden Märkten angeboten. Der Anpassungsprozess nach der Einführung eines Zolls in der Höhe von t GE auf Gut x in A auf Angebot und Nachfrage in A und B lässt sich wie folgt skizzieren: Der Zoll erhöht aus Sicht von Land B die Transportkosten und das Gut wird von dort nur dann weiterhin exportiert werden, wenn es auch nach Einführung des Zolls in Land A konkurrenzfähig ist. Ist das nicht der Fall, ergibt sich in Land A ein Nachfrageüberhang, was den Preis in Land A erhöht, und ein Angebotsüberhang in Land B, was den Preis in Land B reduziert – dieser Prozess setzt sich fort, bis der Preisunterschied genau t GE beträgt: Er ist brutto in Land A um t GE höher als der Nettopreis, der zugleich der Preis in Land B ist.
Der weitere Verlauf: In Land A erhöhen die Produzent*innen als Folge des gestiegenen Preises ihr Angebot. Der höhere Preis führt aber zugleich dazu, dass die Nachfrage in Land A sinkt. In Land B ist der Effekt umgekehrt: Die Produzent*innen reduzieren als Folge des gesunkenen Preises ihr Angebot, und die Nachfrage in Land B steigt. Der Preisanstieg in Land A ist geringer als t, weil zugleich der Nettopreis der Importe durch die Anpassung in Land B gesunken ist. Anders formuliert schlägt sich der Zoll nur im Ausmaß t* < t für die Konsument*innen in Land A nieder.
Betrachtet werde nun ein weiteres Land C, das so klein ist, dass der Effekt der Einhebung eines Zolls auf die Preise im Ausland vernachlässigbar ist. Die Analyse reduziert sich dann auf die Auswirkungen auf Land C, wo sich der Preis von Gut x in vollem Ausmaß t erhöht. Die Produktion von Gut x in Land C steigt aufgrund des höheren Preises, während die Importe im selben Ausmaß zurückgehen.
Die obigen Abbildungen illustrieren diese Zusammenhänge, im 1. Diagramm zunächst für ein kleines Land: Durch die Einführung des Zolles entsteht im Land ein neues Gleichgewicht von Angebot S und Nachfrage D, es verschiebt sich von Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle p^{C}} auf Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle p^{C} + t} . Das Angebot der Inlandsproduktion erhöht sich durch den neuen Preis von Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle S} auf Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle S'} , während die Nachfrage von Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle D} auf Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle D'} zurückgeht. Zugleich geht die importierte Menge zurück: Betrug sie vor Einführung des Zolls Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle D - S} , beträgt sie nun Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle D' - S'} . Von besonderem Interesse sind die Flächen a, b, c und d, welche Kosten und Nutzen für unterschiedliche Gruppen darstellen. [9]
Die Konsumentenrente entspricht der gesamten Fläche unterhalb der Nachfragekurve und über dem Preis. Vor Einführung des Zolls entsprach die Konsumentenrente jener Fläche, die oben von der Nachfragekurve und unten vom Preis Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle p^{C}} begrenzt wird. Nach Einführung umfasst sie jetzt nur noch die Fläche, die oben von der Nachfragekurve und unten vom Preis Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle p^{C} + t} begrenzt wird. Durch den Preisanstieg schrumpft die Konsumentenrente daher um die Fläche a + b + c + d.
Die Produzenten in Land C hingegen profitieren vom höheren Preis, was sich in einem Anstieg der Produzentenrente niederschlägt. Die Produzentenrente entspricht der Fläche über der Kurve S und unter dem Marktpreis, sie wächst daher um die Fläche a. Der Staat wiederum profitiert von den Zolleinnahmen, welche sich auf das Importvolumen multipliziert mit Zollsatz Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle t} belaufen. Da das Importvolumen von Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle D - S} auf Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle D' - S'} schrumpft, entsprechen die Zolleinnahmen der Fläche c. Der Gesamteffekt für ein kleines Land ist somit eindeutig negativ: Dem Anstieg der Produzentenrente a und der Steuereinnahmen c steht der Verlust der Konsumentenrente a + b + c + d gegenüber, der Nettowohlfahrtsverlust des Zolls entspricht somit der Summe der Flächen b + d.
Anders sieht die Situation für ein großes Land A aus, die im 2. Diagramm abgebildet ist. Durch den Einfluss auf die Gesamtnachfrage ausländischer Produzent*innen sinkt der Auslandsexportpreis auf Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle p*} . Die Einnahmen des Staates werden daher um die zusätzliche Fläche e erhöht: Die Differenz zwischen dem Nettoimportpreis Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle p*} und dem Bruttomarktpreis Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle p* + t} ist größer als jene zwischen dem alten Marktpreis Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle p^{A}} und Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle p* + t} . Der Gesamtwohlfahrtseffekt eines Zolls ist nicht eindeutig, da dem Verlust an Konsumentenrente unter Umständen höhere Steuereinnahmen gegenüberstehen.
An dieser Stelle sei das Konzept der Terms of Trade (reales Tauschverhältnis) definiert: Sie entsprechen dem Verhältnis von Export- zu Importpreisen und geben somit an, wie viele Güter ausgeführt werden müssen, um eine bestimmte Menge von Gütern einführen zu können. Für ein großes Land kann die Einführung eines Zolls daher zu Terms-of-Trade-Gewinnen führen, da sich die Auslandsexportpreise reduzieren und importierte Güter somit netto billiger werden. Ein kleines Land hat diese Möglichkeit nicht und es überwiegt der nachteilige Effekt für die Konsument*innen.
Exportsubventionen
Hierbei handelt es sich um eine Zahlung für die Lieferung eines Guts ans Ausland. Ebenso wie spezifische Zölle können sie nach exportierten Mengen, oder analog zu Wertzöllen nach einem Anteil des Exportwerts bestimmt werden. Der*die Anbieter*in wird reagieren, indem er*sie das Gut so lange exportiert, bis der Inlandspreis den Auslandspreis um die Höhe der Subvention übersteigt.
Der Effekt ist somit umgekehrt wie bei einem Zoll: Im Inland kommt es zu einem Nachfrageüberhang und einer Preiserhöhung, im Ausland zu einem Angebotsüberhang und einer Preissenkung. Folgende Abbildung skizziert die Effekte für ein großes Land: Durch die Ausweitung der Produktion steigt der Preis im Exportland von Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle p^{A}} auf Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle p^{s}} . Gleichzeitig sinkt jedoch durch die vermehrten Importe der Preis im Importland, weshalb die gesamte Preiserhöhung geringer ausfällt als die Höhe der Subvention Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle t} . Die Differenz zwischen dem neuen Preis im Exportland, Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle p^{s}} , und dem neuen Preis im Importland, Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle p^{s} - t} , entspricht der Höhe der Subvention.
Die Konsumenterente im Exportland entspricht wie in obiger Abbildung der Veränderung der Fläche unterhalb der Nachfragekurve S und über dem jeweiligen Preis, in der oberen Abbildung verringert sie sich im Exportland folglich um a + b. Demgegenüber steht eine Zunahme der Produzentenrente a + b + c. Die Kosten der staatlichen Subvention entsprechen dem Exportvolumen mal der Subventionshöhe; in der Abbildung entspricht das Exportvolumen Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle S - D} , die Höhe der Subventionen Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle p^{s} - \left( p^{s} - t \right) = t} , die Kosten somit den Flächen b, c, d, e, f und g. Der gesamte Wohlfahrtseffekt ergibt sich aus den Veränderungen der Produzentenrente, der Konsumentenrente und den staatlichen Ausgaben, somit Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle a+b+c-(a+b)-(b+c+d+e+f+g)=-(b+d+e+f+g)} . Der Effekt ist daher eindeutig negativ, wobei b und d denselben Verzerrungseffekt hinsichtlich Konsum und Produktion entsprechen wie bei der Einführung von Zöllen. Darüber hinaus verschlechtert sich das reale Tauschverhältnis, da der Preis des exportierten Gutes auf den Auslandsmärkten sinkt, während er im Inland steigt; dieser Verlust entspricht den Flächen Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle e\ + \ f\ + \ g} .
Eine Variante der Exportsubventionen sind Exportkreditförderungen. In diesem Fall erhält der*die Käufer*in des Guts einen geförderten Kredit, was den Erwerb für ihn*sie vergünstigt. Die Effekte sind ähnlich, da der Staat für die Kosten des Kredits zu vergünstigten Konditionen aufkommen muss.
Importquoten
Wird die Menge, die von einem Gut importiert wird, begrenzt, spricht man von einer Importquote. Der Effekt für die Konsument*innen ist analog zur Einführung von Zöllen, der Wirkungskanal läuft jedoch anders: Eine Importquote reduziert das Angebot, wodurch sich die Preise erhöhen. Die inländischen Anbieter*innen werden ihre Produktion entsprechend ausweiten, bis der entstandene Nachfrageüberhang gedeckt ist. In den zwei Abbildungen über der obigen Abbildung würde also nicht die Steuer eingeführt werden, sondern die importierte Menge direkt begrenzt werden, das Importvolumen schrumpft von Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle D - S} auf Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle D' - S'} , der Preis erhöht sich entsprechend.
Für die Konsument*innen ist der Effekt einer Importquote damit gleich eines Zolls, der wesentliche Unterschied ist jedoch, dass mit einer Importquote keine Steuereinnahmen verbunden sind. Ist der Importeur nicht der Staat selbst, sondern vergibt der Staat Lizenzen an Unternehmen, die das Gut importieren dürfen, so werden diese das Gut zum Weltmarktpreis einkaufen und zum höheren Inlandspreis verkaufen. Die Fläche c in Abb. 1.4 entspricht somit nicht mehr Steuereinnahmen, sondern Renten für die Importeure! Vergibt der Staat die Lizenzen direkt an ausländische Unternehmen, so kommt es zu einem Transfer ins Ausland, da die Fläche c jenen ausländischen Unternehmen zugutekommt. Abgesehen von Fall eines staatlichen Importmonopols sind die gesamtwirtschaftlichen Kosten einer Quote somit wesentlich höher als jene eines Zolls.
Importquoten lassen sich auch in folgenden Varianten beobachten:
- Freiwillige Exportbeschränkungen: In diesem Fall verpflichtet sich das exportierende Land, die Ausfuhr eines Gutes mengenmäßig zu beschränken. Für das importierende Land ist der Effekt der gleiche wie bei einer Importquote, da das Importvolumen reduziert wird. Die Lizenzvergabe erfolgt hier an ausländische Unternehmen oder Regierungen, welche analog die der Fläche c in Abb. 1.4 entsprechenden Gelder einnehmen. Freiwillige Exportbeschränkungen führen als Folge der höheren Preise daher nicht nur zu einer Reduktion der Konsumentenrente im importierenden Land, sondern außerdem zu einem Einkommenstransfer in das exportierende Land.
- Local-Content-Klauseln: Sie schreiben vor, dass ein bestimmter Anteil des Endprodukts aus inländischer Herstellung stammen muss. Local-Content-Klauseln betreffen damit v.a. die Produktion von Zwischengütern. Folglich haben sie für die Anbieter*innen dieser Güter einen ähnlichen Schutzeffekt wie Importquoten. Ein wichtiger Unterscheid besteht jedoch darin, dass die Hersteller*innen der Endprodukte weiterhin Zwischengüter importieren dürfen, und somit die Importmenge auch erhöhen können, solange sie in gleichem Ausmaß die Menge der im Inland gekauften Zwischengüter erhöhen. Der Kostenaufwand der Hersteller*innen der Endprodukte ergibt sich aus dem Durchschnitt der Preise der importierten und der im Inland produzierten Teile zusammen und wird entsprechend an die Konsument*innen weitergereicht.
- Bevorzugung heimischer Anbieter*innen: Angewendet über staatliche Aufträge oder durch staatliche oder stark regulierte Firmen. Diese können einheimische Zwischengüter oder Endprodukte auch dann kaufen, wenn diese teurer als Importe sind; die Effekte sind ähnlich wie bei Importquoten und Local-Content-Klauseln. Handelt es sich bei den Akteuren um staatliche Unternehmen, so mündet die erhöhte Produzentenrente jedoch über den Umweg der staatlichen Unternehmenstätigkeit in erhöhte Staatseinnahmen.
Argumente gegen den Freihandel
Trotz der Wohlfahrtsgewinne, die sich aus dem Ricardo-Modell ergeben und der Wohlfahrtsverluste, die sich aus Zöllen und anderen Handelsbeschränkungen ergeben, können gute Gründe vorgebracht werden, den Handel zumindest einzuschränken. Ein offensichtliches Argument betrifft den Ablauf des Handels selbst: Der Warentransport durch Europa oder um die ganze Erde führt zu Umweltverschmutzung, und es stellt sich die berechtigte Frage, ob die Kosten der Umweltverschmutzung nicht den Anstieg der Konsumentenrente überwiegen. Das Problem ergibt sich hier allerdings aus einer unzureichenden Steuerpolitik, in der die Kosten der Umweltverschmutzung nicht von jenen getragen werden, die sie verursachen, im Wesentlichen also die Transportunternehmen.
Einschränkungen des Handels sind zu unterscheiden von Politikmaßnahmen, die nur das Inland betreffen, aber geeignet sind, das Produktionsvolumen bestimmter Güter zu verändern und somit das Import- und Exportvolumen der jeweiligen Branchen zu beeinflussen. Dazu zählen die Steuer- und Subventionspolitiken sowie Marktregulierungen. Argumente dafür, den Handel direkt einzuschränken, lassen sich wie folgt zusammenfassen:
- Reales Tauschverhältnis: Wie oben dargestellt, hat ein großes Land durch Einführung eines Zolls die Möglichkeit, den Weltmarktpreis zu beeinflussen. Wie in Abb. 1.4 zu sehen, können bei einem hinreichend geringen Zoll die Terms-of-Trade-Gewinne die durch den Zoll induzierten Verluste überkompensieren. Daraus ergibt sich der jeweiligen Konstellation entsprechend ein Optimalzoll, der die nationale Wohlfahrt maximiert. Das bedeutet u.a. auch für die EU die Sinnhaftigkeit eines Zolls gegenüber Drittstaaten, der auch tatschlich eingehoben wird. Exportsubventionen führen, wie oben dargelegt, zwangsläufig zu einer Verschlechterung der Terms-of-Trade. Allerdings können auch Exportsteuern unter bestimmten Bedingungen die Wohlfahrt erhöhen. So haben bspw. einige Erdöl exportierende Länder diese Erdölexporte mit Steuern belegt und den Preis des Exportguts in einem Ausmaß erhöht, das den dadurch verringerten Absatz überkompensiert hat.
- Marktversagen im Inland: Marktversagen bezeichnet einen Zustand, in dem die Marktmechanismen nicht das gewünschte Ergebnis herbeiführen. Denkbar ist im Bereich des Außenhandels ein Szenario, in dem die zur Verfügung stehende Arbeitskraft nur in einer Branche eingesetzt werden kann und andernfalls brachläge, oder zumindest weniger produktiv eingesetzt würde. Die aus der Deindustrialisierung der USA entstandene Beschäftigung im Dienstleistungssektor ist hierfür ein Beispiel. Ein anderes Beispiel wäre, dass die Produktion eines Gutes externe Effekte hervorbringt, die in einem anderen Sektor eingesetzt werden können, etwa durch die Produktion von Wissen in der Grundlagenforschung.
- Besondere Branchen: Insbesondere der Landwirtschaftssektor genießt in vielen Ländern, darunter Österreich und der EU, einen besonderen Schutz durch mannigfaltige Instrumente. Zwar könnten durch eine Liberalisierung die Nettopreise gesenkt werden und die frei werdenden Mittel, etwa der EU-Agrarförderung, anderweitig eingesetzt werden. Andererseits besteht die Gefahr, als Netto-Importeur*innen von Lebensmitteln vom Ausland abhängig und erpressbar zu werden. Das Hauptargument für den besonderen Schutz des Landwirtschaftssektors ist somit nicht, wie gerne behauptet wird, die Förderung der Landschaftspflege oder der wenigen Bauern*Bäuerinnen, die es in fortgeschrittenen Industriestaaten noch gibt (warum sollten gerade sie geschützt werden?), sondern das Prinzip der Selbstversorgung. Ähnliche Argumente können für bestimmte industrielle Sektoren vorgebracht werden, insbes. der Rüstungsindustrie, oder bei Gütern von kulturellem Wert. [10]
- Erziehungszoll: Dieses Argument besagt im Kern, das ein Land über das Potenzial eines komparativen Vorteils verfügt, dieses aber nicht ausschöpfen kann, da die heimischen Anbieter*innen gegenüber der ausländischen Konkurrenz zurzeit noch nicht wettbewerbsfähig sind. Damit sich die betreffende Branche etablieren kann, müsse sie demnach erst eine Zeit lang geschützt werden, bis sie eine internationale Wettbewerbsfähigkeit aufgebaut hat. Tatsächlich ist es für Entwicklungsländer schwierig, unter ohnehin benachteiligten Bedingungen eine Industrie aufzubauen, die in Industriestaaten bereits etabliert ist. Problematisch ist allerdings, dass es schwierig ist, vorherzusehen, welche Branche in Zukunft einen komparativen Vorteil haben könnte. Da zum Aufbau einer Industriebranche erhebliche Investitionen nötig sind, besteht die Gefahr enormer Ressourcenverschwendung, wenn der Plan nicht aufgeht. Hinzu kommen die Kosten der Übergangszeit, während der das betreffende Gut geschützt ist, da durch Zölle die Konsument*innen höhere Preise für das Gut bezahlen müssen.
Bei allen theoretischen Überlegungen können sowohl Freihandelsbefürworter*innen wie
-gegner*innen jeweils noch ein Hauptargument aus der Praxis ins Spiel bringen. Befürworter*innen können darauf verweisen, dass selbst bei theoretischer Berechtigung protektionistischer Maßnahmen die Gefahr besteht, dass aus politischen Gründen einzelne Interessensgruppen zum Vorzug kommen. Gegner*innen können auf die historischen Entwicklungen der etablierten Industriestaaten verweisen, die sich heute zwar global für den Freihandel einsetzen, ihrerseits freilich einst ihre damals noch jungen Industrien geschützt haben.
Empirische Konzepte
Angesichts der enormen Bedeutung des internationalen Handels im Rahmen der Globalisierung wird die Verflechtung von Volkswirtschaften mit dem Welthandel für ihre weitere Entwicklung immer wichtiger. Verschiedene empirische Konzepte zur Erfassung der Interaktionen einer Volkswirtschaft mit dem Rest der Welt geben Aufschluss über Stärken und Schwächen. Allerdings sollte man vorsichtig sein, die Steigerung des Außenhandels als Ziel an sich zu formulieren. Denn erstens kann eine erfolgreiche Wirtschaftspolitik auch darin bestehen, die Importabhängigkeit bei bestimmten Gütern zu reduzieren und somit das Außenhandelsvolumen zumindest in den betreffenden Branchen einzuschränken. Zweitens besteht als Grundproblem aller statistischen Konzepte zum Außenhandel, dass Vorleistungen nicht abgezogen werden, da Exportstatistiken üblicherweise die Summe aller Produktionswerte inkl. der Vorleistungen angeben.
Außenhandel in der VGR
Das BIP entspricht definitionsgemäß der Bruttowertschöpfung eines Landes, korrigiert um indirekte Steuern und Subventionen. [11] . Da das BIP entgeltliche Transaktionen erfasst, müssen sämtlichen Ausgaben entsprechende Einnahmen gegenüberstehen. Sieht man aus Gründen der Vereinfachung von Veränderungen im Lagerbestand ab (die die Entsprechung von Ausgaben und Einnahmen lediglich verschiebt), so folgt für eine Ökonomie unter Autarkie, dass die Produktion in einer Periode identisch mit der Summe der Konsum- und Investitionsausgaben ist. Man spricht hier auch von der Identität der Entstehungsrechnung (was wird produziert) und der Verwendungsrechnung (was passiert mit den produzierten Gütern). [12] Für eine Handel-treibende Ökonomie muss die Verwendungsrechnung um den Außenhandel erweitert werden. Somit lässt sich das Bruttoinlandsprodukt Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle Y} einer Ökonomie Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle i} als Verwendungsrechnung darstellen als
Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle Y_{i} = C_{i} + I_{i} + X_{i} - M_{i}} (1.3.1)
wobei Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle C} den gesamten Konsum und Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle I} die gesamten Brutto-Investitionen bezeichnet. Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle X} entspricht dem Gesamtvolumen der Exporte, Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle M} entspricht dem Gesamtvolumen der Importe. Beide Variablen werden nicht als Wertschöpfung, sondern zum Produktionswert erfasst. Das könnte vom Konzept her problematisch sein, da das BIP auf der Wertschöpfung basiert.
Betrachtet man sich Gl. (1.3.1) jedoch genauer, so wird deutlich, dass automatisch um importierte Vorleistungen korrigiert wird: Ein inländisches Unternehmen, das Vorleistungen im Wert von 100 GE importiert, und das entstandene Endprodukt um 150 GE verkauft, hat eine Wertschöpfung von 50 GE erzielt. Wird das Produkt ins Ausland verkauft, so ergibt sich aus Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle X_{i} - M_{i}} , dass der Nettoexportwert der im Inland entstandenen Wertschöpfung entspricht. Wird das Produkt im Inland verkauft, so werden die Vorleistungen über Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle - M_{i}} vom BIP abgezogen. Bei vollständiger Produktion im Inland und Verkauf ins Ausland entspricht die Wertschöpfung dem Produktionswert Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle X_{i}} .
Als Indikator der Offenheit einer Ökonomie wird häufig die Exportquote herangezogen, definiert als
Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle EQ_{i} = \frac{X_{i}}{Y_{i}}\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ (1.3.2)}
Aus Gl. (1.3.2) wird deutlich, dass bei der Berechnung der Exportquote nicht um die Vorleistungen korrigiert werden. Die Exportquote misst somit nicht den Anteil des BIP, der exportiert wird. Aus demselben Grund ist möglich, dass ein Land eine Exportquote von über 100% erzielt. Bei Abwandlungen der Gl. (1.3.2), etwa durch Hinzuziehen der Importe in Form von Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle \frac{\left( X_{i} + M_{i} \right)}{Y_{i}}} , bleiben diese Probleme bestehen.
Vorsicht ist auch geboten bei internationalen Vergleichen, da kleinere Länder üblicherweise höhere Exportquoten aufweisen. Das folgt aus der räumlichen Distanz zu Zuliefer*innen und Abnehmer*innen: Bei gleicher Distanz ist es in einem größeren Land wahrscheinlicher, keine Staatsgrenze überwinden zu müssen. Auch werden sehr stark spezialisierte Unternehmen mit weltweitem Absatz in einem kleinen Land vergleichsweise weniger absetzen, da die Transportkosten und/oder bestimmte Präferenzen für einheimischen Produkte kaum eine Rolle spielen.
Weltmarktanteile
Maße zur Erfassung der Spezialisierung einer Ökonomie beziehen sich auf die Weltmarktanteile in bestimmten Branchen. Ein einfaches Maß für die Exportspezialisierung einer Ökonomie stellen ihre sektoralen Weltmarktanteile dar:
Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle WA_{i,k} = \frac{X_{i,k}}{\sum_{i = 1}^{n}X_{i,k}}\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ (1.3.3)}
wobei Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle k} die jeweilige Warengruppe bezeichnet und Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle n} die Anzahl aller untersuchten Ökonomien. Die sektoralen Weltmarktanteile geben schnell Aufschluss über die globale Position einer Ökonomie innerhalb einer Branche. Auch kann die Veränderung im Zeitverlauf erfasst werden. Das Maß ist jedoch nicht geeignet, sektorale Spezialisierungsmuster von Ökonomien mit unterschiedlichen Außenhandelsvolumen zu vergleichen.
Zu diesem Zweck bietet sich das Maß des relativen Weltmarktanteils an, das die sektoralen Weltmarktanteile mit dem Anteil der Warengruppen an den Gesamtexporten des Gesamtraumes in Beziehung setzt:
Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle RWA_{i,k} = \ln{\left( \frac{\frac{X_{i,k}}{\sum_{k = 1}^{m}X_{i,k}}}{\frac{\sum_{i = 1}^{n}X_{i,k}}{\sum_{k = 1}^{m}{\sum_{i = 1}^{n}X_{i,k}}}} \right)\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ (1.3.4)}}
wobei Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle m} die Anzahl aller untersuchten Warengruppen bezeichnet. Ein positiver RWA-Wert zeigt an, dass der Exportanteil der Gütergruppe Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle k} an den Gesamtexporten der Ökonomie Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle i} größer ist als der Exportanteil dieser Warengruppe an den Exporten des Gesamtraumes, Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle i} ist in diesem Fall somit überdurchschnittlich auf den Export dieser Warengruppe spezialisiert, und vice versa für negative Werte. Man beachte, dass das Logarithmieren in Gl. (1.3.4) v.a. den Effekt hat, unterdurchschnittliche Spezialisierung durch negative Werte sofort anzuzeigen. Verzichtet man auf das Logarithmieren, so wird eine unterdurchschnittliche Spezialisierung durch einen Wert zwischen null und eins angezeigt, die Interpretation ändert sich jedoch nicht.
Der Vorteil der RWA liegt darin, dass die Exportdaten sowohl auf die Exporttätigkeit der eigenen Ökonomie wie auf die Exporte des gesamten Untersuchungsraums bezogen werden. Somit können auch für kleine Branchen in kleinen Ländern hohe Werte erzielt werden. Die Aussagekraft ist allerdings begrenzt, da Importe nicht berücksichtigt werden und die Exportwerte wie oben besprochen üblicherweise den Produktionswerten (nicht: der Wertschöpfung) entsprechen.
Außenhandelsspezialisierung
Ein einfaches Maß zur simultanen Berücksichtigung der Exporte und Importe einer Ökonomie ist die sektorale Handelsbilanz. Sie drückt die Differenz zwischen Export- und Importwerten eines Teilraums in einer Warengruppe aus:
Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle HB_{i,k} = X_{i,k} - M_{i,k}} (1.3.5)
Abgesehen von der Information, ob eine Ökonomie innerhalb einer Warengruppe Netto-Exporteur oder Importeur ist, ist die Aussagekraft allerdings sehr begrenzt, da weder um die Bedeutung der Branche noch um die Größe der Ökonomie korrigiert wird. Im Gegensatz dazu normiert die Nettoaußenhandelsposition den Außenhandelssaldo einer Warengruppe über das Außenhandelsvolumen in diesem Sektor, sodass Vergleiche zwischen unterschiedlich großen Ökonomien ermöglicht werden:
Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle NAP_{i,k} = \frac{X_{i,k} - M_{i,k}}{X_{i,k} + M_{i,k}}\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ (1.3.6)}
Alternativ zur Berechnung von Maßzahlen auf Saldenbasis lässt sich die Außenhandelsspezialisierung eines Teilraumes mit Hilfe sektoraler Export-Import-Relationen ausdrücken. Anstelle der Differenz wird hier der Quotient zwischen Export- und Importwerten gebildet, Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle \frac{X_{i,k}}{M_{i,k}}} .
Im Unterschied zur sektoralen Handelsbilanz stellen die Nettoaußenhandelsposition und Export-Import-Relationen relative Maße für die Außenhandelsspezialisierung dar und sind damit für internationale Vergleiche geeignet. Ein einfache Illustration verdeutlicht, dass sie allerdings nur absolute Wettbewerbsvorteile anzeigen können: Eine Nettoaußenhandelsposition >0 oder eine Export-Import-Relation von >1 zeigen zwar Exportüberschüsse relativ zum Gesamtvolumen an. Liegt bspw. die Export-Import-Relation einer Ökonomie in einer Branche bei 1,1 und in allen anderen Branchen bei >1,1, so zeigt der Wert von 1,1 mithin zwar einen absoluten, aber keinen komparativen Vorteil im Sinne des Ricardo-Modells an.
Komparative Vorteile
Geht man davon aus, dass das Ricardo-Modell Handelsbeziehungen in der realen Welt erklären kann, so kann man versuchen, aus den empirischen Handelsdaten die komparativen Vor- und Nachteile von Ökonomien zu identifizieren. Demnach müsste der Anteil von Waren, bei deren Herstellung ein Land über komparative Vorteile verfügt, im Export höher sein als im Import, und vice versa bei komparativen Nachteilen. Ein Maß zur Erfassung dieser Verhältnisse ist der offenbarte komparative Vorteil (revealed comparative advantage, auch: Balassa-Index), der die Export-Import-Relation einer Warengruppe mit der Export-Import-Relation aller Warengruppen einer Ökonomie in Beziehung setzt:
Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle OKV_{i,k} = \ln{\left( \frac{\frac{X_{i,k}}{M_{i,k}}}{\frac{\sum_{k = 1}^{m}X_{i,k}}{\sum_{k = 1}^{m}M_{i,k}}} \right)\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ (1.3.7)}}
Positive Werte deuten einen komparativen Vorteil für Ökonomie Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle i} in der Warengruppe an. Ist bei Nettoexporteur, so ist der erste Bruch >1, folglich wird der OKV-Wert positiv beeinflusst. Ist Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle i} insgesamt Nettoexporteuer, so ist der zweite Bruch >1 und der OKV-Wert wird negativ beeinflusst. Auf diese Weise wird – im Unterschied zu Berechnungen von Weltmarktanteilen und Außenhandelsspezialisierungen – die gegenwärtige Gesamtposition auf den Weltmärkten berücksichtigt. [13] Je größer die OKV-Werte, desto größer sind die komparativen Vorteile. Wie bei der Berechnung der relativen Weltmarktanteile hat das Logarithmieren in Gl. (1.3.7) v.a. den kosmetischen Effekt, komparative Nachteile durch negative Werte sofort anzuzeigen.
Aufbau der Zahlungsbilanz
Die Zahlungsbilanz bezeichnet ein Kontensystem zur Erfassung der Außenwirtschaft und wird in Österreich von der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) veröffentlicht. Sie ergänzt die Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen (VGR), die von der Statistik Austria veröffentlicht werden, und erfasst sämtliche Transaktionen mit dem Ausland innerhalb einer Periode: Erstens Transaktionen von Gütern und Faktorleistungen zwischen inländischen und ausländischen Wirtschaftssubjekten, zweitens sämtliche Änderungen der Auslandsforderungen und -verbindlichkeiten. Die Zahlungsbilanz ist ihrem Grundkonzept nach in drei Teilbilanzen gegliedert:
- die Leistungsbilanz (Waren- und Dienstleistungsbilanz)
- die Übertragungsbilanz
- die Kapitalbilanz.
Die Leistungsbilanz erfasst sämtliche Güter- und Faktorleistungsströme aus dem Ausland und in das Ausland. Veränderungen bei Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber dem Ausland werden in der Kapitalbilanz erfasst. In der Übertragungsbilanz erfolgen die Gegenbuchungen aller einseitigen Transaktionen von Gütern, Faktorleistungen und Forderungen aus dem bzw. in das Ausland. Jede Transaktion, die mit einer Zahlung an das Ausland verbunden ist, geht als Debet mit einem negativen Vorzeichen ein; jede Transaktion, bei denen das Ausland Zahlungen leistet, wird mit einem positiven Vorzeichen versehen und als Credit verbucht.
Somit wird jede Transaktion doppelt und mit unterschiedlichen Vorzeichen verbucht. Daraus folgt, dass die Zahlungsbilanz zwangsläufig ausgeglichen sein muss, während die drei Teilbilanzen positiv oder negativ sein können. Das Grundprinzip der Zahlungsbilanz kann schematisch wie in folgender Tabelle dargestellt werden.
| Zahlungsbilanz | |
|---|---|
| Credit (Haben) | Debet (Soll) |
| Leistungsbilanz |
|
| Exporte von Waren, Dienstleistungen und Produktionsfaktoren | Importe von Waren, Dienstleistungen und Produktionsfaktoren |
|
|
Saldo 1 |
| Übertragungsbilanz |
|
| Empfangene unentgeltliche Übertragungen | Geleistete unentgeltliche Übertragungen |
|
|
Saldo 2 |
| Kapitalbilanz |
|
| Veränderungen der Verbindlichkeiten gegenüber dem Ausland (Kapitalimport) | Veränderungen der Forderungen gegenüber dem Ausland (Kapitalexport) |
|
|
Saldo 3 |
Aufbau der Zahlungsbilanz
Reine Finanztransaktionen berühren nur die Kapitalbilanz. Ansonsten finden für alle übrigen zweiseitigen Transaktionen Buchungen sowohl in der Leistungs- wie in der Kapitalbilanz statt. Wird bspw. eine Ware exportiert, so wird diese Transaktion als Credit in der Leistungsbilanz und als Debet in der Kapitalbilanz verbucht, da es sich um eine Forderung gegenüber dem Ausland handelt. [14] Einseitige Transaktionen sind entweder Real- oder Forderungstransfers und werden entsprechend entweder in der Leistungs- oder der Kapitalbilanz verbucht, wobei die Gegenbuchung stets in der Übertragungsbilanz erfolgt.
Leistungs- und Übertragungsbilanz
Die OeNB weist entsprechend der internationalen Gepflogenheiten die Leistungsbilanz und Übertragungsbilanz gemeinsam aus. Inwieweit welche Positionen aufgeschlüsselt oder zusammengefasst werden, ist im Detail durchaus veränderbar, ändert aber nichts am Grundprinzip. Die folgende Gliederung folgt der derzeit üblichen Aufschlüsselung in fünf Teilbilanzen:
- Handelsbilanz: Hier werden alle grenzüberschreitenden Warentransaktionen und somit Exporte und Importe im engeren Sinn erfasst. Kauft bspw. ein inländisches Unternehmen eine Maschine im Ausland, so geht dieser Import in die Debet-Spalte ein. Die Gegenbuchung erfolgt als Credit in der Kapitalbilanz, da sie die Verbindlichkeiten gegenüber dem Ausland erhöht.
- Dienstleistungsbilanz: Hier werden insbesondere der internationale Reiseverkehr und das internationale Transportwesen erfasst, außerdem Versicherungs- und Finanzdienstleistungen, Beratungsleistungen, technische Dienstleistungen. Ein Bsp. hierfür ist der Konsum eines inländischen Touristen im Ausland, der als Debet in der Leistungsbilanz und als Credit in der Kapitalbilanz verbucht wird.
- Bilanz der Primäreinkommen: Hier werden v.a. Einkommen aus Arbeit und Unternehmung erfasst, einschließlich Beteiligungen von Inländern an ausländischen Betrieben. Diese Position entspricht der Differenz zwischen BIP und BNE in der VGR; [15] analog zur VGR werden alle im Inland lebenden Personen hier wie Inländer behandelt. Ein Bsp. sind Dividendenzahlungen aus dem Ausland: Sie werden als Entgelt für vorangegangene Leistungen interpretiert und in der Leistungsbilanz als Credit verbucht, entsprechend als Debet in der Kapitalbilanz.
- Bilanz der Sekundäreinkommen: Hierunter fallen laufende Übertragungen, die nicht dem Erwerb eines Gutes oder eines Vermögenswerts dienen, darunter Einkommens- und Vermögenssteuern, Sozialbeiträge, Versicherungsleistungen und Überweisungen von ausländischen Arbeitnehmer*innen (die als Wirtschaftssubjekte zum Inland zählen) an ihre Familien im Ausland (auch: Gastarbeiterüberweisungen). Als Credit werden Übertragungen aus dem Ausland, als Debet Übertragungen an das Ausland verbucht.
- Vermögensübertragungsbilanz: Sie umfasst v.a. nichtgeschäftliche Transaktionen sowie Transaktionen, die eher einen einmaligen Charakter haben und Bestandteil des verfügbaren Vermögens, nicht der laufenden Einkommen sind. Zur ersten Kategorie zählen einerseits internationale Schenkungen wie Schuldenerlässe, zur zweiten Kategorie zählen bspw. der Erwerb oder die Veräußerung von Patenten, Kundenstocks, Sportlerablösen. Auch Rückflüsse aus dem EU-Haushalt werden hier verbucht, nicht jedoch die Zahlungen an den EU-Haushalt, da diese als laufende Übertragungen zur Bilanz der Sekundäreinkommen gezählt werden.
Die Summen aus Credit und Debet der Handels- und Dienstleistungsbilanz entsprechen den Importen und Exporten in der VGR. Daraus folgt, dass die Summe der Salden der Handels- und Dienstleistungsbilanz den Nettoexporten bzw.
-importen entspricht. Dass die Übertragungsbilanz in der obigen Tabelle als eigene Hauptbilanz, in dieser Darstellung aber mit der Leistungsbilanz zusammengefasst wird, spiegelt die Uneinheitlichkeit in der Literatur bei ihrer Behandlung wider. Das hat auch damit zu tun, dass bestimmte Kategorien nicht eindeutig zuzuordnen sind. Handelt es sich bei Überweisungen von Gastarbeiter*innen in ihre Heimatländer wirklich um eine laufende Übertragung? Oder handelt es sich aus Sicht der gastgebenden Ökonomie nicht doch eher um eine Schenkung ohne Gegenleistung? Tatsächlich wurde diese Kategorie (neben anderen) früher zur Vermögensübertragungsbilanz gezählt, woraus deutlich wird, dass eine klare Trennung in Einzelfällen schwierig ist und weshalb hier und im Folgenden beide Kategorien zusammengefasst werden.
Kapitalbilanz
Die Kapitalbilanz ist das Gegenstück zur Leistungs- und Übertragungsbilanz und verzeichnet sämtliche internationalen Käufe und Verkäufe von Vermögenswerten. Als Bsp. zum grundlegenden Verständnis sei hier der Erwerb einer Filiale im Ausland durch ein inländisches Unternehmen angeführt: Diese Transaktion geht als Debet in die Kapitalbilanz ein. Das daraus resultierende negative Vorzeichen kann verbal beschrieben werden als „Import von Vermögenswerten“, da diese vom Inland gekauft wurden.
Man stelle sich hier zur Veranschaulichung vor, dass Land A Waren im Wert von 100 GE nach Land B exportiert und das Unternehmen anschließend in Land B eine Fabrik im Wert von 100 GE kauft. Real sind die Werte identisch, allerdings verbessert sich die Vermögensposition von Land A: Es importiert Vermögenswerte, indem es Waren exportiert. Diese Gleichheit muss immer gegeben sein und entsprechend erfolgen die Buchungen: Im Falle des Warenverkaufs +100 in der Leistungsbilanz (Haben) und -100 in der Kapitalbilanz (Soll: die Forderungen gegenüber dem Ausland steigen, real verkörpert bspw. in Form eines Schecks). Im Falle des Fabrikkaufs wird ein Vermögenswert aus dem Ausland erworben und schlägt sich in der Kapitalbilanz mit -100 (Soll: ein Vermögenswert wurde von Land B erworben) und mit +100 wieder (Haben: ausländische Vermögenswerte im Inland wurden erhöht). Die Leistungsbilanz von Land A beträgt +100, jene von Land B -100; analog beträgt die Kapitalbilanz von Land A -100, jene von Land B +100. Land B ist daher Netto-Kapitalimporteur, die Zahlungsbilanz ist definitionsgemäß in beiden Ländern ausgeglichen.
Zur Kapitalbilanz zählen im Einzelnen folgende Positionen:
- Direktinvestitionen: Diese sind zurzeit definiert als grenzüberschreitende Unternehmensbeteiligungen von mindestens 10% des stimmberechtigten Kapitals. Sie umfassen somit auch den Erwerb von Betrieben im Ausland sowie von Liegenschaften.
- Portfolioinvestitionen: Hierzu zählen Anteilsrechte (Aktien und Investmentzertifikate) sowie verzinsliche Wertpapiere exklusive der als Direktinvestitionen definierten Erwerbungen sowie Finanzderivate.
- Finanzderivate: Darunter versteht man u.a. Optionen, Futures oder Swaps, sie können auf Kapitalprodukten (z.B. Devisen, Wertpapieren) oder Zinsprodukten basieren, erfasst wird nur der Saldo.
- Sonstige Investitionen: Diese Restkategorie enthält klassische Bankgeschäfte wie Handelskredite, sonstige Kredite sowie Bargeld und Einlagen, außerdem auch Elemente des Liquiditätsmanagements von Unternehmen sowie Aktivitäten der Notenbank.
- Währungsreserven: Forderungen in Fremdwährung gegenüber Schuldnern mit Sitz außerhalb der Währungszone (in Österreich daher ohne Veränderungen des Eurobestands, vgl. Lektion 1.3.8).
Bei vollständiger und richtiger Erfassung aller grenzüberschreitenden Transaktionen ergibt die Summe aller Salden der Teilbilanzen Null. In der Praxis verbleiben allerdings nicht unerhebliche nicht aufgeklärte oder nicht zuordenbare Transaktionen, die als statistische Differenz verbucht werden. Der Hauptgrund ist die Erfassung von Exporten und Importen, ohne gleichzeitig die Art der Finanzierung zu erheben. Auch zeitlich unterschiedliche Zuordnungen von Buchung und Gegenbuchung sind eine häufige Ursache für statistische Differenzen in einzelnen Perioden. Hinzu kommen noch die Schwierigkeiten bei der Erfassung von Tourismusausgaben und -einnahmen sowie bei Transaktionen mit kriminellem Hintergrund. Eine besondere Form stellt die häufig legale „Kapitalflucht“ dar, bei der Geld ins Ausland übertragen wird, ohne dass ein Gegengeschäft stattfindet. Innerhalb der Eurozone werden solche Transaktionen (sofern es sich nicht um Bargeld handelt) allerdings von der EZB erfasst.
Sonderfall Eurozone
Innerhalb der Eurozone werden grenzüberschreitende Zahlungen von der EZB verwaltet. Das Zahlungsverkehrssystem TARGET2 (als Nachfolger von TARGET, engl. kurz für Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer System) ist aufgrund der dezentralen Umsetzung der Geldpolitik nötig. Die TARGET2-Salden messen Nettoüberweisungen zwischen den Ländern der Eurozone, der Prozess läuft dabei prinzipiell so ab (vgl. folgende Abbildung):
- Die der nationalen Notenbank A zugeordnete Geschäftsbank AA überweist mittels Zahlungsanweisung Gelder an die der Notenbank B zugeordnete Geschäftsbank BB (strichlierte Linie). Dadurch kommt es zu folgenden Buchungen:
- A belastet das Girokonto von AA und
- stellt dabei eine Verbindlichkeit gegenüber B ein,
- wobei B die Forderung gegen A einbucht und den Betrag am Girokonto von BB gutschreibt.
- So kommt es zu Forderungen und Verbindlichkeiten zwischen den nationalen Notenbanken, deren Salden am Tagesende Forderungen oder Verbindlichkeiten gegenüber der EZB darstellen. Die EZB übernimmt via TARGET2 die Rolle der zentralen Abwicklungsstelle.
Somit können über TARGET2 innerhalb der Eurozone Waren und Vermögensgegenstände erworben und Schulden beglichen werden. Die TARGET2-Konten werden als Teil des Postens Bargeld und Einlagen unter den sonstigen Investitionen geführt. Die Summe aller Salden aller nationalen Notenbanken ergibt zwangsläufig Null. In den einzelnen Ländern kann es jedoch durch Verlust oder Zugewinn an Eurobeständen zu Überschüssen oder Defiziten kommen.
| Credit | Debet | Saldo | ||
|---|---|---|---|---|
| Leistungs- und Übertragungsbilanz |
|
212,576 | 205,872 | 6,704 |
| Handel |
|
128,827 | 126,192 | 2,635 |
| Dienstleistungen |
|
52,761 | 41,132 | 11,629 |
| Primäreinkommen |
|
28,071 | 30,253 | -2,182 |
| Sekundäreinkommen |
|
2,615 | 6,061 | -3,446 |
| Vermögensübertragungen |
|
303 | 2,235 | -1,932 |
|
|
|
|
|
|
| Kapitalbilanz |
|
|
|
-5,471 |
| Direktinvestitionen |
|
5,172 | 13,266 | -8,094 |
| Portfolioinvestitionen |
|
-13,792 | 734 | -14,526 |
| Finanzderivate |
|
|
|
516 |
| Sonstige Investitionen |
|
-3,355 | -19,680 | 16,325 |
| Währungsreserven |
|
|
|
309 |
|
|
|
|
|
|
| Statistische Differenz |
|
|
|
-1,234 |
Zahlungsbilanz Österreichs 2015, in Mio. Euro [16]
Im Zuge der Euro-Krise gerieten die TAREGT2-Salden in den Blickpunkt der Öffentlichkeit, da sie sich im Rahmen der Leistungsbilanzdefizite und -überschüsse erheblich erhöht hatten. Zwar hängen Leistungsbilanz- und TAREGT2-Salden nicht unmittelbar zusammen, da Letztere auch über eine Kapitalflucht ausgelöst werden können und so zur Restgröße statistische Differenz beitragen. Allerdings wurde von wissenschaftlicher Seite darauf hingewiesen, dass zwischen den Euro-Staaten Verbindlichkeiten in den TARGET2-Salden gewissermaßen versteckt würden, da sie bis dahin von der Öffentlichkeit kaum beachtet wurden.
Die Zahlungsbilanz am Beispiel Österreich
In der obigen Tabelle werden die Hauptpositionen der Zahlungsbilanz für Österreich im Jahr 2015 dargestellt. Wie man sehen kann, hat Österreich sowohl in der Handels- wie in der Dienstleistungsbilanz Überschüsse erzielt, wobei der Überschuss Letzterer trotz geringeren Volumens viel größer ist. Hingegen verzeichnet Österreich bei Primär- und Sekundäreinkommen sowie bei Vermögensübertragungen einen Abfluss. Insgesamt überwiegen jedoch die Zuflüsse, und die Leistungs- und Übertragungsbilanz weist einen positiven Saldo von € 6,7 Mrd. auf, was knapp 2% des BIP im selben Jahr entspricht.
Somit ist Österreich netto zwangsläufig Kapitalexporteur: Die Forderungen gegenüber dem Ausland sind gestiegen. Einen hohen Überschuss weist Österreich dabei bei den Direktinvestitionen auf, d.h. es ist als Direktinvestor im Ausland wesentlich aktiver als ausländische Investoren*innen in Österreich. Auffallend ist außerdem der enorme Unterschied der Salden von Portfolioinvestitionen und den sonstigen Investitionen. Diese schwanken von Jahr zu Jahr recht stark, da sie von den weltweiten Finanzmarktverhältnissen abhängen.
Insgesamt lässt sich für Österreich konstatieren, dass sich das Ausland zurzeit verschuldet, um Österreichs Exporte finanzieren zu können. Der negative Saldo bei den Primäreinkommen deutet darauf hin, dass es früher eher umgekehrt war. Bei allen Interpretationen ist daher auf die lange Frist zu achten. Zwar kann Österreich auch langfristig bspw. in der Handelsbilanz einen negativen, in der Dienstleistungsbilanz jedoch einen positiven Saldo aufweisen (tatsächlich hat Österreich auf diese Weise jahrzehntelang sein Handelsbilanzdefizit kompensiert). Aber kein Land kann für immer in der Leistungs- und Übertragungsbilanz einen positiven Saldo aufweisen. Diese Feststellung ist im Kontext der Diskussion und Handlungen in der Eurokrise relevant: Ein Schuldenerlass ist letztlich gleichlautend mit einer rückwirkenden Schenkung. Gibt es keinen Schuldenerlass, dann muss auch ein*e Nettoexporteur*in mit vielen absoluten Handelsvorteilen irgendwann zum*zur Nettoimporteuer*in werden, da sonst dereinst die angehäuften Forderungen nicht mehr geltend gemacht werden können. Daraus folgt weiterhin, dass ein*e Nettoimporteur*in nicht zwangsläufig absolute Handelsnachteile hat.
Übungen
1.4.1
Land A verfügt über 1.200 AE und kann die Güter x und y produzieren. Der Arbeitskoeffizient a nimmt die Werte Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle a_{x}^{A}\ = \ 3} und Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle a_{y}^{A}\ = \ 2} an.
Skizzieren Sie die Transformationskurve für Land A.
Berechnen Sie die Opportunitätskosten für x und y.
Berechnen Sie die relativen Güterpreise für x und y.
1.4.2
Ein zweites Land, B, verfügt über 800 AE, mit den Arbeitskoeffizienten Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle a_{x}^{B}\ = \ 5} und Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle a_{Y}^{B}\ = \ 1} .
Skizzieren Sie die Transformationskurve für Land B.
Berechnen Sie die Opportunitätskosten für x und y in B.
Berechnen Sie die relativen Güterpreise für x und y in B.
Nehmen Sie nun an, dass A und B ein Freihandelsabkommen schließen. Konstruieren Sie eine Kurve des relativen Weltangebots, indem die x-Achse der Weltproduktion Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle ({q\ }_{A}^{x} + \ {q\ }_{B}^{x})\ /\ ({q\ }_{A}^{y} + \ {q\ }_{B}^{y})} erfasst, mit Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle q} als produzierter Menge, und die y-Achse den relativen Weltmarktpreis Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle p_{x}/p_{y}} misst.
1.4.3
Die relative Weltnachfrage folgt der Funktion Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle ({q\ }_{A}^{x} + \ {q\ }_{B}^{x})\ /\ ({q\ }_{A}^{y} + \ {q\ }_{B}^{y})\ = \ \ p_{y}/p_{x}} .
Skizzieren Sie im Diagramm aus 1.4.2.d die Kurve der relativen Weltnachfrage.
Wo liegt der relative Gleichgewichtspreis von Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle x} ?
Welches Land erzeugt wie viele Einheiten welchen Guts?
Berechnen Sie BIP und Lohnsatz für beide Länder, wenn Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle p_{x} = 1} .
Diskutieren Sie, inwieweit sowohl A wie B vom Außenhandel profitieren.
Nehmen Sie an, dass beide Länder unter Autarkie ihr Arbeitsangebot für die Produktion der beiden Güter jeweils zur Hälfte einsetzen. Wie hoch wäre das BIP der beiden Länder unter Autarkie, berechnet zum Weltmarktpreis, der sich bei Handel einstellt? Welches Wachstum ergibt sich durch Freihandel?
1.4.4
Nehmen Sie nun an, dass sich das Arbeitsangebot in A auf 2.400 AE erhöht.
Ermitteln Sie den relativen Gleichgewichtspreis.
Diskutieren Sie, inwieweit nun A wie B vom Außenhandel profitieren.
Berechnen Sie BIP und Lohnsatz für beide Länder, wenn Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle p_{x} = 1} .
1.4.5
Nehmen Sie nun für Land A 2.400 AE an bei reduzierter Produktivität, mit Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle a_{x}^{A}\ = \ 6} und Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle a_{y}^{AB}\ = \ 4} .
Skizzieren Sie die Kurve relativen Weltangebots und ermitteln Sie den relativen Gleichgewichtspreis.
Diskutieren Sie, inwieweit A wie B vom Außenhandel profitieren.
Wie hoch sind nun BIP und Lohnsatz in beiden Ländern, wenn Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle p_{x} = 1} ?
1.4.6
Skizzieren Sie verbal oder mittels einer Grafik die Auswirkungen einer Exportsubvention für ein großes Land.
1.4.7
Nennen und diskutieren Sie kurz vier Argumente dafür, den Handel direkt einzuschränken.
1.4.8
Diskutieren Sie, warum es trotz der Verluste an Konsumentenrente einen positiven Optimalzoll geben kann.
1.4.9
Die EU hat Richtlinien über die Sicherheit von Spielzeug erlassen, die den Import dieser Warengruppe aus China erheblich einschränken. Gegner*innen dieser Richtlinie argumentieren, dass die EU mit zweierlei Maß messe und genauso gut die Einfuhr von Gütern beschränken könne und solle, die von schlecht bezahlten Arbeitskräften verrichtet werden. Argumentieren Sie, warum dieses Argument nicht stichhaltig ist.
1.4.10
Bei der Berechnung von BIP und BNE werden Doppelzählungen vermieden, indem die Vorleistungen vom Produktionswert abgezogen werden. Sollte dementsprechend auch bei Importen verfahren werden? Wie sollten die Exporte bewertet werden?
1.4.11
Österreich hat 2015 Waren im Wert von € 131,6 Mrd. exportiert und ein BIP in der Höhe von € 329,3 erzielt.
Berechnen Sie die Exportquote.
In einer heimischen Tageszeitung ist der Satz zu lesen: „Rund 40 % des heimischen Bruttoinlandsprodukts werden durch Ausfuhren erwirtschaftet.“ Diskutieren Sie, warum diese Aussage nicht korrekt ist.
In derselben Tageszeitung steht an einem anderen Tag der Satz: „Laut Experten ist das Zahlungsbilanzdefizit vor allem auf dem starken Importüberhang in der Handelsbilanz zurückzuführen, ausgelöst durch den wachsenden Inlandskonsum.“ Warum ist es unmöglich, dass diese Aussage stimmt?
1.4.12
Erläutern Sie, wie jede der folgenden Transaktionen zu zwei Buchungen – Credit und Debit – in der österreichischen Zahlungsbilanz führt und ordnen Sie sie der richtigen Teilbilanz zu:
Eine österreichische Bank kauft britische Aktien und zahlt mit einem Scheck
Schecks sind hier und im Folgenden synonym für Überweisungen zu verstehen.
der auf ein Konto bei einer schweizerischen Bank ausgestellt ist.Bei einer offiziellen Devisenmarktintervention verwendet die japanische Regierung Euro von einer US-amerikanischen Bank, um von ihren eigenen Bürgern japanische Währung (Yen) zu kaufen.
1.4.13
Ein Österreicher fährt nach London, um einen Anzug zum Preis von 1000 Pfund zu kaufen. Das Unternehmen in London, welches ihm den Anzug verkauft, reicht seinen Scheck über 1000 Pfund bei einer Bank in Österreich ein.
Wie werden diese Transaktionen in Zahlungsbilanzen von Österreich und Großbritannien verbucht?
Was ändert sich, wenn der Österreicher den Anzug in bar bezahlen würde?
1.4.14
Eine Volkswirtschaft hatte im Jahr 2008 ein Leistungs- und Übertragungsbilanzdefizit von 1000 GE und einen Portfoliobilanzüberschuss von 500 GE.
Wie entwickelte sich das Nettoauslandsvermögen dieser Volkswirtschaft?
Nehmen Sie an, dass ausländische Notenbanken keine Anlagen dieser Volkswirtschaft gekauft oder verkauft haben. Wie veränderten sich in diesem FaIl die Devisenreserven der Notenbank der Volkswirtschaft im Jahr 2008? Wie würde sich die entsprechende Devisenmarktintervention in der Zahlungsbilanz niederschlagen?
Lösungen
1.4.1
a. Die Transformationskurve ist eine gerade Linie. Ihr Schnittpunkt mit der x-Achse liegt bei 400 (1200/3), ihr Schnittpunkt mit der y-Achse bei 600 (1200/2).
b. Die Opportunitätskosten von Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle x} gerechnet in y betragen Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle 3/2\ = \ 1,5} . Die Erzeugung von 1 EH Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle x} erfordert 3 Arbeitseinheiten, von Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle y} nur 2. Der Verzicht auf die Erzeugung 1 EH Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle x} setzt folglich 3 AE frei. Mit diesen 3 AE können 1,5 EH von Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle y} erzeugt werden.
c. Die Mobilität der Arbeit innerhalb der Ökonomie sorgt für gleiche Löhne in beiden Sektoren, und der Wettbewerb sorgt dafür, dass die Preise der Güter gleich ihren Produktionskosten sind. Der relative Preis ist folglich gleich den relativen Kosten. Diese wiederum erhält man, indem man das Produkt aus Lohn und Arbeitskoeffizient von x dividiert durch das Produkt aus Lohn und Arbeitskoeffizient von . Da die Löhne in beiden Sektoren gleich sind, ist das Preisverhältnis gleich dem Verhältnis der Arbeitskoeffizienten, Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle p_{x}/p_{y} = \ 1,5} .
1.4.2
a. Die Transformationskurve ist wiederum eine Linie und schneidet die x-Achse bei 160 (800/5) und die y-Achse bei 800 (800/1).
b. Die Opportunitätskosten von x gerechnet in y betragen 5/1 = 5.
c. Das Preisverhältnis Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle p_{x}/p_{y} = \ 5} .
d. Man konstruiert die Kurve des relativen Weltangebots, indem man für jeden relativen Preis das Verhältnis der Angebote von Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle x} und bestimmt. Der niedrigste relative Preis für Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle x} liegt entsprechend den Verhältnissen in A bei Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle p_{x}/p_{y} = \ 1,5} . Bei diesem Preis hat die Kurve des relativen Angebots von Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle x} zu einen flachen Verlauf. Die maximale Anzahl Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle x} , die zum Preis von 1,5 von A geliefert wird, ist Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle 1200/3\ = \ 400} . Bei diesem Preis erzeugt B 800 EH von Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle y} und 0 EH von , sodass das maximale relative Angebot bei diesem Preis bei Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle 400/800\ = \ 0,5} liegt. Dieses relative Angebot gilt für alle Preise von 1,5 bis 5. Bei einem Preis von 5 würden beide Länder nur Gut Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle x} erzeugen. Bei 5 wird die Kurve des relativen Angebots daher wieder flach; sie zeigt also einen stufenförmigen Verlauf: Bei einem Preis von 1,5 ist sie für ein relatives Angebot von 0 bis 0,5 flach, bei der relativen Menge von 0,5 steigt sie vertikal von 1,5 auf 5, und im weiteren Verlauf, auf der x-Achse von 0,5 bis ∞, verläuft sie wieder flach. Anders entspricht der vertikale Teil der Angebotskurve der x-Achse im Punkt Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle L^{A}/a_{x}^{A}\ /\ L_{B}/a_{y}^{B}\ = \ 1200/3/800/1\ = \ 0,5} .
1.4.3
a. Die Kurve der relativen Nachfrage umfasst u.a. die Punkte (0,2, 5), (0,5, 2), (1,1) und (2, 0,5). Anmerkung: Die Kurve folgt aus der Gleichung für die Nachfrage und verschiedenen Werten, die eingesetzt werden können. Sie dient allerdings eher zur Illustration und muss nicht extra ausgerechnet werden. Der Grund dafür ist, dass das Modell hier selbst einen Kniff anwendet: Einerseits wird eine Welt mit nur zwei Ländern beschrieben, andererseits gibt es einen exogen (von wem?) bestimmten Weltmarktpreis. Wichtig für das Verständnis ist, was an welchen Schnittpunkten der Nachfragekurve mit der Angebotskurve passiert.
b. Der Preis ergibt sich aus dem Schnittpunkt der Kurven der relativen Nachfrage und des relativen Angebots, (0,5, 2). Der relative Gleichgewichtspreis ist also 2.
c. A erzeugt nur , B erzeugt nur , und jedes Land tauscht eine bestimmte Menge seines Produkts gegen das Produkt des anderen Landes aus.
d. A produziert Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle q_{x}^{A}\ = \ 400} , Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle q_{y}^{A}\ = \ 0} , Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle p_{x}\ = \ 1} , Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle p_{x}/p_{y}\ = \ 2} , daher Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle p_{y}\ = \ 0,5} . Das BIP von Land A entspricht seiner produzierten Menge mal den jeweiligen Preisen, also Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle 400 \bullet 1\ + 0 \bullet 0,5\ = \ 400} . Der Lohnsatz entspricht dem Wert des produzierten Outputs je Arbeitseinheit, also . B produziert Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle q_{x}^{B}\ = \ 0} , Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle q_{y}^{B}\ = \ 800} , das BIP von Land B ist somitFehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle \ 0 \bullet 1\ + \ 800 \bullet 0,5\ = \ 400} . Somit .
e. In Abwesenheit von Handel könnte A durch den Verzicht auf 2 EH von Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle x} 3 EH von Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle y} gewinnen, und B könnte durch den Verzicht auf 5 EH von y analog 1 EH Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle x} gewinnen. Der Außenhandel ermöglicht beiden Ländern ein Austauschverhältnis von 2 EH zu 1 EH von Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle x} . Folglich kann A dann durch den Verzicht auf 2 EH von Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle x} 4 EH von Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle y} gewinnen, und 1 EH von Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle x} durch den Verzicht auf nur 2 EH von Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle y.}
f. Unter Autarkie setzt A jeweils 600 Arbeitseinheiten zur Produktion von Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle x}
und ein und produziert somit Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle q_{x}^{A}\ = \ 600/3\ = \ 200}
, Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle q_{y}^{A}\ = \ 600/2\ = \ 300}
, das BIP zu Weltmarktpreisen entspricht daher Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle 200 \bullet 1\ + \ 300 \bullet 0,5\ = \ 350}
. Land B produziert unter Autarkie beim Einsatz von jeweils 400 Arbeitseinheiten , Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle q_{y}^{B}\ = \ 400/1\ = \ 400}
, das BIP zu Weltmarktpreisen entspricht daher
Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle 80 \bullet 1\ + \ 400 \bullet 0,5\ = \ 280}
. Land A erfährt im Freihandel somit ein BIP-Wachstum von Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle 400 / 350-1=14,26 \%}
, Land B .
1.4.4
a. Der vertikale Teil der Angebotskurve verschiebt sich zum Punkt Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle 2400/3/800/1\ = \ 1} , sodass die Eckpunkte nun bei (1, 1,5) und (1, 5) liegen. Der Schnittpunkt zwischen relativer Nachfrage- und relativer Angebotskurve liegt nun auf dem niedrigeren horizontalen Abschnitt, im Punkt (0,67, 1,5).
b. B verzeichnet Außenhandelsgewinne, doch die Opportunitätskosten für Gut Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle y} in Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle x} gerechnet sind für A in beiden Fällen – mit oder ohne Außenhandel – gleich, sodass A durch den Außenhandel weder Gewinne noch Verluste verzeichnet.
c. Der relative Weltmarktpreis hat nun jenes Niveau, das sich in Land A auch unter Autarkie einstellen würde, . Das BIP von Land A beträgt nun, unabhängig davon, wie das Arbeitsangebot aufgeteilt wird, Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle 2400/3\ = \ 800} , der Lohnsatz Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle \omega^{A}\ = \ (800 \bullet 1)/2400\ = \ (1200 \bullet 0,67)/2400\ = \ 0,33} . Land A ist somit indifferent, ob es am Welthandel teilnimmt oder nicht. Unter der Annahme, dass Land A bereits ist zu tauschen, verhält sich B wie unter 1.4.3 und produziert Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle q_{x}^{B}\ = \ 0,\ q_{y}^{B}\ = \ 800} , das BIP von Land B ist somit . Der Lohnsatz Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle \omega^{B}\ = \ (800 \bullet 0,667)\ /\ 800\ = \ 0,667} . Verweigert sich Land A dem Tausch ganz oder teilweise, so reduziert sich das BIP- und Lohnniveau in Land B entsprechend dem Tauschvolumen.
1.4.5
a. Die Kurve hat den gleichen Verlauf wie ins Bsp. 1.4.2.d, da die Verdoppelung der Anzahl der Beschäftigten mit einer Halbierung der Arbeitsproduktivität verbunden ist, und somit der der vertikale Teil der Angebotskurve im Punkt Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle L^{A}/a_{x}^{A}\ /\ L^{B}/a_{y}^{B}\ = \ 2400/6/800/1 = 0,5} liegt. Bei unveränderter Nachfrage liegt der Schnittpunkt der beiden Kurven somit bei 2.
b. Siehe Antwort zu 1.4.3.e.
c. A produziert Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle q_{x}^{A} = 2400/6 = 400} , , das BIP ist somit Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle 400 \bullet 1\ + \ 0 \bullet 0,5\ = \ 400} , Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle \omega^{A} = (400 \bullet 1)\ /\ 2400 = 0,167} . B produziert Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle q_{x}^{B}\ = \ 0,q_{y}^{B}\ = \ 800} , das BIP von Land B ist somit , Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle \omega^{B}\ = \ (800 \bullet 0,5)\ /\ 800\ = \ 0,5} .
1.4.6
Exportsubventionen führen wie Zölle dazu, dass sich der Inlands- vom Auslandspreis um die Höhe der Subvention unterscheidet. Allerdings ist die Wirkung einer Exportsubvention auf die Preise konträr zu der Wirkung von Zöllen, da die Preise nun im exportierenden Land steigen. Durch die Gewährung einer Exportsubvention durch den Staat werden für die Exporteur*innen im Inland Anreize geschaffen, solange zu exportieren, bis der Inlandspreis den Auslandspreis genau um den Betrag der Subvention übersteigt. Da allerdings mit dem gestiegenen Angebot die Preise im Ausland fallen, fällt die Preiserhöhung im Exportland niedriger als die Subventionshöhe aus. Im Exportland werden die Konsument*innen durch die höheren Preise belastet, während die Produzent*innen profitieren. Diesem positiven Effekt des Anstiegs der Konsumentenrente stehen der Verlust der Konsumentenrente sowie die Kosten des Staates, der die Exportsubvention finanzieren muss, gegenüber. Im Gegensatz zu Importzöllen gibt es keine Möglichkeit zur Wohlfahrtssteigerung, da der Staat den Großteil der Produzentenrente sowie die Subventionen finanzieren muss.
1.4.7
- Reales Tauschverhältnis: Ein großes Land kann aufgrund des relevanten Ausmaßes seiner eigenen Nachfrage den Weltmarktpreis beeinflussen. In diesem Fall sinkt bei Einführung eines Zolls die Weltnachfrage, und die ausländischen Anbieter*innen werden ihre Preise reduzieren. Die Summe der Staatseinnahmen durch den Zoll und der gestiegenen Produzentenrente kann die durch einen Zoll stets hervorgerufene Reduktion der Konsumentenrente übertreffen.
- Marktversagen im Inland: Als Folge des Freihandels werden im eigenen Land bestimmte Produktionsfaktoren nicht so alloziiert, wie sie sollten. Mögliche Ausprägungen sind persistente Arbeitslosigkeit oder fehlende Wissensproduktion.
- Besondere Branchen: Manche Branchen werden aus politischen Gründen vor internationalem Wettbewerb geschützt. Das sind solche, die für die Sicherheit der eigenen Bevölkerung wichtig sind, insbes. der Agrarsektor und die Rüstungsindustrie, außerdem kulturell bedeutsame Branchen.
- Erziehungszoll: Es ist denkbar, dass eine bestimmte Branche in einem Land langfristig einen komparativen Vorteil hat, obwohl dieses Land im Moment das betreffende Gut importiert. Die billigen Importe aus dem Ausland verhindern die Entwicklung dieser Branche im importierenden Land, obwohl diese langfristig betrachtet wettbewerbsfähiger wäre. Daher könnte ein temporärer Schutz die Entwicklung der Branche soweit fördern, bis die Produktionskosten hinreichend gesunken sind, sodass ein weiterer Schutz nicht mehr nötig ist.
1.4.8.
Das Argument des Optimalzolls basiert auf der Annahme, dass der Weltpreis eines bestimmten Guts durch einen Schutzzoll, den ein großes Land für einen bestimmten Markt verhängt, gesenkt werden kann. Ein vergleichsweise niedriger Zoll kann daher dazu führen, dass die Zolleinnahmen des Importlandes höher ausfallen als die Wohlfahrtsverluste der Verbraucher*innen, da die Preise des Importguts infolge des Zolls gesunken sind.
1.4.9
Der erste Grund bezieht sich auf das Argument des Marktversagens. Ein Einfuhrverbot für gefährliche Produkte anstelle einer einfachen Entscheidung der Verbraucher*innen, welche Risiken sie eingehen möchten, ist durch das Fehlen von chinesischen Sicherheitsstandards und -hinweisen begründet. Ein Einfuhrverbot für Produkte, die von schlecht bezahlten Arbeitskräften hergestellt wurden, kann mit diesem Argument nicht begründet werden. Vielmehr trifft hier die in Lektion 1.2.1 behandelte Replik auf das Ausbeutungs-Argument zu. Löhne spiegeln die Produktivität wider, und die konkurrierenden Arbeitskräfte in Niedriglohnländern stellen Güter für einen Sektor her, der in der EU vergleichsweise höhere Kosten aufweist. Der Import dieser Güter hebt den Lebensstandard der EU. Gleichzeitig steigt der Wohlstand der Arbeiter*innen im exportierenden Land im Verhältnis zu einem Zustand ohne diesen Außenhandel, denn in letzterem Fall wären die Löhne noch geringer. Entscheidend ist also nicht das Verhältnis der Lohnhöhe zwischen den Ökonomien, sondern welches sich im exportierenden Land unter Autarkie im Verglich zum Handel einstellt.
1.4.10
Es kommt nicht zu Doppelzählungen, wenn die Importe von Zwischengütern vom BIP/BNE abgezogen und die Exporte von Zwischengütern zum BIP/BNE hinzugezählt werden. Betrachtet werde als Bsp. der Verkauf inländischem Stahl an einen inländischen und einen ausländischen Automobilhersteller. Der an den inländischen Hersteller verkaufte Stahl wird vom Produktionswert der resultierenden Automobile abgezogen, wodurch die Doppelzählung vermieden wird. Der Wert des an den ausländischen Hersteller verkauften Stahls geht als Export in die inländische VGR ein. Werden die Automobile des ausländischen Herstellers importiert, so wird der volle Produktionswert zum BIP/BNE addiert berücksichtigt. Der Stahl als inländische Vorleistung ist jedoch bereits durch die Berücksichtigung bei den Exporten abgezogen, wodurch die tatsächlich im Ausland erfolgte Wertschöpfung vom BIP/BNE subtrahiert wird.
1.4.11
a. Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle 131,6/329,3\ = \ 39,96\%}
b. Die Exportquote entspricht dem Verhältnis von Exportvolumen zum BIP. Da im Gegensatz zum BIP Vorleistungen nicht abgezogen werden, entspricht die Exportquote nicht dem Anteil des Exportvolumens am BIP. Wie viel des heimischen BIP tatsächlich exportiert wird, ist aus der Exportquote nicht abzulesen und die Aussage ist somit falsch.
c. Die Zahlungsbilanz ist definitionsgemäß stets ausgeglichen. Der*die Journalist*in meinte vermutlich die Leistungsbilanz.
1.4.12
a. Der Kauf der britischen Aktien schlägt sich als Debet in der österreichischen Kapitalbilanz nieder. Die Bezahlung mit dem auf eine schweizerische Bank ausgestellten Scheck führt zur Gegenbuchung als Credit in der österr. Kapitalbilanz, weil die Forderungen Österreichs an die Schweiz um den auf dem Scheck ausgewiesenen Betrag abnehmen. In diesem Fall hat die österr. Bank einen ausländischen Vermögenswert gegen einen anderen eingetauscht.
b. Die Devisenmarktintervention der japanischen Regierung beinhaltet den Verkauf eines US-amerikanischen Vermögenswerts, nämlich der von ihr in den USA gehaltenen Dollar, und stellt daher einen Debitposten in der Kapitalbilanz der USA dar. Die japanischen Bürger*innen, welche die Dollar erwerben, kaufen damit amerikanische Waren (dies wäre ein Credit in der US-amerikanischen Leistungsbilanz), oder sie kaufen einen amerikanischen Vermögenswert (dies wäre ein Credit in der amerikanischen Kapitalbilanz).
1.4.13
a. Der Kauf des Anzugs bedeutet ein Debet in der Leistungsbilanz von Österreich und ein Credit in derjenigen von Großbritannien. Wenn das Unternehmen aus Großbritannien das Geld bei seiner Bank in London einzahlt, ergibt sich ein Credit in der Kapitalbilanz von Österreich und ein entsprechendes Debet für Großbritannien.
b. Auch wenn die Transaktion in bar abgewickelt wird, tauchen das entsprechende Debet für Großbritannien und Credit für Österreich in ihren jeweiligen Kapitalbilanzen auf. Großbritannien erwirbt Pfund (ein Vermögenswertimport aus Österreich, folglich ein Debetposten in seiner Kapitalbilanz); Österreich verliert die Pfund (ein Export von Pfundnoten und daher ein Credit in seiner Kapitalbilanz).
1.4.14
a. Da das Land sein Leistungs- und Übertragungsbilanzdefizit von 1000 GE irgendwie finanzieren musste, sank das Nettoauslandsvermögen um 1000 GE.
b. Durch den Rückgriff auf ihre Devisenreserven finanzierte die Notenbank jenen Anteil des Leistungsbilanzdefizits, der nicht durch den Zufluss privaten Kapitals gedeckt wurde. Nur wenn ausländische Notenbanken Vermögenswerte der Volkswirtschaft erworben hätten, hätte die Notenbank darauf verzichten können, zur Finanzierung des Leistungsbilanzdefizits 500 GE aus ihren Reserven zu verbrauchen. Die Notenbank hat also 500 GE an Devisenreserven eingebüßt, was sich in der Zahlungsbilanz des Landes als offizieller Kapitalzufluss niederschlägt.
Währungen, Wettbewerbsfähigkeit und Migration
Neben dem Handel sind internationale Kapitalströme das zweite wesentliche Merkmal der Globalisierung. Dabei geht es nicht nur um den Erwerb von Geld und Wertpapieren in Fremdwährungen – realwirtschaftlich viel wichtiger sind grenzüberschreitende Direktinvestition. Im Zuge der zunehmenden Freiheit des Kapitals, sich bevorzugte Investitionsobjekte global auszusuchen, hat sich auch der Wettbewerb zwischen den Ökonomien um Investitionen erhöht bzw. ist überhaupt erst dadurch entstanden.
Ein drittes Merkmal der globalen Wirtschaft ist die Migration von Arbeitnehmer*innen. Diese ist einerseits im Vergleich zum Handel und zu Investitionen wesentlich stärker reguliert und wird daher nicht unbedingt als Merkmal der Globalisierung gezählt. Andererseits erhöht oder reduziert die Migration, insbesondere von Humankapitalträger*innen, die Wettbewerbsfähigkeit von Ökonomien bzw. konkurrieren die Ökonomien selbst um Humankapitalträger*innen. Eine Ausnahme ist allerdings die EU, da innerhalb ihres Territoriums die Migration von Arbeitnehmer*innen frei ist, weshalb hier Ursachen und Auswirkungen besondere Bedeutung zukommt.
Lektion 2 ist entsprechend ihrem Titel in drei Blöcke geteilt, die sich mit Währungen, der Wettbewerbsfähigkeit von Ökonomien und Migration zwischen Ökonomien auseinandersetzen. Lektion 2.1 beschreibt zunächst, wie Wechselkurse entstehen, bevor auf den Euro als Sonderfall einer gemeinsamen Währung mehrerer Volkswirtschaften eingegangen wird; besonderem Raum wird dabei der Euro-Krise gewidmet. Lektion 2.2 befasst sich mit dem nicht unumstrittenen Konzept der Wettbewerbsfähigkeit von Ökonomien und geht entsprechend kritisch auf jene Indikatoren ein, die üblicherweise zur Einschätzung der Wettbewerbsfähigkeit herangezogen werden. Abschließend behandelt Lektion 2.3 das Thema der Migration von Arbeitskräften aus mikro- und makroökonomischer Perspektive.
Währungssysteme und Wechselkurse
Wie bei regelmäßigem Aufenthalten in Ländern außerhalb der Eurozone zu beobachten ist, kann das Austauschverhältnis zwischen zwei Währungen von Jahr zu Jahr enormen Schwankungen unterliegen. Diese Schwankungen werden von zahlreichen Kräften bewirkt, weshalb die Aussagekraft einer Wechselkursänderung begrenzt ist: Einerseits bildet der Handel mit Fremdwährungen (auch: Devisen) selbst einen Markt und unterliegt somit grundsätzlich dem Gesetz von Angebot und
Nachfrage; andererseits wird der Wert einer Währung von mehreren politischen Entscheidungen simultan beeinflusst.
Allgemeines
Der Wechselkurs bezeichnet das Austauschverhältnis zweier Währungen. In unseren Breiten wird zumeist der Preis ausländischer Währung in inländischer Währung ausgedrückt, also bspw. kostet ein britisches Pfund € 1,27, ausgedrückt als „Euro je Pfund“. Da hier der Preis der Fremdwährung ausgedrückt wird spricht man auch von Preisnotierung. Der Kehrwert der Preisnotierung entspricht der Mengennotierung (Außenwert): Wie viel von der fremden Währung erhält man für 1 EH der eigenen Währung? Im obigen Bsp. erhält man ₤ 0,79, ausgedrückt als „Pfund je Euro“.
Wechselkurse bilden sich im Wesentlichen über Banken, welche überschüssige oder fehlende Währungen auf eigens dafür organisierten Märkten (den Devisenmärkten) handeln. Die Wechselkurse werden von Angebot und Nachfrage auf den Devisenmärkten bestimmt, wobei unterschieden wird zwischen
- Aufwertungen, d.h. der Außenwert der eigenen Währung steigt (im obigen Bsp. auf ₤ >0,79), der Preis der fremden Währung sinkt (auf € <1,27).
- Abwertungen, d.h. der Außenwert der eigenen Währung sinkt (im obigen Bsp. auf ₤ <0,79), der Preis der fremden Währung steigt (auf € >1,27).
Die Notenbanken beeinflussen durch ihre eigenen Aktivitäten die Wechselkurse. Da nationale Notenbanken im Interesse ihres jeweiligen Staates agieren, können sie versuchen, Wechselkurse im Interesse der jeweiligen Wirtschaftspolitik zu beeinflussen. Dazu gibt es grundsätzlich zwei Möglichkeiten:
- Der direkte Weg entspricht Interventionen auf den Devisenmärkten. Dazu kann die Notenbank um ihr eigenes Geld ausländische Währungen oder Wertpapiere kaufen oder verkaufen.
- Der indirekte Weg führt über die Zinsen. Zu diesem Zweck kann die Notenbank den kurzfristigen Zinssatz senken oder erhöhen, den sie von den Geschäftsbanken für ihr Geld verlangt. Dadurch wird die Attraktivität der eigenen Währung für Spargelder beeinflusst, und über diesen Weg wird die eigene Währung teurer oder billiger.
Als Grundregel gilt, dass eine expansive Geldpolitik (die Geldmenge der eigenen Währung wird über einen der beiden Wege erhöht) die eigene Währung verbilligt, während eine restriktive Geldpolitik (die Geldmenge der eigenen Währung wird reduziert) die eigene Währung verteuert.
Wechselkurssysteme
Neben der freien Preisbildung auf den Devisenmärkten können Staaten den Wechselkurs auch festlegen. Es werden dabei grundsätzlich drei Typen von Wechselkurssystemen unterschieden: frei schwankende, gelenkte oder feste Wechselkurse. [17]
- Frei schwankende Wechselkurse (auch: frei floatende Wechselkurse): Hier wird im Wesentlichen der Wert der eigenen Währung dem Verhältnis von Angebot und Nachfrage auf den Devisenmärkten überlassen. Zwar beeinflussen die Notenbanken über die Zins- und Geldmengensetzung auch den Wechselkurs, aber Letzteres ist kein Ziel an sich. Hauptziel einer solchen Politik ist vielmehr, den kurzfristigen Zinssatz innerhalb des eigenen Währungsraums auf der gewünschten Höhe zu halten, um die Konjunktur oder die Inflation zu steuern. Somit ist der große Vorteil dieses Typs, dass die Notenbank nicht intervenieren muss, um den Wechselkurs auf einer gewünschten Höhe zu halten, sondern vielmehr die volle Kontrolle über die Geldpolitik hat. Diese Politik wird zurzeit bspw. von den USA verfolgt.
- Gelenkte Wechselkurse: Hier lassen die Notenbanken ihre Währungen zwar schwanken, aber es gibt gewisse Ziele hinsichtlich des Wechselkurses zu anderen Währungen. Erreicht dieser eine bestimmte Höhe, so muss die Notenbank auf eine der beiden in Lektion 2.1.1 vorgestellten Wege intervenieren. Somit wird die Geldpolitik eingeschränkt – je nachdem, wie eng die Vorstellungen über die Wechselkursentwicklung gesteckt sind. Diese Politik wird zurzeit bspw. von der Schweiz gegenüber der Eurozone praktiziert.
- Feste Wechselkurse (auch: fixe Wechselkurse): In diesem System wird die eigene Währung fest an eine andere gebunden. Als sog. Ankerwährung fungiert üblicherweise jene eines*einer besonders wichtigen oder sogar dominanten Handelspartner*in. Bei freiem Kapitalverkehr muss die Notenbank über sog. Currency Boards ständig auf den Devisenmärkten präsent sein, um den gewünschten Wechselkurs aufrechtzuerhalten. Eine eigenständige Geldpolitik ist damit nicht mehr möglich – vielmehr wird die Geldpolitik des Landes der Ankerwährung übernommen. Ein Beispiel hierfür ist die Bindung des österreichischen Schilling an die Deutsche Mark bis zur Euro-Einführung.
Als letzte Konsequenz kann die eigene Währung auch den Devisenmärkten entzogen werden und legal nur zu einem offiziellen Tauschverhältnis gewechselt werden. In der Regel bilden sich dann Schwarzmärkte, deren Tauschverhältnisse oft erheblich von den offiziellen abweichen. Ein Beispiel hierfür waren die Wechselkurse der RGW-Staaten. Ein anderes Extrem ist die unilaterale Übernahme einer Fremdwährung als offizielles Zahlungsmittel, wie etwa im Falle des Euro durch Montenegro.
Als Trilemma des Wechselkursregimes wird die Unmöglichkeit bezeichnet, maximal zwei der folgenden drei währungspolitischen Ziele gleichzeitig erreichen zu können: eine eigenständige Geldpolitik, einen stabilen Wechselkurs und freien Kapitalverkehr. Der Vorteil fester Wechselkurse bei freiem Kapitalverkehr ist eine volle Stabilität auf Kosten einer eigenständigen Geldpolitik, und vice versa bei frei schwankenden Wechselkursen. Bei festen Wechselkursen können Änderungen im inländischen Zinssatz durch eine Einschränkung des Kapitalverkehrs erreicht werden, wodurch freilich das letzte Ziel wegfällt. Gelenkte Wechselkurse stellen einen Kompromiss dar und erreichen somit nur das Ziel des freien Kapitalverkehrs.
Kaufkraftparitäten
Die Theorie der Kaufkraftparität (KKP) führt Veränderungen des Wechselkurses auf veränderte Preisniveaus in den Ursprungsländern zurück. Demnach spiegelt der Wechselkurs das Preisniveauverhältnis in zwei Ökonomien wider. Der Theorie zugrunde liegt das Gesetz der Preiseinheitlichkeit, welches besagt, dass ein Gut, das in zwei Ökonomien erhältlich ist, in beiden Ökonomien denselben Preis haben muss wenn es weder Transportkosten, Handelsbarrieren noch Einschränkungen des Wettbewerbs gibt. Unter solchen Bedingungen würden Preisunterschiede sofort dazu führen, dass das Gut von einer Ökonomie zur anderen gebracht wird – bis der Preis wieder einheitlich ist.
Spielt man den Gedanken weiter, so folgt aus der Theorie der Kaufkraftparität, dass ein Kaufkraftverlust in der eigenen Währung (insbesondere durch Inflation) mit einer proportionalen Abwertung auf den Devisenmärkten einhergeht. Anders formuliert: Kostet ein Warenkorb in Land A 100 GE der Landeswährung (im Folgenden AGE) und in Land B 400 GE der dortigen Landeswährung (BGE), dann gilt allgemein:
Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle E_{\frac{A G E}{B G E}}=\frac{P_A}{P_B} (2.1.1)}
wobei den Wechselkurs von BGE aus Sicht von A in Preisnotierung darstellt, und das jeweilige Preisniveau symbolisiert. Im konkreten Fall ist das Preisniveau in B viermal so hoch wie in A, daraus ergibt sich Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle E_{AGE,BGE} = 0,25} : Man zahlt 0,25 AGE für 1 BGE. Durch Umformung der Gl. (2.1.1) erhält manFehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle P_{A} = P_{B}E_{AGE,BGE}} , was bedeutet, dass sich das Preisniveau einer Ökonomie darstellen lässt als Preisniveau einer anderen Ökonomie multipliziert mit dem Wechselkurs der beiden Ökonomien in Preisnotierung. Man spricht hier auch von absoluten KKP.
Aus den absoluten KKP folgt die wichtige Implikation der relativen KKP. Demnach wird sich der Wechselkurs zweier Währungen um den gleichen Prozentsatz ändern wie die Preisniveaudifferenz in den jeweiligen Ökonomien
Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \frac{E_{\frac{AGE}{BGE,t}}}{E_{\frac{AGE}{BGE,t - 1}}} = \frac{\frac{P_{A,t}}{P_{A,t - 1}}}{\frac{P_{B,t}}{P_{B,t - 1}}}\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ (2.1.2)}
Bei der Interpretation der Entwicklung von Wechselkursen sollten daher stets die Inflationsraten in den jeweiligen Ökonomie berücksichtigt werden, allgemein darstellbar als Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle \pi_{t,t - 1} = \frac{\left( P_{t} - P_{t - 1} \right)}{P_{t - 1}}} . Durch Umformen der Gl. (2.1.2) und Einsetzen der Inflationsraten erhält man:
Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \frac{E_{\frac{AGE}{BGE,t}} - E_{\frac{AGE}{BGE,t - 1}}}{E_{\frac{AGE}{BGE,t - 1}}} = \left( \pi_{A,t,t - 1} - \pi_{B,t,t - 1} \right)\left( 1 - \frac{\pi_{B,t,t - 1}}{1 + \pi_{B,t,t - 1}} \right)\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ (2.1.3)}
Sind die Inflationsraten in beiden Ökonomien eher niedrig, so entspricht die rechte Seite von Gl. (2.1.2) Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle \approx \pi_{A,t,t - 1} - \pi_{B,t,t - 1}} . Daraus folgt, dass die Veränderung des Wechselkurses innerhalb einer Periode ungefähr der Differenz der Inflationsraten in den betreffenden Ökonomien entspricht. Diese Aussage behält auch dann ihre Gültigkeit, wenn die Annahme der absoluten KKP nicht gegeben ist: Wenn die Abweichungen von den absoluten KKP vergleichsweise stabil bleiben, dann entsprechen prozentuale Veränderungen der relativen Preisniveaus annähernd den prozentualen Veränderungen der Wechselkurse.
Langfristige Wechselkursbestimmung
Der KKP-Ansatz lässt sich erweitern um Faktoren, die die Geldnachfrage und das Geldangebot verändern. Dieser monetäre Ansatz gibt erste Aufschlüsse über die langfristige Entwicklung der Wechselkurse sowie das Wechselspiel verschiedener Einflussfaktoren. „Langfristig“ bedeutet hier, dass sich die Preise auf veränderte Verhältnisse anpassen.
Das Preisniveau einer Ökonomie lässt sich allgemein darstellen als
wobei Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle M^{S}}
das Geldangebot darstellt und Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle L}
die aggregierte Geldnachfragefunktion, die wiederum negativ abhängt vom Zinssatz Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle R}
und positiv von der realen Produktion . Das Preisniveau ist also grundsätzlich die Geldmenge dividiert durch die reale Geldnachfrage. [18] Nimmt man der Einfachheit halber in beiden Ökonomien identische Geldnachfragefunktionen an, so ergibt sich für die Ökonomien A und B
und Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle P_{B,t} = \frac{M_{B,t}^{S}}{L\left( R_{BGE,t},Y_{B,t} \right)}}
. Betrachtet man diese Beziehungen gemeinsam mit Gl. (2.1.1), so wird deutlich, dass der Wechselkurs langfristig ausschließlich vom relativen Angebot der Währungen und der relativen Nachfrage nach ihnen bestimmt wird. Einsetzen der Beziehungen in Gl. (2.1.2) ergibt:
Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \frac{E_{\frac{AGE}{BGE,t}}}{E_{\frac{AGE}{BGE,t - 1}}} = \frac{M_{A,t}^{S}M_{B,t - 1}^{S}L\left( R_{AGE,t - 1},Y_{A,t - 1} \right)L\left( R_{BGE,t},Y_{B,t} \right)}{M_{A,t - 1}^{S}M_{B,t}^{S}L\left( R_{AGE,t},Y_{A,t} \right)L\left( R_{BGE,t - 1},Y_{B,t - 1} \right)}\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ (2.1.5)}
Daraus ergeben sich eine Reihe relevanter Prognosen über die Entwicklung eines Wechselkurses, im Beispielfall für Länder A und B:
Eine Erhöhung der Geldmenge in A, d.h. Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle \frac{M_{A,t}^{S}}{M_{A,t - 1}^{S} > 1}} , erhöht den Wechselkurs (in Preisnotierung), d.h. AGE wird gegenüber BGE abgewertet. Das geht aus Gl. (2.1.5) hervor, da die neue Geldmenge im Zähler steht, die alte dagegen im Nenner. Der Wirkungskanal läuft über den Einfluss auf das Preisniveau, da eine Ausweitung der Geldmenge langfristig eine Erhöhung des Preisniveaus im selben Ausmaß nach sich zieht. Somit führt eine höhere Inflation in Land A zu einer Abwertung seiner Währung. Analog geht aus Gl. (2.1.5) hervor, dass eine Reduktion der Geldmenge in B denselben Effekt auf den Wechselkurs hat. Das gilt natürlich auch umgekehrt.
Eine Erhöhung des Zinssatzes in A erhöht den Wechselkurs, da die reale Geldnachfrage in A reduziert wird. In Gl. (2.1.5) ist das über die aggregierte Geldnachfrage ersichtlich, die vom Zinssatz negativ beeinflusst wird: Je höher die Zinsen, umso niedriger die Nachfrage. Analog wird eine Erhöhung des Zinssatzes in B den Wechselkurs senken, eine Reduktion des Zinssatzes in A den Wechselkurs senken, und eine Reduktion des Zinssatzes in B den Wechselkurs erhöhen.
Eine Erhöhung des Produktionsniveaus in A erhöht die reale Geldnachfrage in A und reduziert den Wechselkurs, da ohne entsprechende Ausweitung der Geldmenge das Preisniveau reduziert wird. Demnach ändern sich die KKP und die Währung AGE wertet auf. Analog führt eine Ausweitung der Produktion in B zu einer Erhöhung des Wechselkurses, eine Reduktion der Produktion in A zu einer Senkung des Wechselkurses, und eine Reduktion der Produktion in B zu einer Erhöhung des Wechselkurses.
Zum Verständnis dieser Ergebnisse sind zwei wichtige Zusammenhänge zu beachten: Erstens passieren in der Regel alle sechs Ereignisse gleichzeitig, entsprechend den drei erklärenden Variablen in zwei Ökonomien in Gl. (2.1.5). So geht bspw. eine Ausweitung der Produktion (d.h. BIP-Wachstum) einher mit steigenden Zinsen und einer Ausweitung des Geldangebots. Entscheidend für den Wechselkurs ist, wie sich diese Variablen relativ zur anderen Ökonomie entwickeln. Angenommen, B weist ein höheres Wirtschaftswachstum auf als A, erhöht die Zinsen im selben Ausmaß wie A, ist bei der Ausweitung der Geldmenge aber zurückhaltender. In diesem Fall wird die Währung von B eindeutig aufwerten. Was aber, wenn B bei der Ausweitung der Geldmenge großzügiger ist? Dann besteht sowohl ein Abwertungs- wie ein Aufwertungsdruck, und ob der Wechselkurs steigt oder fällt hängt von der konkreten Ausprägung von Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle L} ab.
Zweitens geht der monetäre Ansatz davon aus, dass sich die Umstände sofort und ohne Übergangsphase anpassen, d.h. die Preisniveaus passen sich ebenso schnell an wie die Wechselkurse. Das führt zu einem augenscheinlichen Widerspruch zur üblichen Berichterstattung in der Presse, wonach eine Erhöhung des Zinssatzes die betreffende Währung aufwertet. Der Unterschied liegt, wie bei vielen ökonomischen Fragen, in der Unterscheidung zwischen kurzer und langer Frist.
Kurzfristige Wechselkursbestimmung
Grundsätzlich gilt, dass ein anhaltendes Geldmengenwachstum einen ständigen Anstieg des Preisniveaus verlangt, d.h. zu laufender Inflation führt. Unternehmen und Arbeitnehmer*in passen sich an die gewohnte Inflationsrate an und werden diese bei ihren Gehaltsverhandlungen entsprechend berücksichtigen. Geht man davon aus, dass das Angebot der Produktion langfristig vom Geldmengenwachstum unabhängig ist, so führt ceteris paribus ein Geldmengenwachstum mit konstanter Rate zu einer Inflation mit derselben Rate.
Im Unterschied dazu ist jedoch der Zinssatz nicht unabhängig von der Inflation. Der langfristige Zinssatz wird zwar nicht von der Geldmenge als solcher bestimmt, allerdings muss sich das Geldmengenwachstum in den Zinssätzen widerspiegeln. Liegt die Inflation höher als der nominelle Zinssatz, dann ist der reale Zinssatz negativ. In der realen Welt mag das zwar hin und wieder vorkommen, aber hier ist zu berücksichtigen, dass (i) die Inflation der Zukunft nicht genau bekannt ist, der gegenwärtige Zinssatz also die erwartete Inflation berücksichtigt und (ii) üblicherweise der aktuelle nominelle Zinssatz über der aktuellen Inflationsrate liegt. [19]
Bei freiem Kapitalverkehr fließen Spargelder jenen Investitionen zu, die am meisten Ertrag versprechen. Gewinnmaximierende Anleger*innen werden ihre Wertpapiere so lange umschichten, bis Anlagen bei vergleichbarem Risiko die gleiche Rendite abwerfen. Dieses Verhalten führt zu einer Angleichung der Zinssätze. Zwischen Einlagen in den Währungen AGE und BGE herrscht Zinsparität, wenn gilt:
Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle R_{AGE,t} = R_{BGE,t} + \frac{E_{\frac{AGE}{BGE,t + 1}} - E_{\frac{AGE}{BGE,t}}}{E_{\frac{AGE}{BGE,t}}}\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ (2.1.6)}
wobei der Wechselkurs Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle E_{\frac{AGE}{BGE,t + 1}}} zum Zeitpunkt noch nicht bekannt ist und nur erwartet werden kann. Die in Gl. (2.1.6) dargestellte Zinsparität besagt daher, dass der nominelle Zins einer Einlage in AGE gleich dem nominellen Zins einer Einlage in BGE plus der erwarteten Änderung des Wechselkurses über den Zeitraum der Veranlagung sein muss. Ist die Zinsparität nicht gegeben oder wird ein Zinssatz verändert, dann führt dies zu einer Kapitalbewegung in Richtung jener Ökonomie, die den höheren Zinssatz bietet. Eine solche Bewegung kann aber nicht auf Dauer vonstattengehen, sondern wird über die Anpassung der Wechselkurse automatisch beendet. Wenn der Zinssatz für Einlagen in BGE erhöht wird, dann geht dies einher mit der Erwartung einer Aufwertung von BGE, d.h. der zweite Term auf der rechten Seite in Gl. (2.1.6) wird kleiner, oder, gleichlautend, BGE wertet auf.
Aus Gl. (2.1.6) folgt freilich auch, dass bei Auslandsanlagen erwartete Wechselkursänderungen einberechnet werden müssen. Nimmt bspw. ein*e Anleger*in an, dass AGE gegenüber BGE um 10% aufwerten wird, dann muss der Zinssatz für denselben Zeitraum für Einlagen in AGE um 10 Prozentpunkte höher sein. Somit werden Erwartungen über Wechselkurse, die bspw. – wie oben ausgeführt – aus Erwartungen über das Wirtschaftswachstum und/oder dem Verhalten der Notenbank resultieren können, die relativen Zinssätze beeinflussen.
Der Fisher-Effekt
Aus den relativen KKP geht hervor, dass die Veränderung des Wechselkurses von den Inflationsraten in den Ländern abhängt. Da sich die Marktteilnehmer*innen dieser Beziehung bewusst sind, erwarten Sie folglich, dass sie eintritt. Wenn dies aber allgemein erwartet wird, dann ist die Differenz zwischen den Zinssätzen abhängig von den Inflationsraten – oder, wie aus Gl. (2.1.3) hervorgeht, bei hinreichend niedrigen Inflationsraten ist die Differenz sogar annähernd gleich.
Um diesen Zusammenhang zu sehen, kann man Gl. (2.1.6) umformen und die rechte Seite von Gl. (2.1.3) für die Wechselkursänderung einsetzen:
Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle R_{AGE,t} - R_{BGE,t} = \left( \pi_{A,t,t + 1} - \pi_{B,t,t + 1} \right)\left( 1 - \frac{\pi_{B,t,t + 1}}{1 + \pi_{B,t,t + 1}} \right)\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ (2.1.7)}
Zu berücksichtigen ist hier wiederum, dass die Inflationsraten zwischen Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle t} und Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle t + 1} zum Zeitpunkt nur erwartet werden können. Wenn, wie aufgrund der KKP zu erwarten, die Währungsabwertung das Inflationsgefälle ausgleicht, dann muss die Zinssatzdifferenz bei hinreichend niedrigen Inflationsraten fast gleich der erwarteten Inflationsdifferenz sein. Anders formuliert geht aus Gl. (2.1.7) hervor, dass bei ansonsten gleichen Bedingungen ein Anstieg der erwarteten Inflationsrate eines Währungsraums den Zinssatz auf Einlagen in seiner Währung langfristig im gleichen Verhältnis wachsen lässt – und vice versa bei einem Rückgang der Inflationsraten. Diese langfristige Beziehung zwischen Inflation und Zinssätzen wird als Fisher-Effekt [20] bezeichnet.
Der Fisher-Effekt erklärt somit den scheinbar paradoxen Zusammenhang, wonach eine Währung abwertet, wenn der Zinssatz steigt: Dies folgt aus dem in Gl. (2.1.7) ersichtlichen Zusammenhang. In der kurzen Frist sind jedoch die Preise starr. Der Zinssatz kann kurzfristig sogar steigen, wenn die inländische Geldmenge sinkt, weil die inländische Preisniveaustarrheit zum ursprünglichen Zinssatz einen Nachfrageüberhang bei der realen Geldmenge auslöst. So kommt es zu kurzfristigen Ungleichgewichten, deren langfristige Auswirkungen jedoch neutral sind.
Wechselkursschwankungen
Gemäß der Zinsparität gleichen sich bei freiem internationalem Kapitalverkehr die Renditen von Wertpapieren unterschiedlicher Währungen an - zuzüglich eines Auf- oder Abschlags für erwartete Wechselkursänderungen. Die beiden Theorien der Zinsparität und der Kaufkraftparität beschreiben somit das langfristige Marktgleichgewicht für Zinsen und Wechselkurse. Kurzfristig gibt es bei den Wechselkursen täglich Fluktuationen, sie schwanken in kaum vorhersehbaren Mustern. Wechselkursrisiken betreffen somit nicht nur den Besitz der Währung als solcher, sondern auch in der jeweiligen Währung notierten Wertpapiere.
Wechselkursschwankungen entstehen vor allem, weil die Gelder für Käufe und Verkäufe von ausländischen Wertpapieren sehr viel unregelmäßiger fließen als die Zahlungen für Güter. Wertpapiere als spekulative Anlagen werden an einem Tag in Milliardenhöhe nachgefragt und am nächsten Tag wieder abgestoßen. Da das Angebot an Wertpapieren eines Landes sowie seiner Währung begrenzt ist, kann eine gestiegene Nachfrage nur über den Preis reguliert werden – und so u.U. auch zu Spekulationsblasen führen. Aber auch ohne das Auftreten solcher Blasen beeinflussen internationale Kapitalströme den täglichen Wechselkurs.
Wechselkursschwankungen führen naturgemäß zu Unsicherheiten auf den internationalen Märkten und betreffen die folgenden Bereiche:
- Zunächst einmal berühren Wechselkursschwankungen den Außenhandel: Importeur*innen und Exporteur*innen tragen ein Wechselkursrisiko, insbesondere dann, wenn Verträge über zukünftige Lieferungen abgeschlossen werden. Zwar kann man sich gegen das Risiko absichern, etwa indem man den Vertrag in der eigenen Landeswährung abschließt. Dann allerdings wird das Risiko lediglich auf den*die Handelspartner*in im Ausland übertragen. Ist diese*r dazu nicht bereit, kann man sich gegen Wechselkursschwankungen versichern lassen, was freilich mit Prämienzahlungen verbunden ist.
- Wechselkursschwankungen haben einen Effekt auf die Konjunktur, da der Wert der Währung den Außenhandel beeinflusst: Wertet die eigene Währung auf, dann werden Exporte erschwert und der Import von Gütern angeregt – die Gesamtnachfrage nach einheimischen Gütern wird gebremst, die Konjunktur gedämpft. Den umgekehrten Effekt hat eine zu billige Währung. Zwar ergibt sich aus Gl. (2.1.5), dass Wechselkurse als Korrektiv für unterschiedliche Wachstumsraten wirken und somit Wechselkurse auf das Wirtschaftswachstum reagieren – aber das gilt nur für die lange Frist. Kurzfristig können spekulationsbedingte Wechselkursschwankungen umgekehrt die Konjunktur und somit das Wirtschaftswachstum positiv oder negativ beeinflussen.
- Kurzfristige spekulationsbedingte Wechselkursschwankungen können sich selbst verstärken und aufgrund der Erwartungen die Wirtschaft langfristig beeinträchtigen: Ist die eigene Währung für längere Zeit überteuert, wandern Betriebe ab, die Arbeitslosigkeit steigt und bleibt möglicherweise für längere Zeit hoch, was die Konjunktur dämpft. Bleibt die Währung aus Spekulationsgründen längere Zeit zu teuer, so wird dies auch den Außenhandel längerfristig beeinflussen und die Schäden für die Ökonomie können insgesamt sehr groß sein.
Vor allem der letztgenannte Bereich lässt es attraktiv erscheinen, Wechselkursschwankungen zu reduzieren oder völlig zu eliminieren. Beispielsweise war die exportorientierte Industrie Österreichs während der Jahre der Deutsche-Mark-Bindung von Wechselkursrisiken gegenüber dem wichtigsten Handelspartner de facto befreit. Andererseits war Österreich damit automatisch der Wirtschaftspolitik der BR Deutschland ausgeliefert. Die BR Deutschland hat naturgemäß eine Wirtschaftspolitik verfolgt, die ihren eigenen Zielen diente und für Österreich in der spezifischen Situation durchaus nachteilig sein konnten - dies betrifft zum Beispiel die Zinspolitik, über die Investitionen und Konsum beeinflusst werden.
Währungsunion
Eine ähnliche Währungspolitik wie Österreich haben andere kleinere europäische Länder verfolgt, deren wichtigster Handelspartner ebenfalls die BR Deutschland war, darunter die Niederlande oder die Schweiz. Indem diese Länder unilateral die Deutsche Mark als Ankerwährung nutzten und auf diese Weise die jeweiligen Wechselkurse fixiert haben, reduzierten sich zwar einerseits die Wechselkursrisiken für den österreichischen Außenhandel noch einmal beträchtlich, da Österreich sich in einer inoffiziellen Währungsunion mit jenen Ländern befand, die die gleiche Politik verfolgten. Einer Währungsunion freilich, in der die Wirtschaftspolitik de facto vom Land der Ankerwährung bestimmt wurde, und die von den anderen Ländern freiwillig übernommen wurde.
Wenn aber ohnehin viele Länder eine ähnliche Wirtschaftspolitik betreiben und ihre Geldpolitik freiwillig angleichen, wäre es dann nicht vernünftig, gleich eine Einheitswährung für alle Länder einzuführen? Auf diese Weise würde nicht ein Land die Entwicklung in den anderen bestimmen, sondern man könnte sich am Interesse aller beteiligten Länder orientieren. Dieses Kalkül war die wichtigste ökonomische Begründung für die Einführung des Euro.
Bei unterschiedlichen Interessen können selbst multilaterale Verträge über fixe Wechselkurse einseitig gekündigt werden, oder Wechselkurse werden bei unterschiedlichen Inflationsraten von Zeit zu Zeit angepasst. Ein Problem, das sich aus dieser Unsicherheit der potenziell jederzeit möglichen Kündigung fixer Wechselkurse ergibt, ist die Spekulation: Wird eine Anpassung erwartet und ist noch nicht erfolgt, lassen sich über entsprechende Währungskäufe und
-verkäufe (zumindest zum Teil auf Kosten der Allgemeinheit) Vermögen verdienen. [21]Somit ist der nächste Schritt fixer Wechselkurse mehrerer Länder eine echte Währungsunion, in der ebendiese Länder dieselbe Währung übernehmen und folglich auch dieselbe Geldpolitik. Natürlich kann auch eine Währungsunion wieder aufgelöst werden, aber das ist wesentlich aufwändiger als eine unilaterale Aufgabe fixer Wechselkurse und daher wesentlich weniger wahrscheinlich. Und selbst wenn eine Auflösung erwartet wird, kann, solange die Währungsunion besteht, nicht auf die Abwertung oder Aufwertung einzelner Landeswährungen spekuliert werden.
Die Euro-Einführung
Mit einer Währungsunion verbunden sind freilich die meisten Nachteile fixer Wechselkurse. Auch wenn die einzelnen Mitgliedstaaten die Geldpolitik nun formal mitbestimmen können, kann es wirtschaftlich in den einzelnen Ländern zu Abweichungen kommen. Aus diesem Grund wurden vor der Euro-Einführung die EU-Konvergenzkriterien („Maastricht-Kriterien“) definiert, die ein EU-Mitgliedstaat erfüllen muss, bevor er der Währungsunion beitritt: [22]
- Preisstabilität: Die Inflationsrate darf während des letzten Jahres vor der Prüfung nicht mehr als 1,5 % über der Inflationsrate der drei EU-Länder liegen, [23] die auf dem Gebiet der Preisstabilität das beste Ergebnis erzielt haben. So soll nachgewiesen werden, dass die Inflation unter Kontrolle ist.
- Finanzlage der öffentlichen Hand: Durch die Begrenzung der staatlichen Kreditaufnahme und der Staatsverschuldung sowie der Vermeidung eines übermäßigen Defizits soll sichergestellt werden, dass die öffentlichen Finanzen stabil und tragbar sind. Das Defizit darf 3 % des nationalen BIP und die Verschuldung 60 % des nationalen BIP nicht überschreiten.
- Wechselkursstabilität: Das Land, das den Euro einführen möchte, muss mindestens zwei Jahre lang am Wechselkursmechanismus zwischen dem Euro und den Währungen der EU-Länder, die den Euro nicht eingeführt haben, teilgenommen haben. Außerdem darf seine Währung in diesem Zeitraum keine größeren Spannungen verzeichnet haben. Insbesondere darf in diesem Zeitraum keine Abwertung stattgefunden haben.
- Konvergenz der Zinssätze: Der langfristige Zinssatz darf um nicht mehr als 2 Prozentpunkte über dem entsprechenden Satz in den drei Ländern des Euro-Währungsgebiets liegen, die das beste Ergebnis erzielt haben.
Der Grund für die Preisstabilitäts-Regel ergibt sich aus Gl. (2.1.3): Weichen die Inflationsraten zweier Länder voneinander ab, werden sich die Wechselkurse entsprechend anpassen. Da es in einer Währungsunion naturgemäß keine Wechselkurse gibt, entsteht bei unterschiedlichen Inflationsraten ein Ungleichgewicht: Jene Ökonomie mit höheren Inflationsraten kann ihre Währung nicht abwerten, deshalb wertet sie in einer Währungsunion de facto auf. Die Folgen sind ähnlich zu jenen einer in Lektion 2.1.7 beschriebenen Überbewertung einer Währung.
Die Sinnhaftigkeit der Finanzlage der öffentlichen Hand ergibt sich aus dem Druck auf Zinsen, den öffentliche Schulden ausüben: Weitet ein Mitglied der Währungsunion seine Staatsschulden aus, dann beeinflusst es durch das zusätzliche Angebot an Wertpapieren in Form der Staatsanleihen auch den Zinssatz der anderen Mitglieder. Darüber hinaus entfällt der Zinsaufschlag, der von Gläubiger*innen als Kompensation für das nationale Inflations- und Abwertungsrisiko verlangt wird, wodurch sich Länder mit höherer Inflation innerhalb der Währungsunion relativ billiger verschulden können. Die Grenze dient also primär der Eindämmung des Einflusses unilateraler wirtschaftspolitischer Entscheidungen auf andere Länder der Union.
Die Bedeutung der Wechselkursstabilität sowie der Konvergenz der Zinssätze folgt aus Gl. (2.1.5), aus der hervorgeht, dass eine entsprechende Stabilität nur bei einer gewissen Ähnlichkeit der teilnehmenden Länder hinsichtlich des Wechselspiels von Geldnachfrage und Geldangebot gegeben ist, und umgekehrt unterschiedliche Zinssätze einen Einfluss auf die Wechselkurse haben, mit entsprechendem Aufwertungs- oder Abwertungsdruck.
Die Euro-Krise: Ursachen
Wie die bisherige Analyse zeigt, dienen Wechselkurse als Mechanismus, Ungleichgewichte zu korrigieren. Deshalb ist es zum Funktionieren einer Währungsunion unumgänglich, dass die Wirtschaftspolitik koordiniert wird, da die letzte Möglichkeit bei festen Wechselkursen – die Ab- oder Aufwertung – nicht mehr möglich ist. Ist bspw. die Inflation in einem Land permanent höher als in einem anderen Land innerhalb der Währungsunion, so wird die Produktion in dem Land mit der höheren Inflation laufend teurer, und es erleidet einen Wettbewerbsnachteil – die Folge ist ein Leistungsbilanzdefizit. Wie die Analyse der Zahlungsbilanz jedoch zeigt, sind permanente Leistungsbilanzdefizite (ohne Schenkungen) unmöglich.
Die Inflationsrate eines Landes hängt maßgeblich von den Erwartungen über die zukünftige Inflation ab. In den südeuropäischen Ländern der Eurozone fielen die Lohnabschlüsse – vermutlich deshalb, weil in diesen Ländern die Inflation vor der Euro-Einführung traditionell höher war – in den ersten zehn Jahren höher aus als im Durchschnitt der Eurozone. Entscheidend ist hier das Verhältnis zur Produktivität: Wenn die Lohnerhöhungen in einem Land höher sind als der Zuwachs an Produktivität, [24] dann steigen die Güterpreise entsprechend, da die Unternehmen diese Kosten an die Konsument*innen weiter, wodurch sich die Inflationsrate erhöht. Ist die Differenz zwischen Lohnwachstum und Produktivitätswachstum in einem Land der Währungsunion höher als im anderen, dann erleidet das erste Land Wettbewerbsnachteil auf den Exportmärkten, den das zweite Land gewinnt. [25]
Die EZB hat in ihren Statuten als Hauptaufgabe die Gewährleistung der Preisstabilität festgelegt, definiert als Inflationsrate von knapp unter 2% jährlich. Allerdings kann die EZB die Preise nicht direkt kontrollieren, sondern muss die Preisstabilität über ihre geldpolitische Strategie bewirken. Insbesondere kann sie den Inflationsdruck, der über Lohnabschlüsse entsteht, nicht beeinflussen. Während also in südeuropäischen Ländern (Griechenland, Italien, Portugal, Spanien) die Inflationsraten in den ersten Jahren der Eurozone höher als 2% lagen, lagen andere Länder teilweise weit darunter. Insbesondere in Deutschland durch die „Agenda 2010“ und, etwas schwächer, in Österreich wurden die Lohnerhöhungen mit politischem Druck niedrig gehalten. Die Differenz zum Produktivitätswachstum war geringer ausgeprägt als in den südeuropäischen Ländern, was die deutschen und österreichischen Güter relativ verbilligte.
In der oberen Abbildung wird die kumulative inländische Preisentwicklung anhand der BIP-Deflatoren für die ersten zehn Jahre des Euro für ausgewählte Länder dargestellt. [26] Wie man sehen kann, entspricht der kumulierte BIP-Deflator für die gesamte Euro-Zone ziemlich genau dem von der EZB formulierten Inflationsziel von knapp unter 2%. Man sieht allerdings auch, dass die südeuropäischen Länder permanent darüber, Deutschland und Österreich hingegen permanent darunter lagen. Lediglich Frankreich hat sich an das EZB-Ziel gehalten und liegt fast genau auf der Kurve der Eurozone. Alle anderen abgebildeten Länder weichen deutlich ab. Zu berücksichtigen sind hier zwei Fakten:
- Erstens, eine Abweichung nach unten stellt genauso eine Verfehlung des EZB-Ziels dar wie eine Abweichung nach oben.
- Zweitens, wer sich an das EZB-Ziel hält, ist dennoch gegenüber jenen Ländern benachteiligt, die das Ziel unterbieten.
Zusammengefasst haben sich Deutschland und Österreich auf den Exportmärkten einen Vorteil verschafft, indem sie die Produktionskosten über die Lohnpolitik relativ zu den anderen Mitgliedstaaten der Eurozone reduziert haben. So kommt es innerhalb der Euro-Zone zu unterschiedlichen Preisentwicklungen, die Folgen sind insbesondere:
- Erstens, Leistungsbilanzüberschüsse in jenen Ländern, die das Inflationsziel unterboten haben, bei gleichzeitigen Leistungsbilanzdefiziten in jenen Ländern, die sich an das Inflationsziel gehalten haben oder kumulativ darüber lagen.
- Zweitens, sinkende Lohnquoten in jenen Ländern, die das Inflationsziel unterboten haben, da die niedrige Inflation über das Niedrighalten der Löhne erreicht wurde.
Tatsächlich haben sich die Reallöhne in Deutschland und Österreich trotz moderaten Wirtschaftswachstums in den ersten zehn Jahren der Euro-Mitgliedschaft kaum erhöht. Entsprechend des Inflationsziels der EZB müssten die nominellen Lohnerhöhungen in jedem Land der Formel „Produktivitätssteigerung plus 2% Inflation“ folgen. Da die tatsächlichen Lohnerhöhungen in Österreich regelmäßig darunter lagen, hat sich auch die Einkommensverteilung in Richtung Kapital verschoben. [27] Dementsprechend ist die Lohnquote in Österreich in den ersten zehn Jahren der Euro-Mitgliedschaft um fast 10%, von 69,2% auf 63,9%, zurückgegangen. [28]
Die Euro-Rahmenbedingungen als Gefangenendilemma
Der Grundkonflikt der europäischen Währungsunion ist also insbesondere darin zu sehen, dass zwar die Geldpolitik von der EZB und somit formal im Interesse aller gestaltet wird, die Lohnpolitik jedoch in den Mitgliedstaaten bestimmt wird und es keine offizielle Regelung gibt, wie sie gestaltet werden soll und es erst recht keine Sanktionen, wenn einzelne Länder systematisch versuchen, andere zu unterbieten. Dieses Problem lässt sich auch als Gefangenendilemma darstellen, in dem jedes Land der Eurozone die Wahl hat, sich in der Lohnpolitik an die Formel „Produktivitätssteigerung plus 2%“, entsprechend der von der EZB angestrebten Inflationsrate, zu halten, oder sie zu unterbieten. Die Auszahlungen entsprechen dem erwarteten Wirtschaftswachstum und sind in folgender Tabelle dargestellt.
|
Land 2 | Land 2 | |
|---|---|---|---|
| hält sich an Formel | unterbietet Formel | ||
|
hält sich an Formel | 2%, 2% | 0,5%, 2,5% |
|
Land 1 |
unterbietet Formel | 2,5%, 0,5% | 1%, 1% |
Die Lohnpolitik in der Eurozone als Gefangenendilemma
In obiger Tabelle haben zwei Länder die Wahl, sich bei den jährlichen Lohnabschlüssen an die Formel „Produktivitätssteigerung plus 2%“ zu halten, oder sie zu unterbieten. Halten sich beide Länder daran, beträgt das reale Wirtschaftswachstum in beiden Ländern 2% (was in etwa dem langjährigen Schnitt vor Einführung des Euro entspricht). Wenn ein Land abweicht und die Formel unterbietet, das andere Land sich hingegen daran hält, so erzielt das erste Land durch die relative Lohnsenkung einen Wettbewerbsvorteil auf den Exportmärkten. Allerdings geht durch den relativen Lohnrückgang auch die Kaufkraft zurück, was die Konjunktur dämpft: Die Konsument*innen in Land 1 fragen weniger nach, weshalb das durchschnittliche Wachstum beider Länder niedriger ausfällt (1,5% statt 2%). Das unterbietende Land hat allerdings einen klaren Wachstumsvorteil, wobei sich innerhalb des Landes die Einkommensverteilung zugunsten des Produktionsfaktors Kapital verschiebt. Unterbieten beide Länder die Formel, so kann kein Land einen Wettbewerbsvorteil erzielen; allerdings geht in beiden Ländern die Kaufkraft zurück, was die Konjunktur dämpft, und das durchschnittliche Wachstum beider Länder ist das niedrigste aller Szenarien.
Während jährliche Schwankungen – nicht zuletzt durch die Starrheit der Preise – kaum Auswirkungen haben, sind die Auswirkungen der kumulativen Entwicklung dramatisch. Folgende Abbildung stellt den kumulativen BIP-Deflatoren der ersten zehn Jahre des Euro das reale Wachstum seit Ausbruch der Krise gegenüber. Wie man sieht, besteht ein negativer Zusammenhang zwischen der Preisentwicklung innerhalb der Euro-Mitgliedstaaten und dem anschließenden BIP-Wachstum, der Korrelationskoeffizient für die in Abb. 2.1 dargestellten Daten beträgt -0,45. Besonders deutlich wird dieser Zusammenhang beim Vergleich von Deutschland und Frankreich, den beiden größten Volkswirtschaften innerhalb der Eurozone.
Die Euro-Krise: Ausblick
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass mit der Euro-Einführung der Wegfall der spekulativen Währungsschwankungen erkauft wurde um das Fehlen des ausgleichenden Effekts von Auf- und Abwertungen. Das durch Abb. 2.1 illustrierte Auseinanderklaffen der Produktionskosten innerhalb der Eurozone kann nicht über Nacht rückgängig gemacht werden, sondern bedarf eines längeren Anpassungsprozesses, um die bildhafte Schere in Abb. 2.1 wieder zu schließen. Allerdings ändert sich dadurch das in Tab. 2.1 dargestellte Dilemma nicht: Welche Lohnpolitik die anderen Länder der Eurozone auch verfolgen mögen, das eigene Land sollte die Lohnkosten möglichst wenig erhöhen oder sogar nominell senken. Zwar fielen die Lohnerhöhungen in Deutschland und Österreich in den 2010er-Jahren wieder etwas höher aus (vgl. auch Lektion 2.2.6). Allerdings sind sie im historischen Vergleich immer noch niedrig, sodass den südeuropäischen Ländern und Frankreich nichts anderes übrig bleibt, als sie zu unterbieten suchen. Auf diese Weise wird jedoch die Kaufkraft weiter reduziert und die Konjunktur kommt nicht in Schwung.
Hinzu kommen die volkswirtschaftlichen Kosten der Arbeitslosigkeit, die in allen Euro-Gründungsstaaten außer Deutschland im Jahr 2015 höher lag als im Jahr 2008. [29] Dadurch wird der Konsum noch einmal eingeschränkt, während den Staaten zusätzliche Kosten für Sozialausgaben entstehen. Angesichts der Persistenz der Euro-Krise ist mittlerweile fraglich, ob sich die Volkswirtschaften der Eurozone noch auf einem langfristigen Wachstumspfad befinden. Letztlich ist eine der Annahmen der Wachstumstheorie, dass die betreffende Ökonomie konjunkturelle Phänomene soweit im Griff hat, dass sie langfristig keine Auswirkungen haben. Trifft das nicht zu, so sind auch die Bedingungen für langfristiges Wachstum und der damit verbundenen Zunahme des Wohlstands nicht mehr gegeben. [30]
Als Fazit bleibt somit festzustellen, dass sich eine Währungsunion auf ein Inflationsziel einigen muss, das einzelne Länder nicht systematisch unter- oder überschreiten dürfen. Die Länder der Eurozone werden ihre kumulativen Inflationsraten anpassen müssen, um den entstandenen Schaden wenigstens für die Zukunft zu reduzieren. Während dies in den südeuropäischen Ländern durch reale Lohnsenkungen während der 2010er-Jahre bereits passiert, liegt es insbesondere an Deutschland, durch hohe Lohnabschlüsse auch eine höhere Inflation zuzulassen. Diese Lohnerhöhungen müssten mehrere Jahre über der Formel „Produktivitätssteigerung plus 2%“ liegen. Auf diese Weise würden die bislang unterbietenden Länder und insbesondere Deutschland mehr konsumieren und ihre Leistungsbilanzüberschüsse wieder abbauen.
Wettbewerbsfähigkeit
In einem vielbeachteten Essay hat sich der spätere Nobelpreisträger Paul Krugman dagegen ausgesprochen, das Konzept der Wettbewerbsfähigkeit von der Unternehmensebene auf Volkswirtschaften übertragen zu wollen. [31] Demnach sei es irreführend und sogar gefährlich, davon auszugehen, dass sich Volkswirtschaften auf eine ähnliche Weise im Wettbewerb zueinander befänden wie Unternehmen. Ein wesentlicher Unterschied zwischen der Wettbewerbssituation von Unternehmen und Ökonomien ergibt sich aus dem Ricardo-Modell, das zeigt, dass der Verlust von Marktanteilen auf Exportmärkten im Interesse beider Ökonomien sein kann, wohingegen Unternehmen üblicherweise um Marktanteile in bestimmten Segmenten kämpfen. Ein zweiter, augenscheinlicher Unterschied ist, dass „nicht wettbewerbsfähige“ Ökonomien im Unterschied zu Unternehmen nicht einfach vom Markt verschwinden, sondern weiterhin existieren. Hinzu kommt, dass Volkswirtschaften über ihre Regierungen die Rahmenbedingungen ihrer Wettbewerbsfähigkeit selbst beeinflussen können, während sie Unternehmen üblicherweise hinnehmen müssen.
Dennoch ist offensichtlich, dass auch Ökonomien zueinander in Konkurrenz stehen. Bereits im vorigen Abschnitt wurde der Preiswettbewerb erörtert, der sich insbesondere in einer Währungsunion ergeben kann. Hinzu kommt, dass Ökonomien als Standorte um Investitionen konkurrieren. Weiterhin kann auch der Arbeitsmarkt dahingehend interpretiert werden, dass Ökonomien ein Interesse daran haben, qualifizierte Arbeitnehmer*innen zu attrahieren bzw. zu halten.
Das Konzept der Preiswettbewerbsfähigkeit
Exporte, Importe und somit die Nettoexporte hängen letztlich davon ab, was in der eigenen Ökonomie produziert wird, wie hoch das Einkommen dieser Ökonomie ist, sowie der Produktion und dem Einkommen im Rest der Welt ab. Aus der mikroökonomischen Standard-Nachfragefunktion ergibt sich, dass die Nachfrage nach einem Gut üblicherweise von ihrem Preis abhängt. So lässt sich folgern, dass auch Exporte und Importe von ihren jeweiligen Preisen bestimmt werden. Die tatsächlich nachgefragte Menge ergibt sich somit aus den relativen Preisen sowie dem Einkommen, das zur Verfügung steht.
Die Importnachfrage einer Ökonomie ist folglich abhängig vom Preis eines importierten Guts relativ zum Preis des einheimischen Guts, das als Substitut zur Verfügung steht, bspw. südafrikanischer und österreichischer Wein. Gleichung (2.1.1) lässt sich für das konkrete Beispiel umformen. Angenommen, eine Flasche Cabernet Sauvignon aus Südafrika kostet 250 südafrikanische Rand (Symbol: Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle R} ). Bei einem Wechselkurs in Preisnotierung von Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle E_{Euro / R}=0,06} kostet die Flasche in Österreich somit Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle 250 \bullet 0,06\ = \ 15} Euro. Die Nachfrage nach südafrikanischem Cabernet Sauvignon wird in Österreich wird nun maßgeblich vom Preisverhältnis zu österreichischem Cabernet Sauvignon bestimmt: Steigt bspw. der Preis österreichischen Cabernet Sauvignons von 15 auf 20 Euro, so wird sich das Importvolumen südafrikanischen Cabernet Sauvignons erhöhen, da Letzterer nun billiger ist. Allgemein lässt sich die Importnachfrage einer Ökonomie A formulieren als
wobei das Einkommen in A, Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle Y_{A}} , einen positiven Einfluss auf die Importnachfrage in A, Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle M_{A}} , hat, während das Preisverhältnis einen negativen Effekt hat (d.h. je kleiner der Term Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle \frac{\left( P_{B}E_{\frac{AGE}{BGE}} \right)}{P_{A}}} , umso größer das Importvolumen). Analog lässt sich die Ausfuhr einheimischer Güter als Funktion des Einkommens im Ausland und des Preisverhältnisses darstellen als
wobei das Einkommen in B, Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle Y_{B}} , einen positiven Einfluss auf die Exportnachfrage von A, Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle X_{A}} , hat, und das Preisverhältnis nun ebenfalls einen positiven Effekt hat. Somit werden die Nettoexporte einer Ökonomie tendenziell umfangreicher ausfallen, wenn die Preiswettbewerbsfähigkeit von A steigt, d.h. je größer der Term Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle \frac{\left( P_{B}E_{\frac{AGE}{BGE}} \right)}{P_{A}}} ausfällt.
Auswirkungen der Preiswettbewerbsfähigkeit
Eine erhöhte Preiswettbewerbsfähigkeit wird sich somit auf die verschiedenen in Lektion 1.3 vorgestellten Konzepte tendenziell positiv auswirken, da sie das Exportvolumen erhöhen. Die Vorteile können eine ganze Ökonomie oder bestimmte Branchen betreffen. Beispielsweise verschaffen die durch neue Technologien in den USA gesunkenen Energiepreise energieintensiven Branchen in den USA einen Vorteil beim Preiswettbewerb, da sie die Produktionskosten senken und die betreffenden Unternehmen in der Lage sind, die Güterpreise in ihrer Währung zu senken, was – aus Sicht der USA als Exporteur – sinken lässt, wodurch Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle M_{USA}} sinkt und Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle X_{USA}} steigt.
Ebenso geht aus Gleichungen (2.2.1) und (2.2.2) hervor, dass Wechselkursänderungen die Preiswettbewerbsfähigkeit beeinflussen werden. Eine höhere Inflation in A, die sich nicht sofort auf den Wechselkurs auswirkt, kann somit zumindest temporär die Preiswettbewerbsfähigkeit beeinflussen. Dieser Effekt wird eher bei gelenkten und festen Wechselkursen zu beobachten sein, wo es häufig zu abrupten Abwertungen oder Aufwertungen einer Währung kommt. Allerdings können auch – wie in Lektion 2.1.7 diskutiert – Wechselkursschwankungen durch Erwartungen der Spekulanten zu einer längeren Über- oder Unterbewertung einer Währung führen, mit entsprechenden Auswirkungen auf die Preiswettbewerbsfähigkeit.
Aus zwei Gründen wirken sich Veränderungen in den Preisniveaus jedoch nur in abgeschwächter Form auf die Preiswettbewerbsfähigkeit aus:
- Erstens können Transportkosten und handelspolitische Maßnahmen das Preisverhältnis beeinflussen, indem sie den Preis der importierten Waren erhöhen. Ein Beispiel hierfür sind die regelmäßigen Auseinandersetzungen der EU und der Volksrepublik China, die die EU mitunter veranlassen, zusätzliche Zölle für chinesische Waren einzuführen (zB bei Solarmodulen).
- Zweitens wenden Exporteur*innen häufig strategische Preissetzungen an, indem der Preis der Ware in heimischer Währung nicht unbedingt dem Preis in Fremdwährung entspricht. Diese Strategie entspricht einer internationalen Preisdiskriminierung, bei der unterschiedliche Preise auf unterschiedlichen Märkten verlangt werden. Diese Strategie lässt sich häufig beobachten, wenn Wechselkursschwankungen (sowohl nach oben wie nach unten) nicht oder nicht in voller Höhe an die ausländischen Kund*innen weitergereicht werden, sondern die Preise im Ausland konstant gehalten werden.
Reale Wechselkurse
Besonders heikel ist das Thema der Preiswettbewerbsfähigkeit in einer Währungsunion, die durch den Wegfall der Wechselkurse nur noch von den Preisverhältnissen abhängt, welche wiederum von den Produktionskosten beeinflusst werden. Wie in Lektion 2.1.10 gezeigt wurde, sind diese innerhalb der Eurozone durch unterschiedliche Lohnentwicklungen divergiert. In einer Währungsunion kann der Preiswettbewerb durch den Wegfall von Aufwertungen und Abwertungen über die Lohnkosten geführt werden, mit entsprechenden negativen Auswirkungen auf die Einkommen der Arbeitnehmer*innen, was sich in letzter Konsequenz wiederum auf die Nettoexporte auswirken wird: Geraten einige Länder – wie in der Eurozone der
Fall – in eine Rezession, so geht in Gl. (2.2.2) Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle Y_{B}}
zurück.
Das Konzept der Preiswettbewerbsfähigkeit lässt sich mit den realen KKP zum Konzept der realen Wechselkurse verbinden:
Diese Formel ist naturgemäß dann relevant, wenn Gl. (2.1.2) nicht erfüllt ist. Angenommen, Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle P_{A,t} = 3} , Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle P_{B,t} = 5} , Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle P_{A,t - 1} = 2} , . Daraus ergibt sich ein Anstieg des Wechselkurses in Preisnotierung aus Sicht von A von 0,5 auf 0,6, d.h. die Währung von B sollte gemäß Gl. (2.1.2) um 20% aufwerten und Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle \frac{E_{\frac{AGE}{BGE,t}}^{r}}{E_{\frac{AGE}{BGE,t} - 1}^{r} = 1}} . Angenommen, der nominelle Wechselkurs beträgt zum Zeitpunkt Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle t} jedoch – aus welchen Gründen auch immer – nur 0,55. Dann ist Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle \frac{E_{\frac{AGE}{BGE,t}}^{r}}{E_{\frac{AGE}{BGE,t} - 1}^{r} = 1},09} – bei konstanten Einkommen in eigener Währung kann ein Einwohner*in von A nun 9% mehr Güter aus B erwerben. Da erwartet wird, dass sich der reale Wechselkurs langfristig bei 1 einpendelt, sagt man auch, die Währung sei zurzeit überbewertet. Analog bezeichnet eine Unterbewertung einer Währung den Fall . Man beachte, dass eine Unter- und Überbewertung einer Währung somit nur im Zeitverlauf einer sinnvollen Aussage entspricht.
Betrachtet man den realen Wechselkurs zweier Ökonomien, die sich in einer gemeinsamen Währungsunion befinden, so verdeutlicht Gl. (2.2.3) noch einmal das Hauptproblem der europäischen Währungsunion: Da es keine nominellen Wechselkurse gibt, ist zwangsläufig stets Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle \frac{E_{\frac{AGE}{BGE,t}}}{E_{\frac{AGE}{BGE,t} - 1}} = 1} . Ändern sich jedoch die Preisniveaus, dann kommt es zu Unter- und Überbewertungen im Sinne realer Wechselkurse. Ist zum Beginn der Währungsunion Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle P_{A,t - 1} = P_{B,t - 1}} , entwickeln sich die Preisniveaus – insbesondere aufgrund unterschiedlicher Lohnpolitiken – unterschiedlich, sodass bspw. Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle P_{A,t} > P_{B,t}} . In diesem Fall ist die fiktive Währung von A überbewertet, und das Land erleidet einen Preiswettbewerbsnachteil. Somit kann die in den Lektionen 2.1..0-2.1.12 skizzierte Euro-Krise auch als Ausdruck der Preiswettbewerbsfähigkeit interpretiert werden.
Lohnstückkosten
Die Lohnstückkosten sind eng verzahnt mit dem Konzept der Wettbewerbsfähigkeit, da sie die Entwicklung der Lohnkosten im Verhältnis zur Produktivität messen. Üblicherweise werden die nominellen Lohnstückkosten angegeben: [32]
Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle s_{t,t - 1} = \frac{\frac{w_{t}H_{t}^{U}}{U_{t}}}{\frac{Y_{t,t - 1}^{r}}{L_{t}}} = D_{t,t - 1}\frac{w_{t}H_{t}^{U}}{Y_{t}}\frac{L_{t}}{U_{t}}\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ (2.2.4)}
wobei Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle w_{t}} den Stundenlohn, Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle H_{t}^{U}} die Summe der Arbeitsstunden aller Arbeitnehmer*innen, das nominelle BIP, Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle Y_{t,t - 1}^{r}} das reale BIP zum Basisjahr Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle t - 1} und Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle D_{t,t - 1}\frac{= Y_{t}}{Y_{t,t - 1}^{r}}} den BIP-Deflator zwischen den Zeitpunkten und Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle t} bezeichnen. Diese Maße werden in Beziehung gesetzt zur Gesamtzahl der Arbeitnehmer*innen Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle U_{t}} und der Gesamtzahl der Erwerbstätigen Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle L_{t}} . Im mittleren Teil von Gl. (2.2.4) steht also im Zähler das Arbeitnehmerentgelt je Arbeitnehmer*in, im Nenner das reale BIP je Erwerbstätige*n. Indem die nominellen Lohnkosten in Beziehung zum realen BIP gesetzt werden, lässt sich ablesen, inwieweit die Lohnsteigerungen vom Produktivitätswachstum abweichen. Diese Grundidee wird bei Betrachtung der Zerlegung der Lohnstückkostenformel in drei Terme deutlich (rechter Teil der Gl. (2.2.4)): Der Term misst nichts anderes als den Lohnanteil am BIP (und ist daher der Lohnquote sehr ähnlich) [33] . Bleiben dieser Anteil sowie der Kehrwert des Anteils der Arbeitnehmer an der Erwerbstätigen, Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle \frac{L_{t}}{U_{t}}} , konstant, dann entsprechen die Lohnstückkosten zum Zeitpunkt Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle t} der Entwicklung des BIP-Deflators seit dem Basisjahr Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle t - 1} .
Da Arbeitnehmer und Erwerbstätige jedoch üblicherweise zu Vollzeitäquivalenten gemessen werden, gilt , mit Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle H_{t}} als Summe der Arbeitsstunden aller Erwerbstätigen. Somit lassen sich die Lohnstückkosten gemäß Gl. (2.2.4) auch darstellen als [34]
Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle s_{t,t - 1} = D_{t,t - 1}\frac{w_{t}H_{t}}{Y_{t}}\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ (2.2.5)}
Es wird also allen Erwerbstätigen (einschließlich der Selbständigen und Mithelfenden) der durchschnittliche Stundenlohn unterstellt und dieses Produkt wird durch das nominelle BIP dividiert. Betrachtet man die Lohnstückkosten nur zu einem bestimmten Zeitpunkt Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle t = t - 1} , dann ist und das Konzept der Lohnstückkosten reduziert sich auf Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle \frac{w_{t}H_{t}}{Y_{t}}} . Die entsprechende Zahl entspricht dem Anteil der Arbeitskosten am BIP unter der Annahme, dass die Arbeit der Selbständigen und Mithelfenden zum selben Satz wie jene der Unselbständigen entlohnt würde, wenn sie unselbständig wären. Aufgrund der Kühnheit dieser Annahme ist die Aussagekraft sehr begrenzt.
Sinnvoll ist daher eher die Betrachtung über die Zeit (was durch das Subskript Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle t,t - 1} betont wird): Steigt der Lohnsatz bei konstantem Arbeitseinsatz ebenso wie das nominelle BIP, dann entsprechen die Lohnstückkosten dem BIP-Deflator. Steigen die Löhne stärker, dann sind die Lohnstückkosten höher als der BIP-Deflator über den denselben Zeitraum. Da jedoch der BIP-Deflator seinerseits hochgradig von der Lohnentwicklung abhängt, wirken die Lohnstückkosten gewissermaßen als Verstärker des Preiseffekts der Lohnentwicklung, den der BIP-Deflator enthält.
Ein erweiterter Ansatz sind die realen Lohnstückkosten Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle s^{r}} , die den BIP-Deflator zum Verbraucherpreisindex in Beziehung setzen:
Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle s_{t,t - 1}^{r} = \frac{\frac{\left( \frac{w_{t}}{V_{t,t - 1}} \right)H_{t}^{U}}{U_{t}}}{\frac{Y_{t,t - 1}^{r}}{L_{t}}} = \frac{D_{t,t - 1}}{V_{t,t - 1}}\frac{w_{t}H_{t}}{Y_{t}}\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ (2.2.6)}
Diese Darstellung ist somit identisch mit Gl. (2.2.4) und (2.2.5), nur dass zusätzlich durch den Verbraucherpreisindex dividiert wird. Aufgrund ihrer Verwandtschaft zur Lohnquote werden die realen Lohnstückkosten auch als „reale bereinigte Lohnquote“ interpretiert. Sie sollen widerspiegeln, dass Unternehmer*in und Arbeitnehmer*in unterschiedlich von Preissteigerungen betroffen sind. Steigen die nominellen Löhne stärker als das BIP und steigt der Verbraucherpreisindex im selben Ausmaß stärker als der BIP-Deflator, dann verändern sich die realen Lohnstückkosten jedoch gar nicht, obwohl sich die Einkommensverteilung zugunsten der Arbeitnehmer*innen verbessert hat. Die Aussagekraft ist also auch hier sehr begrenzt und bestenfalls bei gleichzeitiger Betrachtung mit anderen ökonomischen Kennzahlen gegeben.
Mitunter werden in der öffentlichen Diskussion die Lohnstückkosten mit der Lohnhöhe gleichgesetzt, in Verbindung mit der Forderung, die Lohnstückkosten zu senken, um die Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen. Allerdings haben, wie oben gezeigt, die Lohnstückkosten zu einem bestimmten Zeitpunkt lediglich eine begrenzte Aussagekraft, nur ihre Veränderung kann sinnvoll interpretiert werden. Wie Lektion 2.2.3 diskutiert, spielt innerhalb einer Währungsunion die Preiswettbewerbsfähigkeit eine bedeutende Rolle, weshalb die Entwicklung der Lohnstückkosten in der Eurozone verstärkte Beachtung findet. Da die Lohnentwicklung im Verhältnis zur Produktivität auch vom BIP-Deflator erfasst wird, stellt sich bei dynamischer Betrachtung allerdings die Frage, inwieweit die Lohnstückkosten im Vergleich zum BIP-Deflator einen Erkenntnisgewinn darstellen. [35]
Hinsichtlich der absoluten Lohnhöhe gilt, dass diese langfristig stets mit der Produktivität hoch korreliert sind: Gemäß der Grenzkostentheorie entsprechen die Löhne dem Grenzprodukt der Arbeit und werden damit umso höher ausfallen, je höher die Produktivität ausfällt, die wiederum wesentlich von der vorhandenen Technologie und dem zur Verfügung stehenden Sach- und Humankapital abhängen. Praktisch müssen die Lohnkosten aus Sicht des*der Arbeitgeber*in durch die Produktivität des*der Arbeitnehmer*in gerechtfertigt sein, sonst wird das Arbeitsverhältnis aufgegeben. Daraus folgt, dass bei statischer Betrachtung niedrige Löhne ein Zeichen niedriger Wettbewerbsfähigkeit sind, während hohe Löhne eine hohe Wettbewerbsfähigkeit anzeigen.
Industriepolitik
Wettbewerbsfähigkeit als ökonomisch sinnvolles Konzept meint daher im Kern eine hohe Produktivität mit entsprechend hohen Pro-Kopf-Einkommen unter ökonomisch, sozial und ökologisch nachhaltigen Bedingungen. [36] Somit ist Wettbewerbsfähigkeit im gesamtwirtschaftlichen Sinn erstens weder gleichzusetzen mit möglichst niedrigen Löhnen noch mit einem möglichst hohen Leistungsbilanzüberschuss; zweitens muss sie in Verbindung mit anderen gesellschaftlichen Zielen gesehen werden. Bei Zielkonflikten (bspw. Arbeitsbedingungen oder Umweltstandards) müssen daher von der Politik Prioritäten gesetzt werden.
Der letzte Punkt ist auch deshalb relevant, weil ein höheres Wachstum der Industrie am stärksten zum Gesamtwachstum beiträgt. Dies wird auch von der EU-Kommission anerkannt, die eine Erhöhung des Industrieanteils an der Wertschöpfung auf 20% bis 2020 für die EU anstrebt. Das nicht zuletzt deshalb, als empirische Studien belegen, dass die reale Arbeitsproduktivität in der Industrie in Österreich schneller wächst als in der Gesamtwirtschaft. Die höhere Effizienz in der Industrie führt letztlich auch zu höheren Löhnen in dieser Branche.
Vor diesem Hintergrund wird deutlich, dass eine international wettbewerbsfähige Industrie eine entscheidende Rolle für den Wohlstand einnimmt, was wiederum eine entsprechende Politik begründet. Die Diskussion der ökonomischen Wettbewerbsfähigkeit ist damit eng verzahnt mit Industriepolitik, die als öffentliche Intervention zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit unter Berücksichtigung der jeweils spezifischen (z.B. nachfrageseitigen, technologischen, oder regulatorischen) Rahmenbedingungen in den einzelnen Industriezweigen aufgefasst werden kann. Weiterhin lassen sich unterscheiden:
- Eine vertikale Industriepolitik, die sich auf bestimmte Branchen konzentriert, um diese zu fördern, etwa über Subventionen, sowie
- eine horizontale Industriepolitik, die auf allgemeine Funktionen des Wirtschaftssystems ausgerichtet ist und – ohne zwischen Branchen zu diskriminieren – beispielsweise versucht, das Qualifikationsniveau der Arbeitnehmer*innen allgemein zu erhöhen, den Zugang zu Kapital für Unternehmen zu verbessern, oder in die Infrastruktur investiert.
In der Praxis ist die Trennung jedoch nicht eindeutig, da bestimmte horizontale Schritte bestimmten Branchen eher nützen werden als anderen. Weiterhin kann unterschieden werden zwischen
- Industriepolitik im engeren Sinn, die sich auf die Wettbewerbsfähigkeit der Sachgütererzeugung (d.h. des industriellen Sektors) konzentriert, sowie
- Strukturpolitik (Industriepolitik im weiteren Sinn), womit die gezielte Beeinflussung der sektoralen Produktionsstruktur einer Ökonomie gemeint ist und üblicherweise der Anteil jener Industriezweige erhöht werden soll, von welchen man sich die höchsten Wachstums- und Produktivitätspotenziale verspricht.
Die EU betont, dass die Wettbewerbsfähigkeit in der Hand der Unternehmen selbst liege, während die Industriepolitik auf eine Verbesserung der Rahmenbedingungen zielt, insbesondere sollen
- Rahmenbedingungen für Investitionen, insbesondere in Innovationen, verbessert werden;
- der Binnenmarkt gestärkt und internationale Märkte geöffnet werden;
- der Zugang zu den Kapitalmärkten, insbesondere für KMU, verbessert werden und
- Humanressourcen und Qualifikation verbessert werden.
Die vertikale Industriepolitik und die entsprechenden Kompetenzen liegen somit bei den Mitgliedstaaten, wobei sich Österreich selbst das Ziel gesetzt hat, zu jenen Volkswirtschaften aufzusteigen, die das höchste Innovationspotenzial aufweisen. Somit wird Industriepolitik auf österreichischer Ebene v.a. Innovationspolitik sein, um die entsprechenden Branchen zu fördern.
Die Wettbewerbsfähigkeit Österreichs innerhalb der Eurozone
Wie oben diskutiert ist der wichtigste Indikator der Wettbewerbsfähigkeit jener der Arbeitsproduktivität, da er zum Ausdruck bringt, wie viel je Arbeitseinheit produziert wird. Die Arbeitsproduktivität wird üblicherweise je Erwerbstätige*n oder je Arbeitsstunde dargestellt, wobei die Werte im internationalen Vergleich aus verschiedenen Gründen voneinander abweichen können, wobei (i) der Anteil von Teilzeitbeschäftigten und (ii) die Neigung der Arbeitgeber*innen, bei schlechter Auftragslage Leute nicht sofort zu kündigen, die bedeutendsten Gründe sind.
Bei statischer Betrachtung entspricht die Arbeitsproduktivität daher schlicht Output (BIP) je Arbeitsinput (Erwerbstätige oder Arbeitsstunden). Bei dynamischer Betrachtung wird ein bestimmter Zeitpunkt gleich 100 gesetzt und die Entwicklung über die Zeit berechnet. Betrachtet man sich die Entwicklung von einem bestimmten Anfangszeitpunkt aus, so lautet die formale Darstellung für die reale Arbeitsproduktivität je Erwerbstätige*n Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle p_{t,t - 1}^{r,L} = \frac{Y_{t,t - 1}^{r}}{L_{t}}} , für die reale Arbeitsproduktivität je Arbeitsstunde Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle p_{t,t - 1}^{r,H} = \frac{Y_{t,t - 1}^{r}}{H_{t}}} .
Die obere Abbildung stellt , und Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle p_{t,t - 1}^{r,H}} für Österreich, die Eurozone und die vier größten Volkswirtschaften der Eurozone seit 1998 dar. Dabei fällt auf, dass die Arbeitsproduktivität je Arbeitsstunde viel stärker als jene je Erwerbstätigen angestiegen ist, was v.a. auf die relative Zunahme von Teilzeitbeschäftigungen zurückzuführen ist – die Krise hat diesen Prozess durch vermehrte Teilzeitarbeit noch einmal verstärkt. Insbesondere bei Österreich fällt auf, dass die Arbeitsproduktivität je Arbeitsstunde seit Ausbruch der Krise weiterhin steigt – was bei Betrachtung je Erwerbstätige*n oder beim BIP je Einwohner*in nicht deutlich wird. Bei der Interpretation ist freilich auch zu berücksichtigen, dass eine hohe Arbeitslosigkeit die Arbeitsproduktivität je Arbeitsstunde tendenziell erhöht, da wenig produktive Abreitnehmer*innen üblicherweise als Erste entlassen werden – und vice versa. Hier ist interessant zu sehen, dass der Rückgang der Arbeitslosigkeit in Spanien vor der Krise zusammenfällt mit einem niedrigen, fallweise sogar negativen Anstieg der Arbeitsproduktivität. Neben der Spitzenposition Österreichs ist festzuhalten, dass Frankreich nach beiden Kriterien eine bessere Entwicklung zeigt als Deutschland.
Indem man die Nominallöhne durch die Arbeitsproduktivität dividiert, kommt man direkt zu den nominellen Lohnstückkosten, da aus den Herleitungen in Lektion 2.2.4 folgt, dass Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle \frac{w_{t}}{p_{t,t - 1}^{r,L}} = w_{t}\frac{D_{t,t - 1}H_{t}}{Y_{t}}} . In folgender Abbildung ist die Entwicklung für den BIP-Deflator sowie für die Lohnstückkosten seit 1998 dargestellt. Beim Vergleich des BIP-Deflators über einen längeren Zeitraum als in Abb. 2.1 fällt auf, dass die die Schere zwar teilweise wieder geschlossen hat, insbesondere Deutschland aber immer noch weit unter der gesamten Eurozone liegt. Die Lohnstückkosten zeigen im Prinzip das gleiche Bild, lediglich verstärkt um die nominelle Lohnentwicklung.
Einen wichtigen Indikator für die Wettbewerbsfähigkeit in naher Zukunft stellen die Investitionen der Gegenwart dar. Insbesondere erhöht die Ausstattung mit Sachkapital die Arbeitsproduktivität, was auch in der Standard-Produktionsfunktion zum Ausdruck kommt. [37] Hinzu kommt, dass umfangreiche Investitionen in der Gegenwart die Anbieter*innen besser auf eine zukünftige Nachfragesteigerung vorbereiten, wodurch sie – wenn dieser Fall eintritt – mit entsprechenden Produktionsausweitungen reagieren können. Beim Indikator stehen stets die Investitionen im Zähler, der Output in derselben Periode im Nenner. Bei den Investitionen kann man entweder ausschließlich Anlageninvestitionen oder Letztere zuzüglich Veränderungen der Lagerhaltung berücksichtigen, beim Output kann man das BIP oder die Bruttowertschöpfung heranziehen.
Wie in obiger Abbildung zu sehen, sind die Entwicklungen der beiden Indikatoren zwar ähnlich, aber nicht identisch. Österreich zeigt wie alle anderen Ökonomien einen Abwärtstrend seit der Jahrtausendwende, der in Österreich jedoch schwächer ausfällt und zum Ende des Beobachtungszeitraums sogar den höchsten Wert aufweist. Der Hauptgrund hierfür ist die starke Position der Industrie in der österreichischen Volkswirtschaft, die naturgemäß ein höheres Investitionsvolumen aufweist als der Landwirtschafts- und der Dienstleistungssektor. Allerdings zeigt sich für Österreich seit 2012 ein leichter Abwärtstrend, der bei Berücksichtigung der Lagerhaltung stärker ausfällt.
Migration
Obwohl internationale Migration im Unterschied zu internationalen Kapitalströmen stark reguliert ist, spielt sie für moderne Ökonomien eine immer größere Rolle. Insbesondere wohlhabende Ökonomien erfahren seit Jahrzehnten einen permanenten Netto-Zufluss an Arbeitskräften, mit entsprechenden Auswirkungen auf die Produktionsmöglichkeiten. Die Europäische Union hebt die Vorteile der Migration innerhalb ihres Territoriums hervor, wobei der wichtigste jener der Allkation ist: Je größer der Pool an Arbeitskräften, (i) umso einfacher können von Arbeitgeber*innen Engpässe an Arbeitskräften überwunden werden, und (ii) umso passgenauer können von Arbeitgeber*innen insbesondere hochqualifizierte Arbeitsplätze besetzt werden. Aus Sicht der Arbeitnehmer*innen gilt im Prinzip das Gleiche: Je größer der Arbeitsmarkt, (i) umso eher können Arbeitsuchende eine*n Arbeitgeber*in finden, und (ii) insbesondere Hochqualifizierten steht ein größerer Pool an Arbeitgeber*innen gegenüber, die ihr spezifisches Humankapital benötigen und entsprechend entlohnen. Die dadurch verbesserte Allokation des Faktors Arbeit sollte daher die gesamtwirtschaftliche Leistungsfähigkeit erhöhen, auch wenn es für einzelne Ökonomien zu Nachteilen kommen kann.
Typen der Migration
Obwohl der Begriff Migration im Alltag eher mit internationaler Migration assoziiert wird, bezeichnet er im ökonomischen Sinn jeden Ortswechsel, der zum Zweck der Arbeitsausübung durchgeführt wird. Daraus folgt auch, dass in der Volkswirtschaftslehre Migration typischerweise mit Arbeitsmigration gleichgesetzt wird. Auch wenn in der Realität für viele Migrant*innen der Arbeitsplatzwechsel zumindest nicht die Hauptmotivation darstellt, so hat dennoch fast jeder Akt der Migration Auswirkungen auf die Arbeitsmärkte: Manche Menschen folgen ihren Ehepartner*innen, die selbst aufgrund der Arbeit migriert sind, Flüchtlinge treten in den Arbeitsmarkt ein, Studierende bleiben entgegen ihrer ursprünglichen Intention dauerhaft in der Region oder im Land ihrer Universität usw.
Unabhängig von der ursprünglichen Motivation kann Migration nach verschiedenen Ausprägungen definiert werden, je nachdem, welche Grenzen überschritten werden und wie lange der Aufenthalt währt. Insbesondere werden unterschieden:
- Internationale Migration, welche die permanente Verlegung des Wohn- und Arbeitsorts in einen anderen souveränen Staat bezeichnet.
- Interregionale Migration, welche die permanente Verlegung des Wohn- und Arbeitsorts in eine andere Region innerhalb desselben souveränen Staats bezeichnet.
- Pendelmigration, welche die Verlegung des Arbeitsortes ohne dauerhafte Verlegung des Wohnorts bezeichnet. Die Pendelmigration kann weiter unterschieden werden in interregionale und internationale Pendelmigration, wobei Letztere in der Praxis allerdings sehr viel seltener stattfindet.
Was eine „permanente Verlegung“ bezeichnet, ist naturgemäß dehnbar; die Statistik Austria erfasst in den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen Personen, die seit mindestens sechs Monaten in Österreich ansässig sind, als Teil der österreichischen Wirtschaft, was hier vielleicht zur Orientierung hilfreich ist. Allen drei Typen gemeinsam ist, dass definitionsgemäß eine administrative Grenze überschritten werden muss. Wie diese administrativen Grenzen gezogen sind, wird einen entsprechenden Effekt auf die statistisch beobachtete Migration haben: Insbesondere beim Studium interregionaler Migration hängt die Interpretation stark von der gewählten räumlichen Maßstabsebene ab, was wiederum bei internationalen Vergleichen von Bedeutung ist.
Der wesentliche Unterschied zwischen internationaler und interregionaler Migration ist, dass Erstere typischerweise reguliert wird, während Letztere in Marktwirtschaften typischerweise völlig frei ist. Aus ökonomischer Sicht ist dieser Unterschied bedeutsam, weil (i) die mikroökonomischen Kosten der interregionalen Migration wesentlich niedriger sind als jene der internationalen Migration und die die (ii) makroökonomischen Effekte daher stärker zum Tragen kommen. Die Europäische Union bildet hier insofern einen Sonderfall, als durch die Arbeitnehmerfreizügigkeit einerseits die legalen Migrationsbarrieren innerhalb ihres Territoriums aufgehoben sind, wodurch im ökonomischen Sinn jede Migration als interregionale Migration zu klassifizieren ist, auch wenn sie im staatsrechtlichen Sinn internationale Migration darstellt.
Mikroökonomische Fundierung einer Migrationsentscheidung
Bereits 1932 hat der spätere Nobelpreisträger John Hicks Unterschiede im Nettoeinkommen, insbesondere Löhnen, als Hauptgrund für Migrationsentscheidungen identifiziert. In diesem Sinn kann eine Migrationsentscheidung als individuelle Humankapitalinvestition verstanden werden: Arbeitnehmer*innen schätzen die Beschäftigungs- und Einkommensmöglichkeiten in allen ihnen offenstehenden Arbeitsmärkten ein, subtrahieren die mit der Migration verbundenen Kosten, und treffen die Entscheidung, ob sie migrieren werden oder nicht in Abhängigkeit davon, welche Entscheidung ihr langfristiges Einkommen maximieren wird. Kosten der Migration betreffen zunächst die Kosten der Distanzüberwindung selbst, weshalb geographisch naheliegende Ziele naturgemäß attraktiver sind. Zu den Kosten zählen jedoch auch seelische Kosten (auch: psychische Kosten), die sich einerseits aus dem Stress ergeben, sich in einer neuen Umgebung zurechtfinden zu müssen und andererseits aus dem Verlust von Freund*innen und Verwandten.
Die Entscheidung eines*einer individuellen Arbeitnehmer*in lässt sich als Vergleich der zu erwartenden langfristigen Einkommen darstellen. Dargestellt sei zunächst der gegenwärtige Wert des zu erwartenden Lebenseinkommens Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle V} eines*einer 20jährigen Arbeitnehmer*in, wenn er*sie in seiner*ihrer Heimatregion bleibt:
Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle V^{X} = w_{20}^{X} + \frac{w_{21}^{X}}{(1 + r)} + \frac{w_{22}^{X}}{(1 + r)^{2}} + ...\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ (2.3.1)}
wobei Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle w}
das zu erwartende Einkommen im entsprechenden Lebensalter 20, 21
22, … Jahren bezeichnet und Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle r}
die individuelle Diskontrate. Analog kann das zu erwartende Lebenseinkommen für eine beliebige Ökonomie dargestellt werden, die dem*der Arbeitsnehmer*in als potenzielles Migrationsziel offensteht:
Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle V^{Y} = w_{20}^{Y} + \frac{w_{21}^{Y}}{(1 + r)} + \frac{w_{22}^{Y}}{(1 + r)^{2}} + ...\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ (2.3.2)}
Der Nettoeinkommenszuwachs ergibt sich nun einfach als Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle V^{Y} - V^{X} - M^{X,Y}} , wobei Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle M^{X,Y}} die Kosten der Migration von nach Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle Y} erfasst. Die Person wird migrieren, wenn Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle V^{Y} - V^{X} - M^{X,Y} > 0} . Aus den Gleichungen folgt, dass sich die Migration generell umso eher lohnen wird, je jünger der*die potenzielle Migrant*in ist. Weiterhin gilt, dass der potenzielle Einkommensunterschied umso höher ist, je höher die Qualifikation der Person ist. Somit lässt sich vereinfacht festhalten, dass je jünger und je besser ausgebildet eine Person ist, umso höher die Wahrscheinlichkeit der Migration. Aus den Gleichungen folgt ferner, dass
- eine Verbesserung der ökonomischen Rahmenbedingungen in der potenziellen Ziel-Ökonomie den Nettoertrag und damit die Wahrscheinlichkeit der Migration erhöht, und vice versa;
- eine Verbesserung der ökonomischen Rahmenbedingungen in der Heimat-Ökonomie den Nettoertrag und damit die Wahrscheinlichkeit der Migration reduziert, und vice versa;
- Eine Erhöhung der Migrationskosten den potenziellen Ertrag der Migration und somit die die Wahrscheinlichkeit der Migration reduziert, und vice versa.
Somit gilt zusammenfassend, dass Migration dann auftreten wird, wenn für den*die potenziellen Migrant*in die Chancen gut stehen, dass die Erträge der Migration deren Kosten übersteigen.
Selbst-Selektion der Emigrant*innen
Wie aus der bisherigen Diskussion hervorgeht, sind für die individuelle Migrationsentscheidung nicht die Durchschnittsgehälter der infrage kommenden Ökonomien relevant, sondern die für die jeweilige Person individuell zu erzielenden. Zwar wird das Durchschnittsgehalt in der jeweiligen Ökonomie das individuelle Gehalt beeinflussen – in welchem Ausmaß das der Fall ist, hängt jedoch auch von der Einkommensverteilung ab.
Ausschlaggebend für das individuelle Einkommen ist, in welchem Ausmaß Unterschiede hinsichtlich der Qualifikation honoriert werden. Bei relativer Gleichverteilung der Einkommen innerhalb der Gruppe der Arbeitsnehmer*innen profitieren Hochqualifizierte relativ wenig von ihren relativ hohen Qualifikationsniveaus, während Niedrigqualifizierte ein höheres Einkommen erzielen als in einer Ökonomie mit gleichem Durchschnittseinkommen, aber höherer Einkommensungleichheit.
Ein*e potenzielle*r Migrant*in wird seine*ihre Entscheidung, zu migrieren, daher sowohl vom Durchschnittseinkommen als auch von der Einkommensvarianz in der Quell- und der Zielregion abhängig machen. Zur Vereinfachung sei angenommen, dass die Durchschnittseinkommen in zwei Ökonomien A und B gleich hoch sind, aber Varianz in A höher ist, wobei die Höhe der individuellen Einkommen wiederum positiv mit den Qualifikationsniveaus korreliert sind. Daraus folgt, dass ein*e überdurchschnittlich qualifizierte*r Arbeitnehmer*in in A ein höheres Einkommen erzielen wird als in B, während ein*e unterdurchschnittlich qualifizierte*r Arbeitnehmer*in in B ein höheres Einkommen erzielen wird als in A.
Daraus folgt weiters, dass ceteris paribus jene Ökonomie mit einer gleicheren Einkommensverteilung unterdurchschnittlich qualifizierte Immigranten attrahieren wird, während sie selbst überdurchschnittlich qualifizierte Emigranten verlieren wird. Diese Zusammenhänge ergeben sich aus dem Roy-Modell und beschreiben somit, welche Ökonomien von welchen Migrant*innen ausgewählt werden. [38] So kann etwa erklärt werden, warum die USA bei hoher Einkommensungleichheit recht erfolgreich darin sind, hoch- und höchstqualifizierte Arbeitnehmer*innen aus Ökonomien mit vergleichbaren Durchschnittseinkommen – darunter Österreich – anzulocken; gleichzeitig zeigen Migrationsdaten, dass Migrant*innen aus Drittstaaten mit niedrigem Durchschnittseinkommen bei hoher Qualifikation eher die USA, bei niedriger Qualifikation eher Österreich (und vergleichbare Länder) als Ziel wählen.
Der Effekt der Migration auf die aggregierte Produktionsfunktion
Um die Auswirkungen der Migration auf die Gesamtwirtschaft darzustellen, ist es hilfreich, sich noch einmal die neoklassische Produktionsfunktion anzuschauen: [39]
Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle Y_t=K_t{ }^\alpha H_t^\beta\left(A_t L_t\right)^{1-\alpha-\beta}, \quad \alpha>0, \beta>0, \alpha+\beta<1}
(2.3.3)
wobei und Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle H} die Bestände an Sach- bzw. Humankapital darstellen, und Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle A} den aktuellen technologischen Stand symbolisiert. Der aggregierte Output Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle Y} einer Ökonomie (was dem absoluten BIP in der VGR entspricht) steigt, wenn zumindest eine der Variablen , Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle H} , Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle A} oder Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle L} steigt. Abstrahiert man von Immigrant*innen, die nicht arbeiten und berücksichtigt damit nur den Effekt von Erwerbspersonen, so ergibt sich aus Gl. (2.3.3), dass Immigration
- zunächst einmal das Arbeitsangebot erhöht und somit zwangsläufig einen positiven Effekt auf hat;
- außerdem höchstwahrscheinlich Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle H} erhöht, wenn zumindest ein*e Immigrant*in zumindest irgendeine Fertigkeit besitzt, die über bloße körperliche Arbeit hinausgeht und die in der Zielökonomie eingesetzt werden kann;
- schließlich möglicherweise Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle A} erhöht, falls Immigration den Stand des technologischen Wissens erhöht.
Theoretisch kann sich durch Immigration auch der Bestand an Sachkapital erhöhen, allerdings werden Immigrant*innen recht selten Produktionsmittel mit sich bringen, weshalb von diesem Fall abgesehen wird. Aus Gl. (2.3.3) ergibt sich analog, dass Emigration
- das Arbeitsangebot Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle L} reduziert und somit einen negativen Effekt auf Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle Y} hat;
- höchstwahrscheinlich Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle H} verringert, aus den oben genannten Gründen;
- Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle A} unberührt lässt, wenn das abstrakte Wissen, über das die Emigrant*innen verfügen, weiterhin im Land vorhanden bleibt.
Die Effekte auf das absolute BIP sind im Fall von Immigration von Erwerbspersonen somit eindeutig positiv. Im Fall von Nicht-Erwerbspersonen hängt der Effekt davon ab, wer für die betreffende Person aufkommt. Ist die Erwerbsquote unter Immigrant*innen höher als innerhalb der ansässigen Bevölkerung, so wird der Gesamt-Effekt insgesamt positiv bleiben. Ist er niedriger, hängt es davon ab, inwiefern das Konsumverhalten der Immigrant*innen die Gesamtnachfrage verändert, negative Effekte werden allerdings wohl vernachlässigbar gering sein. Diese Effekte wirken in umgekehrter Richtung für Emigration.
Der Effekt der Migration auf die Produktion je Arbeitseinheit
Gesellschafts- und wirtschaftspolitisch relevanter als der Effekt auf das absolute Produktionsniveau ist freilich der Effekt der Migration auf den Output je Arbeitseinheit. Dividiert man Gl. (2.3.3) durch das Arbeitsangebot , so erhält man
Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle y_{t} = A_{t}^{1 - \alpha - \beta}\frac{{K_{t}}^{\alpha}}{{L_{t}}^{\alpha}}\frac{H_{t}^{\beta}}{{L_{t}}^{\beta}}\frac{L_{t}}{L_{t}} = A_{t}^{1 - \alpha - \beta}{k_{t}}^{\alpha}h_{t}^{\beta\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ }\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ (2.3.4)}
wobei die Kleinbuchstaben Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle y = \frac{Y}{L}} , Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle k = \frac{K}{L}} und jeweils den Output, das Sachkapital und das Humankapital je Arbeitnehmer*in bezeichnen. Daraus ergeben sich die folgenden Implikationen:
- Immigration wird den Sachkapitalbestand je Arbeitseinheit Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle k} zwangsläufig reduzieren, Emigration wird ihn analog erhöhen;
- der Einfluss auf den Humankapitalbestand je Arbeitseinheit Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle h} hängt davon ab, wer migriert.
Somit kommt dem Humankapital die entscheidende Rolle zu: Ist das Qualifikationsniveau der Immigrant*innen höher als jenes der ansässigen Bevölkerung, so kann der Rückgang an Sachkapital je Arbeitseinheit durch den Gewinn an Humankapital kompensiert oder überkompensiert werden. Ist er niedriger oder gleich hoch, so kommt es auf jeden Fall zu einer Reduktion des Outputs je Arbeitseinheit. Analog dazu gilt, dass im Verhältnis zum Niveau der Herkunfts-Ökonomie durchschnittlich oder überdurchschnittlich hoch qualifizierte Emigrant*innen den Output je Arbeitseinheit reduzieren werden. Ist das Humankapital der Emigrant*innen hinreichend niedrig, kommt es zu einer Erhöhung des Outputs je Arbeitseinheit. [40]
Weicht die Erwerbsquote der Migrant*innen von jener der Ziel- oder Herkunfts-Ökonomie ab, so gilt, dass
- eine höhere Erwerbsquote von Immigrant*innen für sich einen positiven Effekt auf den Output je Einwohner*in der Ziel-Region hat, da es nun mehr Arbeitnehmer*innen je Einwohner*in gibt; und vice versa bei einer niedrigeren Erwerbsquote,
- eine höhere Erwerbsquote von Emigrant*innen für sich einen negativen Effekt auf den Output je Einwohner+in der Herkunfts-Ökonomie hat, da es nun weniger Arbeitnehmer*innen je Einwohner*in gibt; und vice versa bei einer niedrigeren Erwerbsquote.
Zu berücksichtigen ist ferner, dass es sich bei der Interpretation der Gleichungen (2.3.3) und (2.3.4) nur um kurzfristige Effekte handelt. Die langfristigen Effekte können anhand des Steady-State-Outputs Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle y^{*}} ermittelt werden, da Migration zwangsläufig einen Effekt auf das Bevölkerungswachstum Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle n} hat:
Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle y_{t}^{*} = A_{t}{k_{t}}^{*\alpha}{h_{t}}^{*\beta} = A_{t}\left( \frac{s_{K}s_{H}}{(n + \delta)^{\alpha + \beta}} \right)^{\frac{1}{1 - \alpha - \beta}}\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ (2.3.5)}
Da Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle \frac{\partial y_{t}^{*}}{\partial n} < 0} , hat permanente Netto-Immigration einen eindeutig negativen, permanente Netto-Emigration einen eindeutig positiven Effekt auf das Gleichgewichtsniveau von Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle y} .
Auswirkungen der Migration in einem System von Ökonomien
Innerhalb eines Systems von Ökonomien (Regionalökonomien innerhalb eines Landes, Mitgliedstaaten der EU) stellt jeder Akt der Emigration zugleich einen Akt der Immigration dar, die Effekte für das gesamte System müssen daher simultan analysiert werden. Auf der einen Seite stehen die erwarteten positiven Effekte für das gesamte System aufgrund der verbesserten Zuordnung von Arbeitnehmer*innen zu Arbeitgeber*innen (Matching). Allerdings folgt in einer Marktwirtschaft die Entscheidung zu migrieren individueller Nutzenmaximierung, die Effekte sind jedoch makroskopischer Natur. Daraus folgt insbesondere, dass der Zugewinn an Einkommen für das Individuum geringer oder höher sein kann als der Rückgang des Outputs der Herkunfts-Ökonomie als Folge des Verlusts an Humankapital. Für den Gesamteffekt entscheidend wäre hier der Effekt durch die Erhöhung des Outputs der Ziel-Ökonomie. Insbesondere, wenn es zu einer Konzentration von Humankapital kommt, können aufgrund des sinkenden Grenzprodukts die negativen Effekte überwiegen.
Weiterhin folgt aus der neoklassischen Produktionsfunktion, dass die Grenzproduktivität des Sachkapitals, Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle \frac{\partial y_{t}}{\partial k_{t}}} , von der Humankapital-Ausstattung positiv abhängt:
Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \frac{\partial\left( \frac{\partial y_{t}}{\partial k_{t}} \right)}{\partial h_{t}} = \alpha\beta A_{t}{k_{t}}^{\alpha - 1}h_{t}^{\beta - 1}\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ (2.3.6)}
Das Grenzprodukt ist somit umso höher, je mehr Humankapital vorhanden ist. Zwar sinkt die Grenzproduktivität von Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle k} je größer Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle k} bereits ist, wodurch Sachkapital-arme Ökonomien ceteris paribus für Neuinvestitionen attraktiver sind. Allerdings geht aus Gl. (2.3.6) hervor, dass dieser negative Effekt durch das Vorhandensein von Humankapital kompensiert werden kann. Somit bleiben Ökonomien, die reich an Sach- und Humankapital sind, für Neuinvestitionen attraktiv.
Im Unterschied zu Investitionen in Sachkapital folgt die Migration von Humankapital nicht dem Grenzprodukt, sondern dem zu erwartenden Lohn im Sinne der lebenslangen Einkommensmaximierung entsprechend Gleichungen (2.3.1) und (2.3.2). Für die individuelle Entscheidung relevant sind somit das Durchschnittseinkommen in den jeweiligen Ökonomien plus des Aufschlags für das Humankapital, das der*die Arbeitnehmer*in anbieten kann. Daraus folgt, dass
- Ökonomien, die bereits über viel Human- und Sachkapital verfügen, beide Produktionsfaktoren weiterhin attrahieren können, wodurch sie anderen Ökonomien nicht mehr zur Verfügung stehen;
- Ökonomien, in denen das Durchschnittseinkommen niedrig ist, Humankapital durch eine ungleichere Verteilung der Einkommen zugunsten von Humankapital attrahieren können.
Bei sehr großen Einkommensunterschieden zwischen Ökonomien innerhalb eines Systems wird der zweite Effekt jedoch nicht ausreichen, um für den ersten Effekt kompensieren zu können. Die Folge ist eine permanente Wanderungsbewegung in Richtung der produktiveren Ökonomien. Da die weniger produktiven Ökonomien dadurch permanent Humankapital verlieren, werden sich Unterschiede im Produktions- und somit Wohlstandsniveau langfristig tendenziell eher reproduzieren denn angleichen.
Übungen
2.4.1
In Wien kostet ein Krügel Pils € 3,80, in Liverpool kostet ein Pint Ale ₤ 3,00. Der Wechselkurs in Mengennotierung ist ₤ 0,75.
Was ist der Preis eines Krügels Pils gerechnet in Pints Ale?
Wie verändert sich dieser relative Preis unter ansonsten gleichen Bedingungen, wenn das Pfund auf ₤ 0,90 abgewertet wird?
Ist das Pint Ale in b. im Verhältnis zum Krügel Pils teurer oder billiger geworden?
2.4.2
Ein US-Dollar kostet 65 russische Rubel, jedoch nur 0,95 Schweizer Franken. Wie ist der Wechselkurs des russischen Rubel in Schweizer Franken?
2.4.3
Erdöl wird auf dem Weltmarkt üblicherweise zu US-Dollar-Preisen angeboten. Der belgische Solvay-Konzern importiert Erdöl, um daraus Kunststoffe zu produzieren. Wie beeinflusst eine Abwertung des Euro gegenüber dem US-Dollar die Gewinne des Unternehmens?
2.4.4
Die Inflationsrate in Russland betrug 2013 6,75%, in Kanada 0,90%. Wie müsste sich der relativen KKP zufolge 2013 der Wechselkurs des kanadischen Dollar gegenüber dem russischen Rubel entwickeln?
2.4.5
In einer Tageszeitung findet sich der Satz: „Kamera-Hersteller Canon leidet (…) unter der Aufwertung des Yen und senkt seine Erwartungen für das Gesamtjahr.“ Interpretieren Sie diese Aussage.
2.4.6
Ungarische Hausbesitzer*innen haben zur Mitte der 2000er-Jahre ihre Hypotheken in Schweizer Franken aufgenommen, weil die Franken-Zinsen niedriger waren als die Forint-Zinsen. Die jährliche Inflationsrate lag in Ungarn in den Jahren 2005-2007 durchschnittlich bei 5,96%, in der Schweiz bei 1,00%. In Ungarn verschuldeten sich Hausbesitzer*innen mit insgesamt 3 Mrd. Franken – war das klug?
2.4.7
Wie kann die schwedische Notenbank eine ihrer Meinung nach zu starken Krone gegenüber dem Euro abwerten?
2.4.8
Welchem Wechselkurssystem entsprach der österreichische Schilling vor Einführung des Euro und welche ökonomische Begründung gab es für die Einführung des Euro?
2.4.9
Die Idee, dass es so etwas wie eine Wettbewerbsfähigkeit von Ökonomien gibt, ist bis heute umstritten.
Nennen Sie die zwei wesentlichen Gründe, weshalb nach Krugman das Prinzip der Wettbewerbsfähigkeit nicht auf Volkswirtschaften übertragen werden kann.
Erläutern Sie, weshalb das Prinzip der Preiswettbewerbsfähigkeit innerhalb einer Währungsunion von besonderer Bedeutung ist.
2.4.10
Analysieren Sie anhand des Konzepts der Preiswettbewerbsfähigkeit, wie sich die folgenden Szenarien auf Exporte und Importe der eigenen Volkswirtschaft auswirken:
Das BIP der eigenen Volkswirtschaft steigt.
Das BIP der anderen Volkswirtschafft steigt.
Das Preisniveau der eigenen Volkswirtschaft steigt um 5%, während sowohl der nominale Wechselkurs wie das Preisniveau der anderen Volkswirtschaft unverändert bleiben.
Das Preisniveau der eigenen Volkswirtschaft steigt um 5%, das Preisniveau der anderen Volkswirtschaft steigt um 10%, während der nominale Wechselkurs unverändert bleibt.
Das Preisniveau beider Volkswirtschaften steigt um 2%, der nominale Wechselkurs in Preisnotierung steigt um 10%.
2.4.11
Die nominellen Lohnstückkosten sind definiert als Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle s_{t,t - 1} = \frac{\frac{w_{t}H_{t}^{U}}{U_{t}}}{\frac{Y_{t,t - 1}^{r}}{L_{t}}}} , wobei Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle w_{t}} den Stundenlohn, Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle H_{t}^{U}} die Summe der Arbeitsstunden aller Arbeitnehmer*innen, Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle Y_{t,t - 1}^{r}} das reale BIP zum Basisjahr Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle t - 1} und Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle L_{t}} die Gesamtzahl der Erwerbstätigen, jeweils zum Zeitpunkt Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle t} , bezeichnen.
Formen Sie die Gleichung so um, dass Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle s_{t,t - 1} = \frac{D_{t,t - 1}w_{t}H_{t}}{Y_{t}}} , wobei Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle D_{t,t - 1}} den BIP-Deflator zwischen den Zeitpunkten Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle t - 1} und Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle t} , Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle Y_{t}} das nominelle BIP und Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle H_{t}} die Summe der Arbeitsstunden aller Erwerbstätigen bezeichnen.
Interpretieren Sie die Aussagekraft der Lohnstückkosten anhand des Ausdrucks Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle s_{t,t - 1} = \frac{D_{t,t - 1}w_{t}H_{t}}{Y_{t}}} .
Welche Form nimmt die Gleichung ohne Bezug auf ein Basisjahr an, formal wenn Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle t = t - 1} ?
Interpretieren Sie die Aussagekraft des Ergebnisses aus c..
Inwiefern unterscheiden sich die realen von den nominellen Lohnstückkosten?
2.4.12
Prüfen Sie die folgenden Zitate aus einer Tageszeitung auf ihre Sinnhaftigkeit.
„Aussagekräftiger als die Arbeitskosten sind die Lohnstückkosten, die berücksichtigen, wie viel in einer Stunde produziert wird.“
„Obwohl sie [große Unternehmen, Anm.] höhere Löhne bezahlen, liegen ihre Lohnstückkosten deutlich unter dem Branchenschnitt.“
„Die Studie enthält eine besonders alarmierende Ziffer: Die Lohnstückkosten (vereinfacht gesagt die Arbeitskosten pro Produktionseinheit) sind hierzulande besonders stark gestiegen. Seit 2008 um 15,8 Prozent. Im EU-Schnitt betrug die Steigerung nur 10,2 Prozent, in der Schweiz 4,5 Prozent. Klingt ein wenig abstrakt, heißt aber, dass sich unsere Wettbewerbsfähigkeit international ziemlich dramatisch verschlechtert hat. Anders gesagt: In den vergangenen Jahren sind die Löhne viel stärker gestiegen als die Arbeitsproduktivität.“
„Ein großes Problem sind der neuen Studie zufolge die hohen Lohnstückkosten in Österreich, welche die Produktivität reduzierten. Im Zeitraum 2008 bis 2014 seien die Lohnstückkosten um 15,8 Prozent angestiegen. Zum Vergleich: In Deutschland betrug die Steigerung 15,7 Prozent.“
„Die Wiener Wirtschaft besitzt eine hohe Produktivität. Deshalb sind die Lohnstückkosten in Wien unter dem Strich auf Augenhöhe mit Bratislava – obwohl in Wien doppelt so hohe Löhne gezahlt werden.“
2.4.13
Erläutern Sie, warum bei statischer Betrachtung hohe Löhne ein Indikator für hohe Wettbewerbsfähigkeit sind.
2.4.14
Definieren Sie den Begriff der Industriepolitik und beschreiben Sie kurz ihre vier Typen.
2.4.15
Ein Arbeitnehmer berechnet sein*ihr Lebenseinkommen nach der Formel
Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle V = w_{t} + \frac{w_{t + 1}}{(1 + r)} + \frac{w_{t + 2}}{(1 + r)}^{2} + ...}
, wobei Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle w}
das Einkommen im Jahr Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle t}
bezeichnet und Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle r}
seinen*ihren individuellen Diskontsatz bezeichnen.
Zeigen Sie anhand der Gleichung, wie ein Arbeitnehmer, der sein Lebenseinkommen zu maximieren anstrebt, den Netto-Nutzen einer Migration von Land Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle X} nach Land Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle Y} berechnet.
Diskutieren Sie die Implikationen des Ergebnisses.
2.4.16
Ein Arbeiter mit einer jährlichen Diskontrate von 10% wohnt zurzeit in Bregenz und soll entscheiden, entweder zu bleiben oder nach Leoben zu ziehen. In Leoben würde er jährlich netto € 25.000 verdienen, in Bregenz € 22.000. Der Arbeiter hat noch zehn Jahre bis zur Pensionierung vor sich.
Welche Migrationskosten ist er gemäß der Formel aus Bsp. 2.4.14 maximal bereit zu tragen?
Angenommen, der Arbeiter sieht eine 50%-Chance, in Leoben nach fünf Jahren in eine leitende Position mit einem Gehalt von netto €35.000 aufzusteigen, wohingegen er in Bregenz keine solche Möglichkeit sieht. Wie würden Sie diese Möglichkeit in die Berechnung implementieren?
Welche Migrationskosten ist der Arbeiter mit der Angabe aus b. nun maximal bereit zu tragen?
2.4.17
Angenommen, in einer Ökonomie gibt es nur Erwerbstätige und alle Immigrant*innen sind ebenfalls Erwerbstätige, die Bevölkerung ist somit identisch mit dem Arbeitsangebot Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle L}
. Das BIP Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle Y}
der Ökonomie entspricht der neoklassischen Produktionsfunktion
Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle Y_{t} = {K_{t}}^{\alpha}H_{t}^{\beta}(A_{t}L_{t})^{1 - \alpha - \beta}}
wobei Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle \alpha > 0,\ \beta > 0,\ \alpha + \beta < 1}
. Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle K}
und Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle H}
stellen die Bestände an Sach- bzw. Humankapital dar, Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle A}
den technologischen Stand.
Zeigen Sie, dass Zuwanderung stets einen positiven Effekt auf das BIP hat.
Formen Sie die Gleichung aus der Angabe so um, dass sie das BIP je Einwohner*in darstellt.
Zeigen Sie, dass der Effekt auf das BIP je Einwohner*in vom Humankapital der Immigrant*innen abhängt.
2.4.18
Betrachten Sie die neoklassische Produktionsfunktion je Einwohner*in
Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle y_{t} = A_{t}^{1 - \alpha - \beta}{k_{t}}^{\alpha}h_{t}^{\beta}}
, wobei Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle k}
und Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle h}
die Bestände an Sach- bzw. Humankapital je Einwohner*in darstellen und Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle A}
den technologischen Stand symbolisiert.
Beschreiben Sie den grundlegenden Zusammenhang zwischen dem Grenzprodukt des Faktors Sachkapital und der Attraktivität für Investitionen.
Zeigen Sie anhand der angegebenen Gleichung, dass das Grenzprodukt des Faktors Sachkapital sinkt, je mehr Sachkapital in einer Ökonomie vorhanden ist, und kommentieren das Ergebnis.
Zeigen Sie anhand der angegebenen Gleichung, dass das Grenzprodukt des Faktors Sachkapital steigt, je mehr Humankapital in einer Ökonomie vorhanden ist, und kommentieren das Ergebnis.
2.4.19
Beschreiben Sie verbal, inwieweit freie Faktorenmobilität in einem System von Ökonomien dazu beiträgt, dass bestehende Wohlstandsunterscheide sich langfristig nicht verringern.
Lösungen
2.4.1
a. Ein Pint Ale kostet Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle 3,00/0,75\ = \ 4,00} Euro. Somit kostet ein Krügel Pils Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle 3,80/4,00\ = \ 0,95} Pints Ale.
b. Ein Pint Ale verbilligt sich auf Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle 0,75/0,90} seines Euro-Preises, somit kostet ein Krügel Pils nun Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle 3,80/3,33\ = \ 1,14} Pints Ale.
c. Da man nun mehr Ale für ein Pils erhält, ist das Pint Ale billiger geworden.
2.4.2
Man erhält für einen russischen Rubel Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle 1/(65/0,95)\ = \ 0,01462} Schweizer Franken.
2.4.3
Eine Abwertung des Euro gegenüber dem US-Dollar erhöht die Kosten des Unternehmens. Wenn es allerdings seine Produkte in die USA exportiert, kann es zum Ausgleich deren Preis in Euro (nicht in Dollar) heraufsetzen. Alles in allem ist einem Unternehmen, dem hohe Kosten für den Import von Rohstoffen und Zwischenprodukten entstehen, mit einer Abwertung der einheimischen Währung eher nicht gedient.
2.4.4
Der Wechselkurs wird sich um Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle (0,0675-0,009)(1-0,009 / 1,009)=0,05798} erhöhen, d.h. der kanadische Dollar wertet um 5,798% auf.
2.4.5
Wenn der reale Wechselkurs bei ansonsten konstanten Bedingungen steigt, dann ist dies normalerweise schlecht für die Exporteur*innen, da sich ihre Produkte im Ausland verteuern, sodass die Auslandsexportnachfrage möglicherweise sinkt. Im Allgemeinen kann man die Auswirkungen einer realen Wechselkursänderung jedoch nur dann richtig interpretieren, wenn man ihre Ursachen kennt.
2.4.6
Die ungarischen Hausbesitzer*innen gingen das Risiko ein, dass der Schweizer Franken gegenüber dem Forint aufwerten könnte – was angesichts der rund sechsmal so hohen Inflation in Ungarn sehr wahrscheinlich war. Ende 2008 wertete der Forint dann um 30% ab, sodass sich die ungarischen Franken-Schulden prompt um 30% erhöhten. Die Folge waren zahlreiche Bankrotte in Ungarn.
2.4.7
Die schwedische Notenbank könnte ihre Zinsen senken oder die Geldmenge erhöhen, was zu einem niedrigeren Zinssatz führen wird. Durch die niedrigeren Kronen-Zinsen wird die schwedische Währung für Anleger*innen weniger attraktiv, was zu einer Abwertung führen kann.
2.4.8
Das Wechselkurssystem entsprach fixen Wechselkursen. Die wichtigste ökonomische Begründung für die Euro-Einführung war die Mitbestimmung über die Geldpolitik jener Länder, die die Deutsche Mark unilateral als Ankerwährung genutzt hatten.
2.4.9
a. (i) Da Unternehmen üblicherweise um Marktanteile kämpfen, bedeutet der Marktanteilsgewinn des einen Unternehmens zwangsläufig den Marktanteilsverlust von mindestens einem anderen Unternehmen. Im Gegensatz dazu ist der Außenhandel von Ökonomien kein Nullsummenspiel, da sie – wie im Ricardo-Modell gezeigt – vom Handel mit anderen Ökonomien profitieren können. (ii) Im Unterschied zu Unternehmen kann es im wörtlichen Sinn keine „nicht wettbewerbsfähigen“ Ökonomien geben, da sie sich nicht einfach aus dem Markt ausscheiden, sondern weiterhin existieren werden.
b. Unterschiedliche Preisentwicklungen innerhalb von Ökonomien werden durch Wechselkursänderungen ausgeglichen. In einer Währungsunion ist das nicht möglich, was Ökonomien in die Lage versetzt, über geringere Preisanstiege im Inneren auf den Exportmärkten an Preiswettbewerbsfähigkeit zu gewinnen. Besonderer Bedeutung kommt den Löhnen zu, da diese die Preisentwicklung innerhalb einer Ökonomie am meisten beeinflussen.
2.4.10
a. Die Importnachfrage steigt.
b. Die Exportnachfrage steigt.
c. Die Importnachfrage steigt, die Exportnachfrage sinkt.
d. Die Importnachfrage sinkt, die Exportnachfrage steigt.
d. Die Importnachfrage sinkt, die Exportnachfrage steigt.
2.4.11
a.Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle {s_{t,t - 1} = \frac{\frac{w_{t}H_{t}^{U}}{U_{t}}}{\frac{Y_{t,t - 1}^{r}}{L_{t}}} = D_{t,t - 1}\frac{w_{t}H_{t}^{U}}{Y_{t}}\frac{L_{t}}{U_{t}} }{\frac{L_{t}}{U_{t}} = \frac{H_{t}}{H_{t}^{U}} \Rightarrow s_{t,t - 1} = D_{t,t - 1}\frac{w_{t}H_{t}^{U}}{Y_{t}}\frac{H_{t}}{H_{t}^{U}} = D_{t,t - 1}\frac{w_{t}H_{t}}{Y_{t}}}}
b. Die Lohnstückkosten sind aus methodischer Sicht zweifelhaft, da nominelle und reale Werte verbunden werden. Da die Lohnstückkosten bei dynamischer Betrachtung den Stundenlohn mit dem BIP-Deflator multiplizieren, wird der Effekt, den Löhne auf den BIP-Deflator haben, lediglich verstärkt, der Informationsgewinn hinsichtlich der Preiswettbewerbsfähigkeit ist fraglich.
c.Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle D_{t,t} = 1 \Rightarrow s_{t,t - 1} = \frac{w_{t}H_{t}}{Y_{t}}}
d. Unter der Annahme, dass selbständige und mithelfende Erwerbstätige den durchschnittlichen Stundenlohn der Arbeitnehmer*innen erhielten, lässt sich abschätzen, welchen Anteil des Bruttoinlandsprodukts und damit der Produktion auf den Faktor Arbeit zurückgeht. Die Aussagekraft ist jedoch begrenzt, da nicht bekannt ist, welchen Marktwert die Arbeit aller selbständig und mithelfend Erwerbstätigen tatsächlich im Durchschnitt hat.
e. Die nominellen Lohnstückkosten werden durch den Verbraucherpreisindex Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle V} dividiert: Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle s_{t,t - 1}^{r} = \frac{D_{t,t - 1}w_{t}H_{t}}{V_{t,t - 1}Y_{t}}}
2.4.12
a. Die Lohnstückkosten messen bei statischer Betrachtung (wie im Zitat formuliert) nicht die Produktion pro Stunde, sondern den Anteil der Arbeitskosten am BIP unter der Annahme, dass die Arbeit der Selbständigen und Mithelfenden zum selben Satz wie jene der Unselbständigen entlohnt würde, wenn sie unselbständig wären.
b. Da auch hier in der Gegenwart formuliert wird, bezieht sich die korrekte Interpretation der Aussage auf den Anteil der Arbeitskosten an der Wertschöpfung der Unternehmen. Das würde laut Zitat letztlich nichts anderes bedeuten, als dass die betreffenden Unternehmen eine höhere Gewinnquote aufweisen.
c. Die Lohnstückkosten lassen sich auch darstellen als nomineller Lohn dividiert durch reale Produktivität. Bei positiver Inflation werden nominelle Werte freilich stets rascher steigen als reale Werte, insofern würde man im Normalfall nichts anderes als einen stärkeren Anstieg der (nominellen) Löhne als der (realen) Arbeitsproduktivität erwarten. Unterschiedliche Inflationsraten werden zu Änderungen der Wechselkurse führen und sagen daher per se nichts über die Preiswettbewerbsfähigkeit aus.
d. Da die Lohnstückkosten dem nominellen Lohn dividiert durch die reale Produktivität entsprechen, kann die Produktivität ihrerseits als nomineller Lohn dividiert durch Lohnstückkosten dargestellt werden. In der Gleichung reduzieren höhere Lohnstückosten tatsächlich die Produktivität, allerdings ist der Zusammenhang nicht kausal, wie jedoch im zitierten Bericht suggeriert wird: Die Entwicklung der Lohnstückkosten wird über die Entwicklung der Produktivität definiert, nicht umgekehrt.
e. Das Zitat ist in der Gegenwart formuliert, weshalb wie unter a. mit den Lohnstückkosten der Anteil der Arbeitskosten am BIP gemeint ist, unter der Annahme, dass die Arbeit der Selbständigen und Mithelfenden zum selben Satz wie jene der Unselbständigen entlohnt würde, wenn sie unselbständig wären. Da hohe Produktivität üblicherweise mit hohen Löhnen korreliert, wäre eher eine Abweichung davon erwähnenswert, nicht die Bestätigung.
2.4.13
Das Grenzprodukt der Arbeit hängt von ihrer Produktivität ab, welche wiederum von der vorhandenen Technologie und dem zur Verfügung stehenden Sach- und Humankapital determiniert. Je fortgeschrittener die Technologie und je mehr Sach- und Humankapital je Arbeitskraft zur Verfügung stehen, umso produktiver wird diese sein. Wird Arbeit annähernd ihrem Grenzprodukt entsprechend entlohnt, dann zeigen hohe Löhne eine hohe Produktivität an. Da das Konzept der Wettbewerbsfähigkeit letztlich auf Produktivität hinausläuft, sind hohe Löhne nur bei entsprechend hoher Wettbewerbsfähigkeit erzielbar.
2.4.14
Industriepolitik umfasst öffentliche Interventionen zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit unter Berücksichtigung der jeweils spezifischen Rahmenbedingungen in den einzelnen Industriezweigen. Man unterscheidet die (i) vertikale Industriepolitik, die zum Ziel hat, bestimmte Branchen zu fördern, (ii) horizontale Industriepolitik, welche – ohne zwischen Branchen zu diskriminieren – die allgemeinen Funktionen des Wirtschaftssystems zu verbessern sucht, (iii) Industriepolitik im engeren Sinn, die sich auf die Wettbewerbsfähigkeit des industriellen Sektors konzentriert, sowie (iv) Industriepolitik im weiteren Sinn, die zum Ziel hat, die Produktionsstruktur einer Ökonomie so zu beeinflussen, dass das Wachstumspotenzial der Gesamtwirtschaft erhöht wird, Letztere wird auch als Strukturpolitik bezeichnet.
2.4.15
a. Der Arbeitnehmer vergleicht sein Lebenseinkommen bei Verbleib in der Heimatregion Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle X} mit jenem Lebenseinkommen, dass er bei Migration in Ökonomie Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle Y} erzielen würde, wobei er Letzteres sowie die totalen Migrationskosten von Ersterem abzieht:
Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle w_{20}^{Y} + \frac{w_{21}^{Y}}{(1 + r)} + \frac{w_{22}^{Y}}{(1 + r)^{2}} + ... - \left( w_{20}^{X} + \frac{w_{21}^{X}}{(1 + r)} + \frac{w_{22}^{X}}{(1 + r)^{2}} + ... \right) - M}
Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle M} entspricht den Migrationskosten. Ist die Differenz positiv, so bleibt der Arbeitnehmer in seiner Heimat-Region; ist die Differenz negativ, wird er migrieren.
Je höher der Lohn in der potenziellen Ziel-Ökonomie, umso größer die Migrationswahrscheinlichkeit. Daraus folgt, dass höher qualifizierte Arbeitnehmer*innen eher migrieren werden, da die Wahrscheinlichkeit größer ist, dass die Qualifikation in ihrer spezifischen Ausprägung außerhalb der Heimat-Ökonomie nachgefragt wird. Ferner lohnt sich Migration eher für junge Arbeitnehmer*innen, da diese buchstäblich mehr Zeit haben, die Kosten der Migration durch höhere Einkommen wettzumachen.
2.4.16
a. Der gegenwärtige Wert des Lebenseinkommens, wenn der Arbeiter in Bregenz bleibt, beträgt Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle \sum_{t = 0}^{9}{\frac{22.000}{1,1^{t}} = 148.699}} ; geht er nach Leoben, beträgt der gegenwärtige Wert des Lebenseinkommens Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle \sum_{t = 0}^{9}{\frac{25.000}{1,1^{t}} = 168.976}} . Die Differenz ergeben die Migrationskosten, bei denen der Arbeiter gerade indifferent ist, also € 20.277. Man beachte, dass dieser Betrag auch die seelischen Kosten inkludiert, die Frage, die sich der Arbeiter stellen muss, lautet also: „Ist es mir 20.277 Euro abzüglich aller pekuniären Umzugs- und Reisekosten wert, die letzten zehn Jahre meines Arbeitslebens in Leoben zu verbringen?“
b. Für die letzten fünf Jahre werden mit einer Wahrscheinlichkeit von jeweils 50% ein Einkommen von € 25.000 bzw. € 35.000 in Leoben angenommen, formal Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle \sum_{t = 0}^{4}{\frac{25.000}{1,1^{t}} +}0,5\sum_{t = 5}^{9}{\frac{25.000}{1,1^{t}} +}0,5\sum_{t = 5}^{9}\frac{35.000}{1,1^{t}}} .
c. Das erwartete Lebenseinkommens aus b. beträgt bei Umzug nun € 181.921, die maximalen Migrationskosten sind somit € 33.223.
2.4.17
a. Es ist davon auszugehen, dass Immigration neben Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle L} auch Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle H} erhöht, unter bestimmten Umständen außerdem Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle A} , jedoch Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle K} unberührt lässt. Der Effekt der Zuwanderung kann durch die entsprechenden Ableitungen approximiert werden:
Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \frac{\partial Y_{t}}{\partial L_{t}} = (1 - \alpha - \beta)\frac{{K_{t}}^{\alpha}H_{t}^{\beta}{A_{t}}^{1 - \alpha - \beta}}{{L_{t}}^{\alpha + \beta}}}
Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \frac{\partial Y_{t}}{\partial H_{t}} = \beta{K_{t}}^{\alpha}H_{t}^{\beta - 1}(A_{t}L_{t})^{1 - \alpha - \beta}}
Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \frac{\partial Y_{t}}{\partial A_{t}} = (1 - \alpha - \beta)\frac{{K_{t}}^{\alpha}H_{t}^{\beta}{L_{t}}^{1 - \alpha - \beta}}{{A_{t}}^{\alpha + \beta}}}
Da alle Variablen definitionsgemäß >0 sind und laut Angabe Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle (1 - \alpha - \beta) > 0} , sind alle Ableitungen ebenfalls >0.
b.Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \frac{Y_{t}}{L_{t}} = {A_{t}}^{1 - \alpha - \beta}\frac{{K_{t}}^{\alpha}}{{L_{t}}^{\alpha}}\frac{H_{t}^{\beta}}{{L_{t}}^{\beta}} \Rightarrow y_{t} = {A_{t}}^{1 - \alpha - \beta}{k_{t}}^{\alpha}h_{t}^{\beta},y = \frac{Y_{}}{L_{}},k = \frac{K_{}}{L_{}},h = \frac{H_{}}{L_{}}}
c.
Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \frac{\partial\left( \frac{Y_{t}}{L_{t}} \right)}{\partial L_{t}} = {A_{t}}^{1 - \alpha - \beta}\frac{- (\alpha + \beta){K_{t}}^{\alpha}H_{t}^{\beta}}{{L_{t}}^{1 + \alpha + \beta}} < 0}
Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \frac{\partial\left( \frac{Y_{t}}{L_{t}} \right)}{\partial H_{t}} = {A_{t}}^{1 - \alpha - \beta}\frac{\beta{K_{t}}^{\alpha}H_{t}^{\beta - 1}}{{L_{t}}^{\alpha + \beta}} > 0}
Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \frac{\partial\left( \frac{Y_{t}}{L_{t}} \right)}{\partial A_{t}} = (1 - \alpha - \beta)\frac{{K_{t}}^{\alpha}H_{t}^{\beta}}{{A_{t}}^{\alpha + \beta}} > 0}
Die Ableitung nach Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle L_{t}} ist eindeutig negativ, jene nach Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle H_{t}} und Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\textstyle A_{t}} sind eindeutig positiv. Es kommt also darauf an, ob die Immigrant*innen genügend Humankapital und neues Wissen mitbringen, sodass der zweite und dritte Effekt für den ersten Effekt kompensieren.
2.4.18
a. Profite entsprechen in der neoklassischen Theorie dem Grenzprodukt des Faktors Sachkapital, wodurch Ökonomien, in denen das entsprechende Grenzprodukt relativ hoch ist, Investitionen anlocken, während das entsprechende Grenzprodukt relativ niedrig ist, einen Abfluss an Investitionen erleben.
b.
Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle {\frac{\partial y_{t}}{\partial k_{t}} = \alpha A_{t}^{1 - \alpha - \beta}{k_{t}}^{\alpha - 1}h_{t}^{\beta} > 0 }{\frac{\partial^{2}y_{t}}{\partial k_{t}^{2}} = (\alpha - 1)\alpha A_{t}^{1 - \alpha - \beta}{k_{t}}^{\alpha - 2}h_{t}^{\beta} < 0}}
Die erste Ableitung ist eindeutig positiv, was bedeutet, dass zusätzliches Sachkapital zwar stets den Output erhöhen wird. Allerdings ist die zweite Ableitung eindeutig negativ, was bedeutet, dass zusätzliches Sachkapital stets das Grenzprodukt verringern wird. Unter sonst gleichen Umständen wird Kapital daher in jene Ökonomie fließen, die derzeit einen geringeren Sachkapitalbestand aufweist.
c.
Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \frac{\partial\left( \frac{y_{t}}{k_{t}} \right)}{\partial h_{t}} = \alpha\beta A_{t}^{1 - \alpha - \beta}{k_{t}}^{\alpha - 1}h_{t}^{\beta - 1} > 0}
Die Ableitung des Grenzprodukts des Faktors Sachkapital nach dem Faktor Humankapital ist eindeutig positiv, wodurch Ökonomien mit hohem Sachkapitalbestand auch dann ein höheres Grenzprodukt des Faktors Sachkapital als eine Ökonomie mit niedrigem Sachkapitalbestand aufweisen können, wenn der Humankapitalbestand der ersten Ökonomie groß genug ist. Bei gleich großem Sachkapitalbestand wird daher jene Ökonomie einen Zufluss an Nettoinvestitionen erleben, deren Humankapitalbestand größer ist.
2.4.19
Ökonomien, die bereits über einen hohen Sachkapitalbestand verfügen, bleiben für Neuinvestitionen trotz des sinkenden Grenzprodukts des Faktors Sachkapital attraktiv, wenn sie über ausreichend Humankapital verfügen. Zusätzlich sorgt der hohe Sachkapitalbestand für eine hohe Produktivität du damit für hohe Löhne. Somit ist die Ökonomie für alle Arbeitnehmer*innen attraktiv. Dem Faktor Humankapital kommt dabei eine besondere Bedeutung zu, weil
- potenzielle individuelle Einkommensgewinne aus der Migration umso höher sind, je höher das Qualifikationsniveau ist,
- der Faktor Humankapital nicht nur nach seinem Grenzprodukt, sondern gleichzeitig nach dem Grenzprodukt des Faktors Arbeit kompensiert wird,
- weshalb für den Faktor Humankapital eher wohlhabende Ökonomien attraktiv sind.
Die Folge ist eine Wanderung von Humankapitalträger*innen von weniger in Richtung produktiverer und damit wohlhabenderer Ökonomien. Indem Humankapital wiederum das Grenzprodukt des Faktors Sachkapital erhöht, bleiben die wohlhabenderen Ökonomien für Neuinvestitionen attraktiv. Dadurch bleiben die wohlhabenderen Regionen produktiver und damit wohlhabender, was wiederum Humankapitalträger*innen anlockt, usw. Die Folge ist ein Kreislauf, in der die weniger produktiven und wohlhabenden Ökonomien permanent Humankapital an die die produktiveren und wohlhabenderen Ökonomien verlieren.
Literaturverzeichnis
Grundlegende und weiterführende Literatur
Berhard Beck: Makroökonomie, UTB, 2011
George J. Borjas: Labor Economics [7. Aufl.], McGraw-Hill, 2016
Paul Krugman, Maurice Obstfeld, Marc Melitz: International Economics: Theory and Policy [10. Aufl.], Pearson, 2015
Thomas A. Pugel: International Economics [15. Aufl.], McGraw-Hill, 2012
Internetquellen
Eurostat, Datenbanken:
http://ec.europa.eu/eurostat/de/data/database (abgerufen am 14. Juli 2016)
Oesterreichische Nationalbank, Zahlungsbilanz:
https://www.oenb.at/Statistik/Standardisierte-Tabellen/auszenwirtschaft/zahlungsbilanz-und-internationale-vermoegensposition/zahlungsbilanz-gesamtuebersicht-global.html (abgerufen am 14. Juli 2016)
- ↑ Österreich trat dem 1947 geschlossenen Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommen (General Agreement on Tariffs and Trade, GATT), einem der Vorläufer der WTO, 1951 bei.
- ↑ Das Ricardo-Modell ist nach dem englischen Ökonomen David Ricardo benannt, erstmals 1817 publiziert, heute als Original nachzulesen in: Ricardo, David (1821): On the Principles of Political Economy and Taxation [third edition]. Auflage 1996: New York, Prometheus
- ↑ Zum Prinzip der Skalenerträge vgl. Grundlagen der Volkswirtschaftslehre 2 (Lektion 1.1.4) sowie Angewandte Makroökonomik (Lektion 1.1.2).
- ↑ Zur Transformationskurve im Zshg. mit Konsumentenpräferenzen vgl. Grundlagen der Volkswirtschaftslehre 4 (Lektion 2.2).
- ↑ Der geneigte Leser möge sich an dieser Stelle anhand des Lehrsatzes des Pythagoras überzeugen, dass die Dreiecksflächen exakt um die angegebenen Werte zunehmen.
- ↑ Messbar über die Entwicklung der Lohnquote, vgl. Angewandte Makroökonomik (Lektion 1.1.2).
- ↑ Eine Lösung dieses Problems wäre, die vom Freihandel negativ betroffenen Gruppen innerhalb der Gesellschaft entsprechend zu kompensieren.
- ↑ So wurde bspw. 2014 12,4% des EU-Budgets (16,5 Mrd. Euro) durch Zolleinnahmen der EU finanziert (Quelle: EU-Kommission, Steuern und Zollunion, http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_de.htm (abgerufen am 25. Mai 2016)).
- ↑ Der Schnittpunkt der Kurven S und D entspricht dem Inlandspreis unter Autarkie.
- ↑ So scheiterten bspw. die Verhandlungen zum Multilateralen Abkommen über Investitionen (MAI), einem Vorläufer der bei Drucklegung umstrittenen Transatlantischen Handels- und Investitionspartnerschaft (Transatlantic Trade and Investment Partnership, TTIP) nicht zuletzt am Motiv Frankreichs, seine Filmbranche vor der Konkurrenz aus den USA zu schützen, was jedoch dem Prinzip des Freihandels widerspricht.
- ↑ Zur VGR und zum BIP vgl. Angewandte Makroökonomik (Lektion 1.4.1).
- ↑ Zu diesem Prinzip vgl. Angewandte Makroökonomik (Lektion 1.1.2).
- ↑ Wie aus der weiter unten vorgestellten Zahlungsbilanz hervorgeht, kann keine Ökonomie für immer Nettoexporteur sein – es sei denn, sie verschenkt ihre Waren. Diese Feststellung ist im Kontext der Diskussion und Handlungen in der Eurokrise relevant: Ein Schuldenerlass ist letztlich gleichlautend mit einer rückwirkenden Schenkung. Gibt es keinen Schuldenerlass, dann muss auch ein Nettoexporteur mit vielen absoluten Handelsvorteilen irgendwann zum Nettoimporteuer werden. Somit ist ein Nettoimporteur nicht zwangsläufig nicht wettbewerbsfähig.
- ↑ Eine Ausnahme sind heutzutage äußerst seltene Realtauschvorgänge, die ihrem Charakter entsprechend nur in der Leistungsbilanz verbucht werden.
- ↑ Zum Unterschied zw. BIP und BNE vgl. Angewandte Makroökonomik (Tab. 1.1.1).
- ↑ Quelle: Oesterreichiche Nationalbank
- ↑ Hinsichtlich der Zusammenhänge mit der Geldpolitik vgl. Grundlagen der Volkswirtschaftslehre 4 (Lektion 1).
- ↑ Die reale Geldnachfrage ist keine Nachfrage nach einer bestimmten Anzahl von Währungseinheiten, sondern eine Nachfrage nach einer bestimmten realen Kaufkraftmenge in liquider Form. Wenn der Durchschnittsbürger bspw. bei einem Preisniveau von 100 pro Warenkorb 1000 GE in bar halten möchte, dann wäre seine reale Kassenhaltung gleich 10 Warenkörbe; vgl. hierzu auch das Skriptum Grundlagen der Volkswirtschaftslehre 3 (Lektion 2.1)
- ↑ „Üblicherweise“ meint hier abseits von Krisenzeiten. Man kann einwenden, dass dies in den westlichen Industriestaaten in den 2010er-Jahren eher die Norm darstellt. Das ändert jedoch nichts am Grundprinzip, da auch eine negative reale Rendite gewinnmaximierend sein kann.
- ↑ Benannt nach dem Ökonomen Irving Fisher, nachzulesen in: Fisher, I. (1930): The Theory of Interest: As Determined by Impatience to Spend Income and Opportunity to Invest it. Macmillan, New York
- ↑ Besonders spektakulär war 1992 die Ansicht George Soros’, das britische Pfund, das damals Teil des Euro-Vorläufers ECU war, sei überbewertet. Er hat Pfund in derart großen Mengen gekauft und geliehen und gegen andere europäische Währungen eingetauscht, bis Großbritannien seine Währung aus dem Wechselkursmechanismus zurückziehen musste und das Pfund abwertete. Soros’ Gewinn aus dieser Spekulation wird auf eine Milliarde US-$ geschätzt, die Kosten für die britische Allgemeinheit auf ein Vielfaches davon.
- ↑ Die Konvergenzkriterien entsprechen Artikel 140 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, Quelle der hier zitierten Zusammenfassung: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=URISERV%3Aec0013
- ↑ Korrekt wären hier Prozentpunkte.
- ↑ Produktivität ist definiert als Output je Arbeitseinheit, üblicherweise berechnet als BIP je Erwerbstätigen oder BIP je Arbeitsstunde; für Details vgl. Lektion 2.2.6.
- ↑ Man beachte, dass weder die Lohnhöhe an sich noch das Produktivitätswachstum an sich ein Problem verursachen – entscheidend ist die Differenz im Unterschied zu anderen Ländern. Ähnlich wie bei komparativen Vorteilen müssen also gleichzeitig vier Variablen in zwei Ländern betrachtet werden, um zu einer Aussage hinsichtlich der Wettbewerbsfähigkeit zu kommen.
- ↑ Zum BIP-Deflator vgl. Grundlagen der Volkswirtschaftslehre 1 (Lektion 1.3.4).
- ↑ Zur Lohntheorie vgl. Angewandte Makroökonomik (Lektion 2.2.2).
- ↑ Zur Entwicklung der Lohnquote in Österreich vgl. Tab. 2.3 in Angewandte Makroökonomik (Lektion 2.4.2).
- ↑ Zu den volkswirtschaftlichen Kosten der Arbeitslosigkeit vgl. Angewandte Makroökonomik (Lektion 2.1.1).
- ↑ Zum langfristigen Wachstumspfad vgl. Angewandte Makroökonomik (Lektion 1.2.2).
- ↑ Nachzulesen in: Krugman, P. (1994): Competitiveness: A Dangerous Obsession, in: Krugman, P. (1997): Pop Internationalism. The MIT Press, Cambridge [MA] und London
- ↑ Diese Darstellung folgt Eurostat (http://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/de/tipslm10_esms.htm, abgerufen am 30. Juni 2016);
- ↑ Zur Lohnquote vgl. Angewandte Makroökonomik (Lektionen 2.3.2 und 2.4.2).
- ↑ Diese Darstellung findet sich in den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen der Statistik Austria.
- ↑ Zur Popularität der Lohnstückkosten mag auch ihre deutsche Bezeichnung beitragen, da sie irreführenderweise mit der Frage „wie viel Lohn kostet ein Stück?“ assoziiert werden. Treffender ist die englische Bezeichnung unit labour cost, als sie eher mit der Frage „wie viel je Produkt kostet der Faktor Arbeit?“ korrespondieren.
- ↑ Diese Definition sowie Teile der folgenden Diskussion folgen Peneder, M. (2014): Warum die Neue Industriepolitik die Deindustrialisierung beschleunigen wird, FIW Policy Brief 23
- ↑ Für eine detaillierte Diskussion vgl. Angewandte Makroökonomik (Lektion 1.1.2).
- ↑ Das Roy-Modell ist benannt nach dem Ökonomen Andrew D. Roy, dessen Ideen später von George J. Borjas weiterentwickelt wurden, vgl. Roy, A.D. (1951): Some thoughts on the distribution of earnings, Oxford Economic Papers 3, 135-146; Borjas, G. J. (1987) Self-selection and the earnings of immigrants, The American Economic Review 77, 531-553
- ↑ Die Darstellung folgt Angewandte Makroökonomik (Lektion 1.2.3).
- ↑ Man beachte, dass mit Humankapital nur jene Ausbildung, Erfahrung und Fertigkeiten des Faktors Arbeit gemeint sind, die sich im Produktionsprozess auch verwerten lassen. Es ist daher denkbar, dass sich das in einer Arbeitseinheit verkörperte Humankapital durch den Akt der Migration verändert, wenn die Nachfrage nach der bestimmten Ausprägung des Humankapitals in den Ziel- und Herkunftsökonomien voneinander abweichen. Diese Unterscheidung ist bspw. dann von Bedeutung, wenn gut ausgebildete Arbeitnehmer in ihrer Herkunfts-Ökonomie keinen adäquaten Arbeitsplatz finden und emigrieren, oder wenn die Qualifikationen von Immigranten in der Ziel-Ökonomie nicht anerkannt werden, oder aufgrund von Sprachbarrieren etc. nicht angewendet werden können.