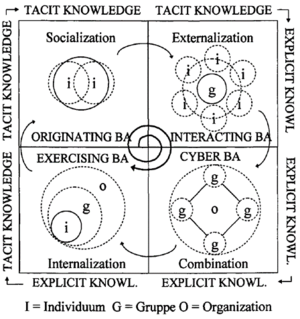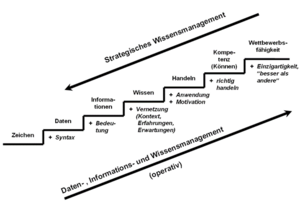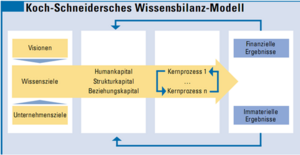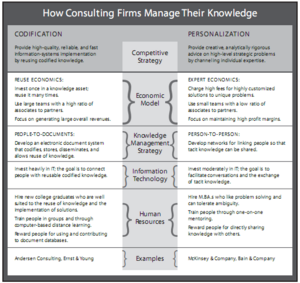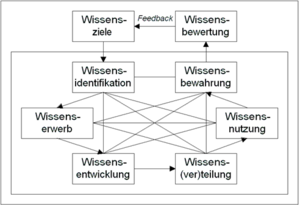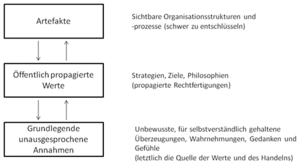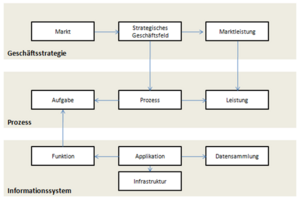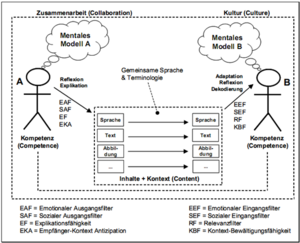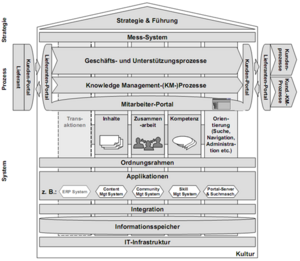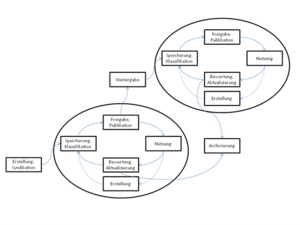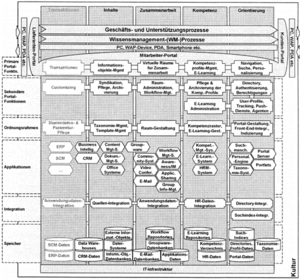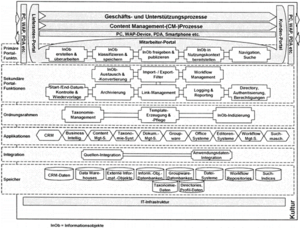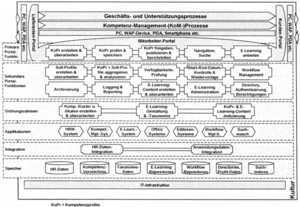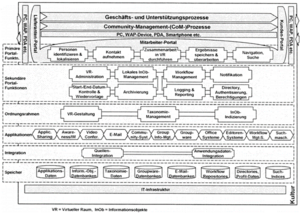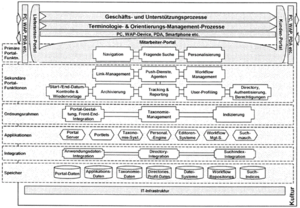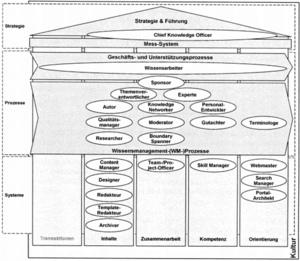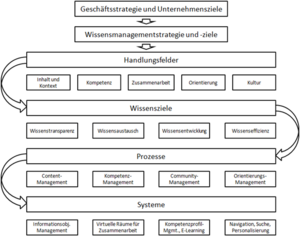Knowledge Management Instruments und Enterprise Knowledge Infrastructures - Gesamt
Während seiner Tätigkeit für ein großes österreichisches Unternehmen in der IT Branche absolvierte Christoph Köppl das berufsbegleitende Studium Wissensmanagement an der FH Wien – Studiengänge der WKW. Nach einigen Jahren im operativen Support übernahm Christoph Köppl zunächst die Administration und später die Leitung eines 25-köpfigen Support Teams. Zu seinen Aufgaben zählten die Implementierung von neuen Support Projekten sowie die Koordination der laufenden Services mit den Auftraggebern. Nach seinem Wechsel in die interne IT betreut er das intern und bei Kunden eingesetzte Service Management Tool ITSM und widmet sich dem Service Reporting.
Wissen
Einleitung
Die Auseinandersetzung mit dem Begriff Wissen und den Mechanismen seiner Entstehung beschäftigt die westliche Philosophie seit vielen hundert Jahren. Je nach philosophischer Ausrichtung waren Erkenntnis, Wissen und Wahrheit mehr oder weniger stark miteinander verknüpft. Platon sah Wissen als eine objektive Tatsache, die unabhängig von den Sinneswahrnehmungen eines Menschen ist. Demzufolge kann alles Wissen durch logisches Denken hergeleitet werden, eine Annäherung an die absolute Wahrheit ist nur durch Logik möglich. Dieser Sichtweise diametral entgegengesetzt ist jene von Aristoteles. Er sieht Wissen als das Resultat menschlicher Erkenntnisprozesse. Diese sind nach Aristoteles nicht durch Logik bestimmt, sondern durch Sinneswahrnehmungen und Erfahrungen (vgl. Mandl/Reinmann-Rothmeier 2000, S. 4–5). Diese Sichtweise entspricht dem Alltagsverständnis von Wissen als Summe individueller Erfahrungen und Erkenntnisse. Menschen nutzen ihre Kenntnisse und ihre erworbenen Fähigkeiten, um ihren Alltag zu bewältigen und Probleme zu lösen (vgl. Probst et al. 2006, S. 22).
Teile dieses Wissens können artikuliert und schriftlich dokumentiert werden. Theoretisches und Faktenwissen reichen nicht aus, einen Menschen zu kompetentem Handeln zu befähigen. Fahrrad fahren zu erlernen, indem man den Bewegungsablauf anhand einer schriftlichen Ablaufbeschreibung studiert, ist undenkbar. Der Erfolg stellt sich erst ein, wenn das Gehirn die unterschiedlichen Sinneswahrnehmungen interpretieren kann und die passenden Bewegungsabläufe verinnerlicht hat. Ähnlich verhält es sich mit den Anforderungen, die Menschen in den verschiedensten Berufen erfüllen müssen. Meisterschaft entsteht durch Erfahrung und die Fähigkeit, aus der Essenz dieser Erfahrung Wissen zu generieren und anderen weiterzugeben. Ein Meister schöpft seine außergewöhnlichen Fähigkeiten, wie körperliches Geschick oder intuitive Problemlösungsfähigkeit, aus seiner jahrelangen Erfahrung. Dieses Erfahrungswissen zu artikulieren und anderen zu vermitteln ist eine besondere Herausforderung für den Ausbildungsprozess (vgl. Willke et al. 2001, S. 12–14). Diese Unterscheidung zwischen Faktenwissen und Erfahrungen ist für Wissensmanagement von großer Bedeutung, daher wird die Dichotomie von implizitem und explizitem Wissen im Abschnitt 1.2.1 noch genauer erläutert.
In eine ähnliche Richtung geht die Abgrenzung von Wissen, Information und Daten. Die klare Unterscheidung zwischen diesen Begriffen macht den Gegenstandsbereich von Wissensmanagement deutlich. Im täglichen Sprachgebrauch werden diese Begriffe oft synonym verwendet, wodurch eine differenzierte Betrachtung der jeweiligen Eigenheiten behindert wird. Bei der Analyse der verschiedenen Wissensmanagement-Modelle ist die Kenntnis der Unterschiede hilfreich, um die unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen der eingesetzten Methoden zu verstehen.
Wissensarten
Implizites und explizites Wissen
Mit der Unterscheidung zwischen implizitem und explizitem Wissen hat Michael Polanyi eine grundlegende Aussage zur Nutzung und Übertragbarkeit von Wissen getroffen. Seine Überlegungen sind zentraler Bestandteil der meisten Theorien und Modelle, die die Wissensmanagementliteratur hervorgebracht hat. Auslöser für Polanyi´s Beschäftigung mit den beiden Wissensarten waren die Erkenntnisse der Gestaltpsychologie. Diese untersucht die Besonderheiten des menschlichen Wahrnehmungsapparates. Dieser versetzt den Menschen in die Lage, unvollständige Informationen zu ergänzen und mit Sinn zu erfüllen. Bei Versuchen mit Reizstrom konnte nachgewiesen werden, dass die Probanden Muster erkannten und Reaktionen antizipierten, ohne dafür eine bewusste Erklärung machen zu können. Ihre Leistung schien mehr auf Intuition zu beruhen als auf wohl überlegten Entscheidungen. Aus diesen Erkenntnissen zog Polanyi den Schluss, dass der Mensch mehr weiß, als er zu sagen vermag (vgl. Polanyi/Sen 2009, S. 6–8). Diese zweite, intuitive Kategorie von Wissen bezeichnete er als implizites Wissen. Es ist dadurch charakterisiert, dass es auf körperlichen Erfahrungen, Bewegungsabläufen und Sinneseindrücken beruht, die untrennbar an den Menschen gebunden sind, der sie gemacht hat. Dieses körperliche Wissen befähigt den Menschen zu manuellen Fertigkeiten ebenso wie zum Erkennen komplexer Zusammenhänge. Darauf aufbauend können intuitive Entscheidungen getroffen werden, für die es scheinbar keine nachweisbaren Fakten gibt und die daher nach objektiven Kriterien nicht ausreichend begründet werden können. Dieses implizite Wissen ist weitgehend unbewusst und selbst der bewusste Teil kann kaum artikuliert werden (vgl. Polanyi/Sen 2009, S. 10–16). Kreative Wissensarbeit ist geprägt von diesen Mustererkennungs-Prozessen, in denen sich Menschen auf der Basis unvollständiger Information und ihrem Erfahrungsschatz zwischen verschiedenen Handlungsalternativen entscheiden.
Der Gegenpol zum impliziten Wissen ist das explizite Wissen. Dieses ist seinem*seiner Träger*in bewusst und vollständig artikuliert oder zumindest vollständig artikulierbar. Das explizite Wissen besteht aus der Kenntnis von Einzelheiten und den zwischen ihnen bestehenden Zusammenhängen. Polanyi erklärt die Unterschiede zwischen den beiden Wissensarten anhand eines praktischen Beispiels: Der Konstrukteur eines Fahrzeuges besitzt darüber explizites Wissen. Er kennt alle seine Bestandteile, ihre Position im Fahrzeug, ihre Funktion, wechselseitige Abhängigkeiten und Zusammenhänge. Seine Kenntnisse über das Fahrzeug befähigen ihn dazu, dieses zu konstruieren und zu warten. Andererseits ist dadurch nicht gesagt, dass er auch in der Lage ist, das Fahrzeug sicher durch den Verkehr zu lenken. Dem gegenüber besitzt ein ausgebildeter Fahrer mit Erfahrung im Umgang mit Kraftfahrzeugen das notwendige implizite Wissen, um es sicher zu lenken. Er braucht dazu kein Wissen über die technischen Einzelheiten und den Aufbau des Fahrzeuges (vgl. Polanyi/Sen 2009, S. 18–19).
In der Praxis lassen sich die beiden Wissensarten nicht so klar trennen, wie es das Beispiel suggeriert. Sowohl beim Konstrukteur als auch beim Fahrer sind beide Wissensarten involviert, wenn auch mit unterschiedlicher Ausprägung. Der Konstrukteur wäre ohne implizites Wissen gar nicht in der Lage, das komplexe Zusammenspiel der einzelnen Komponenten zu erfinden. Der Fahrer braucht zum Steuern des Fahrzeuges zwar überwiegend implizites Wissen über die verschiedenen Bewegungsabläufe, ohne explizites Wissen kommt aber auch er nicht aus. Er muss die Bedienungselemente und Anzeigen kennen und für die Teilnahme am Straßenverkehr ausreichende Kenntnis über die Straßenverkehrsordnung besitzen. Damit wird deutlich, dass dieses Beispiel für beide Akteure beide Wissensarten voraussetzt, allerdings mit unterschiedlicher Ausprägung. Dennoch zeigt dieses Beispiel auch, dass für alltägliche Handlungen überwiegend implizites Wissen genutzt wird und dass der Anteil von explizitem Wissen vergleichsweise gering ausfallen kann. Umgekehrt genügt explizites Wissen alleine nicht, um komplexe Handlungen auszuführen, da das theoretische Wissen alleine einen Menschen nicht in die Lage versetzt, die notwendigen körperlichen Schritte auszuführen. Menschen schätzen dieses Verhältnis meistens falsch ein, da sie sich aufgrund des unbewussten Charakters von implizitem Wissen gar nicht über die einzigartigen Fähigkeiten klar sind, zu denen sie das menschliche Gehirn gepaart mit dem Wahrnehmungsapparat befähigt.
Exkurs: SECI-Modell
Die Unterscheidung zwischen implizitem und explizitem Wissen bildete die Grundlage für das Modell der Wissensschaffung von Nonaka et al. Dieses ist eine der bekanntesten Theorien zur Wissensschaffung. Die Autor*innen differenzierten das implizite Wissen weiter, indem sie ihm technische und kognitive Elemente zuschrieben. Der technische Aspekt beschreibt die Fertigkeiten einer Person, die durch sein*ihr handwerkliches Können bestimmt werden. Können beweist sich in der Praxis, bei der praktischen Ausführung von Handlungen und Bewegungsabläufen. Damit soll nicht der Eindruck vermittelt werden, dass darunter nur manuelle, körperliche Tätigkeiten zu verstehen sind. In diese Kategorie fällt beispielsweise auch der kompetente Umgang mit Computern, der neben den theoretischen Zusammenhängen auch die koordinierte Eingabe mit Maus und Tastatur voraussetzt. Die kognitiven Elemente des impliziten Wissens werden durch die mentalen Modelle verkörpert, mit denen Menschen neue Sinneseindrücke und Informationen bewerten. Je nach dem Grad der Übereinstimmung integrieren sie die neuen Informationen in ihr bestehendes Modell, oder erweitern dieses wenn nötig. Mentale Modelle werden dazu verwendet, die Umwelt anhand der darin abgebildeten Kenntnisse und Erfahrungen zu strukturieren (vgl. Nonaka et al. 1997, S. 72–73). Das explizite Wissen beschreiben Nonaka et al. als geistiges, objektives und objektivierbares Wissen, das unabhängig vom Menschen existiert. Es lässt sich in Form von Modellen und Theorien beschreiben, wobei diese Modelle von den oben beschriebenen mentalen Modellen zu unterscheiden sind. Diese Modelle beschreiben komplexe Systeme anhand ihrer Elemente und ihres Zusammenspiels, das durch Regeln beschrieben ist (vgl. Nonaka et al. 1997, S. 73).
Die Wissensspirale beschreibt den Prozess der Wissensschaffung, der sich durch die Wechselwirkung der Wissensarten in vier Schritten vollzieht. Durch Sozialisation wird das implizite Wissen direkt von einer Person an eine andere weitergegeben. Die älteste Form der Weitergabe von Erfahrungswissen ist die Beziehung zwischen Lehrmeister*in und Schüler*in. Auch Erfahrungsgruppen, Trainee Programme und die Einarbeitung neuer Mitarbeiter*innen verfolgen dieses Ziel. Die größte Dynamik weist in diesem Kontext die Projektgruppe auf, deren Ziel die Erfüllung einer Aufgabe ist, was in der Regel mit dem Austausch von Wissen zwischen den Projektmitarbeiter*innen verbunden ist. Durch Externalisierung soll das implizite Wissen in eine explizite Form überführt werden. Dazu müssen Mitarbeiter*innen ihre Vorstellungen und mentalen Modelle ausformulieren und in eine schriftliche oder grafische Form bringen. Zum besseren Verständnis werden die Konzepte in Metaphern, Analogien und Modellen verpackt. Das explizite Wissen liegt in Form von Dokumenten vor, die mit Hilfe von IT-Systemen ausgewertet werden können. Durch die Kombination der verschiedenen Informationen entsteht neues Wissen, das für die Entwicklung neuer Produkte und Leistungen verwendet wird. Die Informationen aus Dokumenten und Systemen durchdringen das gesamte Unternehmen und erreichen damit eine größere Verbreitung, als dies durch den direkten Austausch möglich wäre. Diese Informationen werden von den Mitarbeiter*innen in ihren Arbeitsprozessen verwendet. Die dabei entstehenden Erfahrungen stellen eine erneute Transformation von Wissensarten dar, in diesem Fall von explizit zu implizit. Diese vier Arten der Wissensumwandlung bilden einen ständigen Kreislauf. Die einzelnen Umwandlungsschritte transportieren das Wissen in immer größere Strukturen: vom Team zur Abteilung, von dort quer über die Bereiche und schließlich in das gesamte Unternehmen und über Unternehmensgrenzen hinweg. Dieser Aspekt wird im SECI-Modell (Socialization, Externalization, Combination, Internalization) durch die Spirale ausgedrückt, die die Spiralbewegung des Wissens symbolisiert. Nonaka hat das SECI-Modell später um das Konzept des Ba erweitert. Dieses verbindet die vier Transformationen mit physischen und virtuellen Räumen für Wissensaustausch und Interaktion. Die folgende Abbildung zeigt, wie der Wissensaustausch an diesen Orten zwischen zwei Individuen, in Gruppen und quer über die gesamte Organisation stattfindet (Nonaka, Konno).
Das Modell der Wissensspirale legte die Basis für die modernen Wissensmanagement-Theorien, die den technikgetriebenen Ansätzen eine Absage erteilten. Der Mensch und das an ihn gebundene Wissen rückten ins Zentrum der Wissensmanagement- Theorien, während die Bedeutung der IKT (Informations- und Kommunikationstechnik) auf ihre Unterstützungsfunktion reduziert wurde. Das Modell der Wissensgenerierung wurde anhand theoretischer Konzepte wie den Wissensarten, gepaart mit den Erfahrungen von Praxisfällen japanischer Unternehmen, geschaffen. In der wissenschaftlichen Literatur geriet das Modell aus verschiedenen Gründen in Kritik, unter anderem wurde mangelnde theoretische Fundierung unterstellt. Ein spezifischerer Kritikpunkt betrifft die zentrale These des SECI-Modells, nach der implizites Wissen expliziert und in dieser Form übertragbar gemacht werden kann. Polanyi´s Definition für implizites Wissen schließt seine Explizierung wegen seines überwiegend unbewussten Charakters und seine körperliche Bindung an seinen Träger jedoch aus (vgl. Schreyögg/Geiger 2003, S. 15–16). Das von Nonaka et al. beschriebene Erfahrungswissen ist, wenn man Polanyi´s Gedanken streng auslegt, kein implizites Wissen. Die Geschichten und mentalen Modelle, in denen das Erfahrungswissen artikuliert wird, sind vergleichbar mit dem narrativen Wissen, das schon seit Jahrtausenden zur Überlieferung der menschlichen Geschichte dient. Charakteristisch für narratives Wissen ist seine Artikulierbarkeit und seine Weitergabe in sozialen Prozessen (vgl. Schreyögg/Geiger 2003, S. 23). Schreyögg entwickelt diesen Gedanken weiter und definiert explizites und narratives Wissen als Gegenstand von Wissensmanagement. Implizites Wissen entziehe sich demgegenüber dem Wissensmanagement und ist viel mehr Gegenstand des Ressourcen- und Kompetenzmanagements (vgl. Schreyögg/Geiger 2003, S. 24–26).
Narratives Wissen
Narratives Wissen wird in sozialen Prozessen von einem*einer Erzähler*in an einen*eine Zuhörer*in weitergegeben. Es entsteht eine Kette, in der jede*r Teilnehmer*in zunächst die Zuhörerrolle und später die Erzählerrolle einnimmt. Seine Legimitation erlangt das narrative Wissen durch den Umstand, dass der*die Erzähler*in im Vorfeld selbst Zuhörer*in war. Er*sie ist damit nicht in der Rolle des*der Schöpfer*in, der seine*ihre Ideen verteidigen muss, sondern jener des*der Zeug*in, der*die wiedergibt, was er*sie wahrgenommen hat. Damit erlangt der*die Zuhörer*in die Kompetenz, in die Erzählerrolle zu wechseln und diese Geschichte weiterzugeben (Lyotard 2009, S. 65–66). Wird eine Geschichte erzählt, transportiert diese Erzählung nicht nur Fakten und nüchterne Ablaufbeschreibungen. Sie vermittelt darüber hinaus auch Normen und Werte und definiert die Kriterien, an denen Kompetenz und Erfolg zu messen sind. Sie erzeugt ein soziales Band zwischen dem Held*innen der Geschichte, dem*der Erzähler*in und dem*der Zuhörer*in. Diese Beziehung vermittelt zwischen Erzähler*in und Zuhörer*in, welches Handeln sozial erwünscht ist (vgl. Lyotard 2009, S. 67). Der Erwerb des narrativen Wissens versetzt seine*n Träger*in in die Lage, zu beurteilen, was als gut, schön, effizient usw. anzusehen ist. Narratives Wissen bildet damit die Grundlage für soziales Handeln. Es ist einerseits Ausdruck von Kultur, vermittelt diese in sozialen Gemeinschaften und wirkt gleichzeitig kulturschaffend, da Kultur erst durch die Anerkennung der Werte und Normen entsteht (vgl. Lyotard 2009, S. 62). Narratives Wissen, oder konkreter die dadurch vermittelten Normen und Werte, reduziert die Mehrdeutigkeit und Unsicherheit innerhalb eines Systems und schränkt die Vielzahl möglicher Handlungsalternativen auf die sozial erwünschten ein. Aus der Sicht eines Unternehmens ist dieses Wissen die Grammatik der Organisation, die regelt, wie Dinge zu erledigen und zu interpretieren sind (vgl. Weick/Hauck 2007, S. 12–16).
Wissensarten und Wissensmanagement
Das explizite Wissen ist artikuliertes und formalisiertes Wissen über Fakten und Zusammenhänge, das mittels verschiedener Medien zwischen mehreren Menschen übertragen werden kann. Eine naheliegende Variante ist die Sprache, die als gesprochenes Wort oder schriftlich festgehalten werden kann. Weitere Möglichkeiten sind Grafik, Animation und Video, mit denen sich komplexe Zusammenhänge leichter transportieren lassen als mit Worten. Auf dieser Ebene hat Wissensmanagement für geeignete Werkzeuge zu sorgen, mit denen diese Abbildungen erstellt, abgelegt, genutzt und übertragen werden können. Für das Management der Inhalte und die Unterstützung der direkten wie der indirekten Kommunikation bietet die IKT ein reiches Arsenal an Werkzeugen. Das sollte jedoch nicht dazu verleiten, Wissensmanagement als alleiniges Aufgabenfeld der Unternehmens IT zu sehen. Die Explikation von Wissen setzt intellektuelle und sprachliche Fähigkeiten voraus, die nicht jede*r Mitarbeiter*in mitbringt. Die Personalentwicklung kann die Explikationsfähigkeit durch Seminare über Kreativitätstechniken fördern.
Narratives Wissen beschreibt soziale Zusammenhänge und transportiert Normen und Werte. Es ist Ausdruck der vorherrschenden Kultur und schafft diese gleichermaßen durch seine stetige Entwicklung und Weitergabe in der Organisation. Der Einfluss der Unternehmenskultur auf die alltäglichen Handlungen ist beträchtlich. Das ist einerseits hilfreich, da Kultur ein gemeinsames Verständnis schafft und so dafür sorgt, dass alle auf das gleiche Ziel hinarbeiten. Kultur kann andererseits zu einem großen Problem werden, wenn sie dysfunktionales Verhalten erzeugt. Da sich Kultur einer direkten Steuerung entzieht, ist Wissensmanagement in diesem Handlungsfeld vor weitaus schwerere Anforderungen gestellt als im Bereich der Inhalte. Dies lässt sich am Beispiel des narrativen Wissens demonstrieren. Das Management eines Unternehmens kann durch organisatorische Maßnahmen die Kommunikation zwischen den Mitarbeiter*innen fördern oder diese auf ein Mindestmaß beschränken. Eine Zusammenarbeit ohne jeglichen zwischenmenschlichen Kontakt ist aber undenkbar. Menschliche Kommunikation ist selten auf den reinen Austausch von Fakten beschränkt. Sie transportiert durch unterschiedlichste Konnotationen der verwendeten Begriffe immer mehr als die reinen Inhalte. Darüber hinaus werden im persönlichen Kontakt auch informelle Informationen ausgetauscht, die eben jenes narrative Wissen beinhalten. Das Management kann also nur das Ausmaß der erzählten Geschichten beeinflussen, nicht jedoch die Inhalte dieser Geschichten. Im Bereich der Unternehmenskultur ist Wissensmanagement folglich auf Kontextsteuerung beschränkt (vgl. Lektion 3). Das narrative Wissen wurde aufgrund seiner Bedeutung auch in der Management Literatur aufgegriffen. Mit Methoden wie Storytelling (vgl. Denning 2005) und Storytheater (vgl. Stevenson 2008) soll das narrative Wissen in Geschichten verpackt werden, die den*die Zuhörer*in mitreißen. Geschichten transportieren Emotionen und sprechen damit den*die Zuhörer*in mehr an, als eine reine Faktendarstellung. Der emotionale Reiz ist ein zusätzlicher Stimulus für das Gehirn, der die Wahrscheinlichkeit deutlich erhöht, dass der*die Zuhörer*in die vermittelten Inhalte aufnimmt und in sein*ihr Wissen integriert (vgl. Spitzer 2009, S. 159–160).
Implizites Wissen besteht aus kognitiven und technisch-manuellen Fertigkeiten, welche Ausdruck der Kompetenz ihres*ihrer Träger*in sind. Es entzieht sich weitgehend der bewussten Wahrnehmung und kann entsprechend schwer artikuliert werden. Implizites Wissen muss durch Erfahrung erworben werden. Die althergebrachte Methode des Vormachens durch den*die Meister*in und der Nachahmung und ständigen Übung durch den*die Auszubildende*n ist für die Übertragung impliziten Wissens nach wie vor aktuell. Die Organisation und die räumliche Ausgestaltung der Arbeitsumgebung haben einen maßgeblichen Einfluss auf die Möglichkeiten für den Wissensaustausch. Sie begünstigen entweder die individuelle Arbeit oder die Arbeit im Team. Die Teamarbeit ermöglicht den direkten Austausch und bietet die Gelegenheit, kompetente Kolleg*innen zu beobachten und deren Handlungsweisen zu übernehmen. Durch die wiederholte gemeinsame Arbeit verfestigen sich Handlungen zu Handlungsroutinen. Dadurch entsteht das wertvolle Erfahrungswissen, das den Unterschied zwischen Kennen und Können ausmacht. Die Analyse Schreyögg´s, dass implizites Wissen vom narrativen Wissen zu unterscheiden sei und dass es Sache des Ressourcen- und Kompetenzmanagements sei, ist durchaus zutreffend. Im Kern liegt das Management der Kompetenz damit sicherlich beim Personalmanagement. Dieses verfügt über die Expertise, die Kompetenz der Mitarbeiter*innen messbar zu machen und einer Bewertung zu unterziehen. Andererseits können Wissensziele nur durch Mitarbeiter*innen mit den richtigen Kompetenzen erreicht werden. Kompetenzmanagement ist daher ein notwendiger Bestandteil von Wissensmanagement.
Daten – Information – Wissen
Die Differenzierung zwischen den Begriffen Daten, Information und Wissen bildet einen weiteren Grundstein für das Verständnis von Wissensmanagement. Eine anschauliche Darstellung der Zusammenhänge und Übergänge zwischen diesen Begriffen stammt von North. Er ordnet sie entlang einer Wissenstreppe an, zeigt, was für den Übergang von einem untergeordneten zu einem übergeordneten Begriff notwendig ist und bringt sie damit in eine hierarchische Beziehung. Folgt man der Treppe von links nach rechts, sind Daten Zeichen, die durch Syntaxregeln verbunden sind. Erlangen Daten Relevanz für eine*n Beobachter*in, schreibt er*sie ihnen eine spezifische Bedeutung zu. Damit werden sie für ihn*sie zur Information. Durch die Eigenheiten menschlicher Informationsverarbeitung werden Informationen nicht einfach nur abgelegt, sondern dabei mit vorhandenen Informationen vernetzt. Können die Informationen darüber hinaus in Handlungs- und Erfahrungskontexte eingebettet werden, entsteht dadurch Wissen. Seinen Wert erhält Wissen jedoch erst durch seine tatsächliche und kompetente Anwendung. Wie die untere Abbildung zeigt, verfolgt Wissensmanagement letztlich ein ökonomisches Ziel (vgl. North 2005, S. 32–33).
Daten sind Fakten über Ereignisse oder Vorgänge, sie entstehen durch deren Wahrnehmung (vgl. Davenport et al. 1999, S. 27). Die Beobachtung ist mit einem gewissen Aufwand verbunden, daher müssen diese Daten für den*die Beobachter*in relevant sein. Darüber hinaus müssen sie mit den bestehenden Vorstellungen über die Wirklichkeit vereinbar sein. Nur dadurch erlangen sie die Aufmerksamkeit, die zu ihrer Beobachtung notwendig ist.
Das Vorhandensein geeigneter Instrumente ist damit eine Voraussetzung für die Wahrnehmung und Aufzeichnung dieser Daten. Fehlen diese, entziehen sich die Ereignisse der menschlichen Wahrnehmung. Das zentrale Merkmal von Daten ist, dass es Syntaxregeln gibt, mit denen Zeichen angeordnet werden. Folglich können nur jene Ereignisse zu Daten werden, für die es Regeln gibt, nach denen sie codiert werden können (vgl. Willke et al. 2001, S. 7).
Mithilfe der Technologie hat der Mensch ein ständig wachsendes Arsenal an Instrumenten geschaffen, um damit Daten in beinahe beliebigem Ausmaß zu produzieren. Die stetig wachsenden Speicherdichten von IT-Systemen halten mit diesem Wachstum Schritt und erlauben es, diese Daten in scheinbar beliebiger Menge zu speichern und zu verarbeiten. Der Nutzen dieser Daten sinkt jedoch in dem gleichen Maß, in dem ihre Menge zunimmt. Die zunehmenden Datenmengen zu reduzieren und in eine sinnvolle Struktur zu bringen, bedingt wachsende Anstrengungen und einen intensiveren technischen Einsatz (vgl. Willke 2007, S. 30).
Folgt man der Treppe von der Ebene der Daten zur Information, ist die Betrachtung kybernetischer Systeme von Gregory Bateson hilfreich. Er hat Information anhand des Mechanismus definiert, mit dem ein Regelkreis einen stabilen Zustand aufrechterhält. In diesem Regelkreis gibt es einen gewünschten Zustand und einen gegenwärtigen Zustand. Jeder Zustand für sich genommen, ist ein einzelnes Datum. Die Abweichung zwischen diesen beiden Zuständen ist der Umstand, der für die Aufrechterhaltung des Regelkreises von Interesse ist. Die Kenntnis dieses Unterschiedes macht es möglich, geeignete Handlungen zu setzen, um den Gleichgewichtszustand aufrecht zu erhalten. Damit ist sie für das System von hohem Wert (vgl. Bateson/Holl 2006, S. 488). Bateson definiert Information daraus folgend, als „... irgendein Unterschied, der bei einem späteren Ereignis einen Unterschied ausmacht ...“ (Bateson/Holl 2006, S. 488). Der Wert einer Information entsteht nicht schon aufgrund der Tatsache ihrer Existenz, sondern ist systemrelativ. Nur wenn die Information einen Unterschied beschreibt, der nach den Relevanzkriterien eines Systems bedeutsam ist, bekommt sie einen Wert. Daraus folgert Willke, dass es keinen erfolgreichen Informationsaustausch zwischen verschiedenen Systemen geben kann. Unter der Voraussetzung bekannter, vereinbarter Syntaxregeln können Informationen als Daten codiert und übertragen werden. Diese werden von dem*der Empfänger*in interpretiert und nach seinen*ihren eigenen Relevanzkriterien bewertet, die von jenen des*der Sender*in regelmäßig abweichen werden (vgl. Willke et al. 2001, S. 8–9). Anhand dieser Überlegungen lässt sich die hierarchische Beziehung zwischen Daten und Information nachvollziehen. Information hat eine höhere qualitative Stellung und damit auch eine höhere Wertigkeit. Daten sind beobachtete Unterschiede, ihre bloße Kenntnis besitzt keinen hohen Wert. Erst die Anwendung zusätzlicher Relevanzkriterien identifiziert jene Unterschiede, deren Kenntnis die Basis zukünftiger Handlungen bildet und transformiert Daten auf diesem Weg zu Information (vgl. North 2005, S. 32–33; Willke 2007, S. 31).
Der Übergang von Information zu Wissen bedingt einen weiteren qualitativen Anstieg. Durch die Einbettung von Information in einen Handlungskontext sammelt ein Mensch Erfahrungen darüber, was sich in der Praxis bewährt. Es entsteht Wissen darüber, welche Handlungen geeignet sind, einen angestrebten Zustand zu erreichen. Wissen ist demnach kontextgebunden und erlangt seinen Wert durch seine Eignung für die Erfüllung einer bestimmten Aufgabe (vgl. Willke 2007, S. 33). Probst et al. formulieren dazu: „Wissen ist also nicht gleich Erkenntnis, sondern muss seinen Nutzen in der praktischen Anwendung erweisen.“ (Probst et al. 2006, S. 23). Nach dieser Definition existiert Wissen nicht unabhängig vom Menschen. Wissen ist an seine*n Träger gebunden und nicht ohne weiteres auf einen anderen Menschen übertragbar. Es entsteht durch Erfahrungen, die Menschen in ihren Handlungen machen. Durch fortwährende Selektion, Vergleich und Bewertung der Handlungsalternativen wird Wissen aufgebaut und weiterentwickelt. Wissen ist eng mit seinem*seiner Träger*in verbunden und Ausdruck seiner*ihrer individuellen Erfahrungen. Schon deshalb ist es nicht direkt auf eine andere Person übertragbar, die einen gänzlich anderen Stand an Erfahrungen hat. Menschen schreiben den Dingen in ihrer Umwelt Bedeutung zu und konstruieren sich damit ihre eigene Realität (vgl. Mandl/Reinmann-Rothmeier 2000, S. 6; Probst et al. 2006, S. 22). Menschen können ihre Vorstellung über die Realität nur aufgrund der bereits vorhandenen Annahmen entwickeln. Ihr aktueller Kenntnisstand ist also ausschlaggebend dafür, in welche Richtung die Entwicklung gehen kann. Diese konstruktivistische Sichtweise wird durch die Erkenntnisse der Neurobiologie unterstützt. Das menschliche Gehirn arbeitet nicht wie ein Prozessor eines Computers, der Informationen entgegennimmt und verarbeitet. Es ist ein System, das eine innere Struktur besitzt und Informationen nach dieser einordnet. Damit nimmt die innere Struktur vorweg, welche Zustände die Umwelt in der Wahrnehmung annehmen kann (vgl. Maturana/Varela 2009, S. 185).
Ein derartig enggefasster Wissensbegriff widerspricht sicherlich dem Alltagsverständnis vieler Menschen. Dies wird an Projekten wie Wikipedia deutlich, von der es heißt, sie sei die größte Sammlung an frei verfügbarem Wissen. Auch bei der Bemühung um einen holistischen Wissensmanagementansatz wurde eine weiter gefasste Definition von Wissen notwendig. In dieser ist Wissen nicht ausschließlich an Personen gebunden, sondern kann auch in anderen Formen vorliegen. Damit wird jenen Autor*innen widersprochen, die Wissen ausschließlich Prozesscharakter zusprechen (vgl. North 2005, S. 42; Willke et al. 2001, S. 12). Der weiter gefasste Wissensbegriff übernimmt die Hierarche von Daten, Information und Wissen, verschiebt jedoch die Grenzen zwischen diesen Begriffen. Damit wird es möglich, Wissen zu explizieren, in Dokumenten zu speichern und auf diesem Weg zu übertragen (vgl. Amelingmeyer 2004, S. 43–44). Wissen ist auch nach dieser Definition eng mit dem Menschen verbunden. Es wird als Produkt menschlicher Leistung gesehen, das abhängig vom bezweckten Einsatzgebiet die unterschiedlichsten Formen annehmen kann. Diese reichen von physischen Objekten bis hin zu elektronischen, wie etwa Einträge in einer Datenbank. Obwohl Wissen eine vom Menschen unabhängige Existenz erlangen kann, wird sein Wert auch nach dieser Sichtweise ausschließlich durch seine Eignung bestimmt, in bestimmten Situationen Handlungsmöglichkeiten zu eröffnen. Damit bleibt Wissen auch in den holistischen Wissensmanagementansätzen kontextgebunden (vgl. Heisig 2005, S. 11).
Ein dogmatisches Beharren auf einer der beiden Sichtweisen würde die Sicht auf das Wesentliche behindern und wäre bei der Analyse von Wissensmanagementansätzen wenig hilfreich. Ein Bewusstsein für die unterschiedlichen Interpretationen ist jedoch notwendig, um die unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen zu verstehen. Daher schlagen Probst et al. vor, die Wissensbasis eines Unternehmens als Kontinuum zu betrachten, in dem es ausgehend von den Daten einen stetigen Anstieg der Qualität zu Information und weiter zu Wissen gebe. Diese pragmatische Sichtweise entspricht den praktischen Erfordernissen, die sich beim Einsatz von Wissensmanagement in Unternehmen stellen. Damit wird dem Umstand Rechnung getragen, dass Wissensmanagement immer auch Elemente von Daten- und Informationsmanagements aufweist (vgl. Probst et al. 2006, S. 16–18). Die folgende Abbildung veranschaulicht anhand ausgewählter Kriterien den Anstieg der Qualität entlang des Kontinuums (vgl. Probst et al. 2006, S. 17).
Bewertung von Wissen
Trotz der langen Tradition schulischer und universitärer Bildung wurde der Bildungssektor in den vergangenen Jahren von einer Diskussion um die besten Methoden der Wissensvermittlung und der Messung der erreichten Erfolge beherrscht. Vor einer ähnlichen Herausforderung stehen Unternehmen, die Wissen als Produktionsfaktor bewirtschaften und damit im Managementprozess berücksichtigen müssen. Die Regeln für den Umgang mit den traditionellen Produktionsfaktoren Kapital und Arbeit lassen sich nur bedingt auf den Umgang mit Wissen anwenden. Der Einsatz von Kapital lässt sich mit präzisen Instrumenten messen. Ebenso kann der Output menschlicher Arbeitsleistung innerhalb bestimmter Grenzen gemessen werden. Beispiel dafür sind die verschiedenen Akkordlohnsysteme. Da sich der Einsatz von Wissen nicht erzwingen lässt, wird es mit zunehmendem Anteil geistiger, kreativer und schöpferischer Tätigkeiten bedeutend schwerer, den Output zu messen (vgl. Willke 2007, S. 62).
Dieser Aspekt der Wissensarbeit ist besonders kritisch, da sich der Erfolg einer Managementmaßnahme nur ermitteln lässt, wenn die Veränderung messbar ist. Die Messbarkeit bestimmt die Definition dessen, was als Erfolg oder als Misserfolg zu werten ist. Dies kann dazu führen, dass der Handlungsspielraum einer Organisation auf jene Bereiche beschränkt wird, die durch Indikatoren messbar gemacht werden können (vgl. Willke et al. 2001, S. 92–94). Die vorhandenen Instrumente der klassischen Steuerungslogik hierarchischer Strukturen, die das Wissen beim Management bündeln, bedienen sich kurzfristiger, quantitativer Indikatoren. Im Umfeld der Wissensökonomie, die durch verteiltes Wissen und differenzierte Kompetenz charakterisiert ist, müssen die Instrumente großteils erst noch geschaffen werden. Im Gegensatz zu den kurz- bis mittelfristig und meist monetär orientierten Indikatoren müssen jene des Wissensmanagements die langfristige Entwicklungsperspektive abbilden (vgl. Willke et al. 2001, S. 90–91; North 2005, S. 213).
Zur Erfassung dieser qualitativen Aspekte bieten sich Instrumente wie die Balanced Scorecard oder die Wissensbilanz an. Die Balanced Scorecard ist primär ein Steuerinstrument, während die Wissensbilanz darüber hinaus auch zur Darstellung des intellektuellen Kapitals eines Unternehmens nach außen verwendet wird. Die Erstellung einer Wissensbilanz ist für österreichische Universitäten verpflichtend. Auch Unternehmen geraten zunehmend unter Druck, Wissensbilanzen zu erstellen, da Regelungen von Basel II Banken dazu zwingen, die Sicherheit ihrer Investitionen langfristig zu bewerten (vgl. Alwert et al. 2005, S. 4–5). Während die Struktur der Wissensbilanzen durch das UG 2002 geregelt ist (vgl. UG 2002 vom 01.10.2002, § 13), gibt es für Unternehmen keine verbindlichen Vorschriften. Die Verwendung der Indikatoren ist daher nicht einheitlich, außerdem enthalten die publizierten Versionen nur selten Hinweise auf negative Entwicklungen. Im Normalfall werden nur die positiven Aspekte hervorgehoben (vgl. Alwert 2005a, S. 33–34). Die Bestandteile der Wissensbilanz werden daher anhand der Vorschriften für österreichische Universitäten vorgestellt. Das UG 2002 nennt die folgenden Punkte als Mindestbestandteile der Wissensbilanz (vgl. UG 2002 vom 01.10.2002, § 13), die durch die Wissensbilanzverordnung konkretisiert werden (vlg. WBV vom 15.02.2006, § 3):
- Wirkungsbereich, gesellschaftliche Zielsetzungen sowie eigene Ziele und Strategien
- Intellektuelles Vermögen unterteilt in die Teile Human-, Struktur- und Beziehungskapital
- Kernprozesse gegliedert nach Lehre und Weiterbildung sowie Forschung und Entwicklung
- Output und Wirkungen der Kernprozesse, wieder unterteilt nach Lehre und Weiterbildung sowie Forschung und Entwicklung
Resümee und Ausblick
Die Wissensbilanz-Verordnung gibt den Aufbau und die Form der einzelnen Abschnitte vor. Der Wirkungsbereich und die Zielsetzungen sind in narrativer Form zu erstellen. Die Bestandteile des intellektuellen Vermögens müssen durch Kennzahlen beschrieben werden (vgl. WBV vom 15.02.2006, § 4). Ihre genaue Definition befindet sich im Anhang der Verordnung (vgl. WBV vom 15.02.2006, Anlage 1), sodass die Wissensbilanzen der verschiedenen Universitäten miteinander vergleichbar werden. Der Aufbau der Wissensbilanz für Universitäten folgt dem von Koch und Schneider entwickelten Wissensbilanz-Modell, dessen Aufbau folgende Abbildung zeigt (Koch 2004, S. 27).
Die Wissensbilanz verbindet die Strategie mit den Prozessen und dem intellektuellen Kapital und stellt dessen Entwicklung den Ergebnissen der Prozesse gegenüber. Das intellektuelle Kapital wurde nicht erst im Rahmen der Wissensbilanz definiert. Es geht zurück auf die Arbeiten von Edvinsson und Sveiby. Deren Ziel war es, das Wissenskapital von Unternehmen analog zur Finanzbilanz darzustellen. Die vergangenheitsorientierten Finanzdaten sollten um eine Bilanzierung des Wissens ergänzt werden. Die zukünftige Entwicklung eines Unternehmens hängt im Wesentlichen von seiner Kompetenz ab, durch die es sich von seinen Mitbewerbern abhebt. Bei der Risikoabschätzung sind diese zukunftsorientierten Informationen wesentlich wichtiger als die finanziellen Erfolge in der Vergangenheit. Das intellektuelle Kapital besteht aus den Elementen Humankapital, Strukturkapital und Beziehungskapital. Das Humankapital umfasst das Wissen und die Fähigkeiten der Mitarbeiter*innen und schließt auch die Innovationsfähigkeit ein (vgl. Edvinsson/Brünig 2000, S. 19). Zum Strukturkapital gehören Patente, Konzepte, Modelle, IT- und Verwaltungssysteme sowie die Unternehmenskultur. Salopp formuliert ist das Strukturkapital jener Teil des intellektuellen Kapitals, das erhalten bleibt, wenn die Mitarbeiter*innen abends nachhause gehen. Das Beziehungskapital fasst jene Faktoren zusammen, die eine Außenwirkung haben: Beziehungen zu Partner*innen, Kund*innen und Lieferant*innen, sowie das Image des Unternehmens in der Öffentlichkeit (vgl. Sveiby 1998, S. 29). Das Beziehungskapital ist Ausdruck der „menschlichen“ Schnittstellen des Unternehmens nach außen. Die Vernetzung mit Externen ist Voraussetzung für den Wissensaustausch und -erwerb. Aber auch für die Geschäftsprozesse selbst ist zunehmende Vernetzung notwendig. Die Prozessorganisation führt zur Auslagerung ganzer Prozesse an Zuliefer*innen und Dienstleister*innen. Neben den selbstverständlichen Schnittstellen zwischen den IT-Systemen entstehen durch die Kommunikation Beziehungen zwischen den beteiligten Mitarbeiter*innen. Die Qualität der Dienstleistung hängt maßgeblich von der Qualität dieser Beziehungen ab.
Wiederholungsaufgaben
- Beschreiben Sie die drei Wissensarten.
- Wie wirken sich die Besonderheiten der Wissensarten auf den Umgang mit Wissen aus?
- Wodurch unterscheiden sich Daten, Informationen und Wissen (geben Sie ein Beispiel)?
- Welche Ziele werden mit der Erstellung einer Wissensbilanz verfolgt?
- Nennen Sie die Bestandteile des intellektuellen Kapitals und beschreiben Sie diese.
- Sie wollen sich über die Entwicklung eines Unternehmens informieren und finden im Internet neben dem Jahresbericht auch eine Wissensbilanz. Was müssen sie bei der Interpretation der Wissensbilanz beachten?
Lösungen
'
Beschreiben Sie die drei Wissensarten
Explizites Wissen ist die Kenntnis von Fakten und Zusammenhängen. Es liegt in sprachlicher Form oder in Form von Abbildungen vor und kann mit geeigneten Trägermedien übertragen werden. Implizites Wissen umfasst die kognitiven und manuell-technischen Fähigkeiten einer Person. Es wird durch körperliche Erfahrung erlernt, und lässt sich nur bedingt durch Sprache oder andere Medien abbilden. Narratives Wissen beschreibt nicht nur sachliche Aspekte. Es berührt auch die Beziehungsebene und ist Ausdruck der kulturellen Normen und Werte.
Wie wirken sich die Besonderheiten der Wissensarten auf den Umgang mit Wissen aus?
Explizites Wissen kann in elektronischer Form gespeichert und verteilt werden, vorausgesetzt die Mitarbeiter*innen verfügen über die nötige Kompetenz für seine Abbildung in Texten und Abbildungen. Die erstellten Inhalte können mit Hilfe der IT-Systeme verwaltet werden. Implizites Wissen ist Ausdruck der Kompetenz der Mitarbeiter*innen. Es wird hauptsächlich in der direkten Interaktion weitergegeben. Voraussetzung dafür sind räumliche Maßnahmen, die Orte für die Begegnung und den Austausch schaffen. Ergänzt werden diese durch organisatorische Maßnahmen, die die Zusammenarbeit zwischen den Mitarbeiter*innen anregen. Narratives Wissen beschreibt Beziehungen und transportiert Normen und Werte. Kultur wird damit greifbar und kann durch Geschichten ausgedrückt werden. Diese regen die Emotionen an und wecken die Aufmerksamkeit der Zuhörer*innen.
Wodurch unterscheiden sich Daten, Informationen und Wissen (Geben Sie ein Beispiel)?
Daten beschreiben Fakten oder Ereignisse. Sie repräsentieren verschiedene Zustände, die durch Messung oder Wahrnehmung unterschieden werden können. Wenn der Unterschied zwischen zwei Zuständen für eine*n Beobachter*in relevant ist, werden die Übergänge zwischen diesen Zuständen für ihn*sie zur Information. Von Wissen spricht man, wenn Informationen aufgrund vergangener Erfahrungen bewertet werden können und jemanden zu einer adäquaten Handlung befähigen. Beispiel: Die Temperaturmessung setzt eine Skala und ein geeignetes Instrument voraus. Mit Hilfe des Thermometers kann eine Datenreihe über die Entwicklung der Meerestemperatur erstellt werden. Die verschiedenen Temperaturen erlangen für jede*n Beobachter*in andere Bedeutungen, etwa dass man ab einer bestimmten Temperatur schwimmen gehen kann ohne zu frieren. Für eine*n Meeresbiolog*in hat die Temperatur eine ganz andere Bedeutung. Durch die Verknüpfung dieser Information mit seinen*ihren Kenntnissen über die Bedürfnisse der Meeresbewohner*innen weiß er*sie, dass durch den Anstieg der Meerestemperatur ihr Lebensraum bedroht wird. Er*sie kann die Folgen der Erwärmung mit Modellen simulieren und voraussagen, welche Auswirkungen der Temperaturanstieg haben wird.
Welche Ziele werden mit der Erstellung einer Wissensbilanz verfolgt?
Die Wissensbilanz ist ein Instrument zur Messung der Entwicklung des intellektuellen Kapitals. Über die Zeit betrachtet, stellt sie die Wechselwirkungen zwischen dem intellektuellen Kapital und den Prozessen dar, die zu Veränderungen im Output führen. Die Verknüpfung mit den Zielen soll die strategische Steuerung des intellektuellen Kapitals erleichtern. Neben dem Mess- und Steueraspekt dient die Wissensbilanz der Darstellung des Unternehmens nach außen. Investor*innen brauchen zusätzlich zu den vergangenheitsorientierten Finanzdaten Informationen, aus denen sie auf die zukünftige Entwicklung eines Unternehmens schließen können. Nicht zuletzt soll die Wissensbilanz ein positives Bild des Unternehmens in der Öffentlichkeit erzeugen.
Nennen Sie die Bestandteile des intellektuellen Kapitals und beschreiben Sie diese.
Das intellektuelle Kapital setzt sich aus Humankapital, Strukturkapital und Beziehungskapital zusammen. Das Humankapital umfasst die Kompetenz der Mitarbeiter*innen und die Innovationskraft des Unternehmens. Das Strukturkapital repräsentiert die Unternehmenskultur sowie die Organisation, IT-Systeme, aber auch materialisiertes Wissen in Form von Patenten. Das Beziehungskapital beschreibt die Beziehungen eines Unternehmens nach außen und sein Image in der Öffentlichkeit. Das Beziehungskapital entscheidet damit darüber, welche Chancen ein Unternehmen wahrnehmen kann, Leistungen für den Markt zu entwickeln und erfolgreich anzubieten.
Sie wollen sich über die Entwicklung eines Unternehmens informieren und finden im Internet neben dem Jahresbericht auch eine Wissensbilanz. Was müssen sie bei der Interpretation der Wissensbilanz beachten?
Die Wissensbilanz wird von vielen Unternehmen als Instrument für die Öffentlichkeitsarbeit verwendet. Da es keine verbindlichen Vorschriften für die zu verwendenden Indikatoren gibt, werden nur jene Teile publiziert, die das Unternehmen in ein positives Licht rücken.
Wissensmanagement
Ziele der Lektion:
- Definition von Wissensmanagement
- Strategische Wissensmanagement-Ziele bestimmen
- Vorstellung der Wissensmanagement Prozesse
- Beitrag der IT-Systeme zum Wissensmanagement
Bibliotheken verwalten seit tausenden Jahren das Wissen vorangegangener Epochen und Bildungseinrichtungen engagieren sich in der Vermittlung des Wissens an die nachfolgenden Generationen. Trotz dieser langen Tradition der Verwaltung und Vermittlung von Wissen entstand Ende des vergangenen Jahrhunderts das Bedürfnis, Werkzeuge für den Umgang mit Wissen im unternehmerischen Kontext zu schaffen. Die verschiedenen Aspekte von Wissen wurden im vorangegangenen Abschnitt erläutert. An dieser Stelle ist daher der Begriff Management zu definieren: Management ist der zielgerichtete Einsatz von produktiven Kräften zum Zweck der betrieblichen Leistungserstellung (vgl. Lechner et al. 2008, S. 63). Die verschiedenen Managementaufgaben bilden einen Kreislauf, nach dessen Vollendung ein neuer Zyklus beginnt. Dieser Kreislauf reicht von der Zielsetzung über die Maßnahmenplanung zur Organisation und Überwachung, bzw. Kontrolle ihrer Durchführung. Der Zyklus tritt mit einer erneuten Zielsetzung in seine nächste Runde ein (vgl. Lechner et al. 2008, S. 65).
Mit Ausnahme von Organisationen im schulischen oder universitären Sektor, ist der Umgang mit Wissen ein Mittel zur Erreichung der Organisationsziele. Ob dabei gesellschaftliche Ziele verfolgt werden, oder ob eine Gewinnabsicht hinter der Zielsetzung steht, ist dabei nicht von Belang (vgl. Willke et al. 2001, S. 69). Für Wissensmanagement als Profession ist daher die normative Festlegung auf das ökonomische Prinzip zu treffen, nach dem ein optimales Verhältnis zwischen Mitteleinsatz und Ergebnis anzustreben ist (vgl. Lechner et al. 2008, S. 32). Ohne eine nähere Betrachtung konkreter Modelle lässt sich daraus bereits eine Zielsetzung für Wissensmanagement ableiten:
Wissensmanagement ist der effiziente, geplante und zielorientierte Umgang mit Wissen zur Unterstützung der organisationalen Leistungserstellung. Es umfasst alle Maßnahmen, die zur Erreichung der Wissensziele geplant und umgesetzt werden sowie die Kontrolle ihres Beitrags zur Zielerreichung. In den vorangegangenen Abschnitten wurden die verschiedenen Aspekte von Wissen behandelt, deren jeweilige Besonderheiten beim Management von Wissen berücksichtigt werden müssen. Es mag verlockend erscheinen, sich zunächst auf technische Aspekte zu konzentrieren, da diese leicht zu handhaben sind. Eine solche Verkürzung ist jedoch nicht zu empfehlen. Die alleinige Konzentration auf leicht realisierbare Ziele, wie beispielsweise die elektronische Verwaltung von explizitem Wissen in Form von Dokumenten bei gleichzeitiger Vernachlässigung anderer Aspekte von Wissen, wird die übergeordneten Unternehmensziele nicht optimal unterstützen. Nicht die Möglichkeiten der Technik, sondern die Unternehmensstrategie und die daraus abgeleitete Wissensmanagement Strategie setzen die Schwerpunkte für den Umgang mit Wissen. Die Strategie bestimmt damit über das Verhältnis von personengebundenem Wissen, in Strukturen und Prozessen abgebildetem Wissen und externalisiertem Wissen in Form von Daten und Information.
Wissensmanagementstrategien
Anhand der Ausführungen über Wissen wird deutlich, dass der Wissensbegriff vielschichtig ist. Je nach wissenschaftlicher Fachrichtung fällt die Definition von Wissen anders aus. Da Wissen den Gegenstand von Wissensmanagement darstellt, ist eine präzise Definition notwendig, wenn es um die Darstellung einzelner Maßnahmen oder ganzer Modelle geht. Die angestammten Professionen setzen ihre Schwerpunkte entweder bei den handelnden Akteur*innen, bei der Organisation, die deren Zusammenwirken durch Aufbau und Prozesse unterstützt, oder bei den genutzten Werkzeugen (vgl. Heisig 2005, S. 3). Liegt der Fokus beim Menschen, so geht es vorrangig um die Entwicklung und effiziente Nutzung seiner Fähigkeiten und Kompetenzen. Auch die Organisation als Ganzes kann lernen, indem sie aus den individuellen Beiträgen ihrer Mitglieder kollektive Intelligenz und ein kollektives Bewusstsein entwickelt. Beim Fokus auf die eingesetzten Werkzeuge steht der Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnik im Vordergrund (vgl. Willke et al. 2001, S. 39).
Aus diesen sehr gegensätzlichen Schwerpunkten folgt, dass Wissensmanagement ein Aufgabenbereich ist, der aus organisatorischer Sicht nicht einfach bei einer der bestehenden Disziplinen eingegliedert werden sollte. Wird Wissensmanagement beim Personalmanagement angesiedelt, fehlt der Blick für die technischen Möglichkeiten und Notwendigkeiten. Umgekehrt besitzen IT-Abteilungen nur selten das notwendige Know-how, um Maßnahmen im Bereich der Mitarbeiter- und Organisationsentwicklung umzusetzen. Wissensmanagement findet zwischen den Polen Mensch, Organisation und Technik statt und ist damit eine Querschnittsdisziplin, die sich keinem etablierten Unternehmensfachbereich allein zuordnen lässt. Würde Wissensmanagement einfach einem der angestammten Unternehmensbereiche übertragen werden, führt das unweigerlich dazu, dass die Schwerpunkte des eigenen Fachbereichs überbetont werden. Selbst wenn dadurch die unternehmerischen Wissensziele optimal umgesetzt werden sollten, so beruht die Erreichung dieses Ziels doch eher auf Zufall denn auf den Prinzipien guten Managements.
Wie sich die Ausrichtung von Wissensmanagement aus den übergeordneten Zielen und der Strategie ableiten lässt, wird anhand einer Untersuchung von Hansen et al. deutlich, die den Umgang mit Wissen bei Consulting Firmen untersucht haben. Diese waren die Vorreiter, was den Umgang mit Wissen nach dem ökonomischen Prinzip angeht. Das ist wenig verwunderlich angesichts der Tatsache, dass sie keine physischen Produkte, sondern wissensintensive Dienstleistungen verkaufen. Die Untersuchung ergab, dass alle untersuchten Unternehmen intensiven Gebrauch von IT-Systemen machten. Diesem Einsatz lagen jedoch zwei grundverschiedene Strategien zugrunde. Die Vertreter*innen der einen Fraktion versuchten das Wissen ihrer Mitarbeiter*innen zu dokumentieren und in IT-basierten Datenbeständen zu speichern. Am anderen Ende des Spektrums befanden sich Firmen, die IT-Systeme lediglich als Kommunikationsinstrument verwendeten. Wenn die Externalisierung des Wissens im Vordergrund steht, entspricht das der Kodifizierungsstrategie. Mit Hilfe der IT-Systeme wird Wissen in Datenbanken und Dokumentenverwaltungssystemen gespeichert und jenen Mitarbeiter*innen zugeführt, die es für die Erfüllung ihrer wissensintensiven, jedoch weitgehend standardisierten Aufgaben benötigen. Das Gegenteil zu dieser Strategie ist die Personalisierungsstrategie. Sie betont die individuelle Expertise, die zu Erbringung hoch individueller Lösungen benötigt wird. Diese Dienstleistungen bedingen regelmäßig die Schaffung von neuem Wissen, da sie nicht mittels vorhandener Standardlösungen umsetzbar sind (vgl. Hansen et al., S. 1–2).
Die Ausrichtung von Wissensmanagement hängt vom Geschäftsmodell eines Unternehmens ab. Geht es darum, ähnliche Lösungen mit gleichbleibender Wissensbasis immer wieder und wieder umzusetzen, kommt die Kodifizierungsstrategie zum Einsatz. Sie verhilft der Dienstleistung mit standardisierten Methoden und Dokumentenvorlagen zu einer gleichbleibenden Qualität. Verlangen die Kund*innen dagegen nach hoch individuellen, kreativen und neuen Lösungen, muss dafür in der Regel die Expertise verschiedenster Spezialist*innen kombiniert werden. Die Personalisierungsstrategie verlangt nach organisatorischen Maßnahmen, die eine Umgebung schaffen, in der sich Netzwerke zum Austausch von implizitem Wissen bilden können (vgl. Hansen et al., S. 4). Die folgende Abbildung zeigt die Abhängigkeit der Wissensmanagementstrategie vom Geschäftsmodell und die zugehörigen Personal- und IT-Strategien (Hansen et al., S. 3).
Wissensmanagementprozess
Die verschiedenen Wissensmanagement-Aktivitäten können anhand der Bausteine des Wissensmanagements von Probst et al. anschaulich beschrieben werden. Basierend auf einer Analyse der Wissensmanagementaktivitäten in mehreren Unternehmen wurden 6 Kernprozesse identifiziert. Diese wurden um die beiden Komponenten Wissensbewertung und Wissensziele ergänzt, um den Managementzyklus zu vollenden. Die untere Abbildung verdeutlicht das Zusammenwirken der einzelnen Bausteine und die besondere Rolle der Wissensziele und der Wissensbewertung (Probst et al. 2006, S. 32).
Wissensziele
Das Setzen von Zielen ist eine der grundlegendsten Aufgaben von Management, da sich der Erfolg oder Misserfolg nur an ihnen messen lässt. Ziele geben Orientierung und bestimmen, in welche Richtung die Anstrengungen der Mitarbeiter*innen einer Organisation gerichtet werden müssen (vgl. Probst et al. 2006, S. 37). Wissensziele stehen in einer Mittel-Zweck Relation zu den Unternehmenszielen. Wie diese können sie auf drei Ebenen gesetzt werden, die sich hinsichtlich Komplexität und Zeithorizont unterscheiden. Die normative Ebene bestimmt, in welchem Kontext sich Wissensmanagement abspielt. Sie bestimmt die Kultur des gesamten Unternehmens und damit auch die Wissenskultur. Die normativen Ziele müssen von der Unternehmensspitze getragen werden und glaubhaft sein. Nur dadurch werden sie von den Mitarbeiter*innen akzeptiert und können bei diesen die Bereitschaft erzeugen, auch die nachgelagerten strategischen und operativen Ziele zu verfolgen (vgl. Probst et al. 2006, S. 40–42).
Strategische Wissensziele werden aus den strategischen Unternehmenszielen abgeleitet. Sie dürfen nicht im Widerspruch zu den normativen Zielen stehen. Strategische Wissensziele geben vor, welches Wissen für die zukünftige Entwicklung des Unternehmens notwendig ist. Aus den strategischen Wissenszielen lässt sich ableiten, welche Fähigkeiten bei den Mitarbeiter*innen aufgebaut werden müssen, sie definieren die Entwicklung der Kernkompetenzen eines Unternehmens und geben der Organisation so Orientierung (vgl. Probst et al. 2006, S. 45–48). Neben dieser Projektion zukünftigen Bedarfs darf nicht übersehen werden, dass Wissen neue Möglichkeiten eröffnet und dem Unternehmen Impulse zu einer Neuorientierung geben kann. Durch die Ableitung operativer Wissensziele aus den strategischen Zielen können einzelne Wissensmanagementmaßnahmen geplant werden. Diese verankern Wissensmanagement in den operativen Prozessen einer Organisation und gleichen die operativen Wissensziele mit den operativen Zielen aus anderen Zielsystemen ab (vgl. Probst et al. 20062000, S. 52–54). Bereits bei der Definition der Wissensziele muss die Möglichkeit einer späteren Bewertung bedacht werden (vgl. Probst et al. 2006, S. 59).
Wissensidentifikation
Die Intransparenz hinsichtlich des vorhandenen Wissens ist für Organisationen aus verschiedenen Gründen ein Problem. Mit zunehmender Unternehmensgröße wird es für den*die einzelnen Mitarbeiter*in immer schwerer, die Fähigkeiten und Zuständigkeiten der anderen Mitarbeiter*innen und Abteilungen zu kennen. Dadurch entstehen Doppelgleisigkeiten, da jede Abteilung eigenständig nach einer Lösung sucht, die andere bereits gelöst haben. Die Unterstützung bei der Identifikation von Expert*innen und in der Organisation vorhandenen Lösungsmethoden trägt dazu bei, dieses Problem zu beseitigen und führt damit zu einem effizienteren Umgang mit diesem Wissen. Mangelnde Orientierung in den Informationsbeständen ist ein weiteres Problem, das durch zunehmende Größe entsteht. Die Informationstechnologie begünstigt die rasche Zunahme der Informationsmenge, nicht aber den raschen Zugang zu dieser Information. Darüber hinaus macht es die steigende Menge auch immer schwerer, zu einer raschen Entscheidung zu gelangen, da immer mehr Alternativen berücksichtigt werden müssen.
Die Wissensidentifikation strukturiert die Information zur besseren Übersichtlichkeit. Anhand eines Bewertungssystems definiert sie relevantes Wissen, wodurch die Informationsmenge reduziert wird, was die Entscheidungsvorgänge beschleunigt. Verbunden mit dieser Reduktion ist ein bewusster Verzicht auf jenes Wissen, das als nicht relevant definiert wird. Dieses Nicht-Wissen ist ein Risiko, das jedoch aufgrund des bewussten Abwägungsprozesses kalkulierbar ist und eine Konzentration auf das Wesentliche ermöglicht. Die Folge ist die Transparenz hinsichtlich der Risiken von Nicht-Wissen, sowie ein Überblick über das vorhandene Wissen. Transparenz bedeutet zu wissen, wo die Expert*innen sind, wie externes Wissen erworben werden kann, welche Best Practices zur Lösung von Problemen existieren, mit welchen Benchmarks die eigenen Leistungen gemessen werden können und schließlich einschätzen zu können, welche Gefahr von den vorhandenen Wissenslücken ausgeht (vgl. Probst et al. 2006, S. 63–65).
Wissenserwerb
Keine Organisation ist in der Lage, das gesamte benötigte Wissen aus eigener Kraft herzustellen. Dies gilt selbst für Forschungseinrichtungen, deren Aufgabe es ist, neues Wissen herzustellen. Umso mehr gilt das für Unternehmen, für die Wissensproduktion nur so weit notwendig ist, als sie die Voraussetzungen für die Produktion der Marktleistung darstellt. Jede Organisation ist gezwungen, Wissen aus externen Quellen zu erwerben. Der Erwerb expliziten Wissens kann durch Lizenzierung patentgeschützten Wissens erfolgen. Beim Erwerb von personengebundener Expertise gibt es einerseits die Möglichkeit, es in Form externer Expert*innen ins Unternehmen zu holen, indem es als Beratungsleistung erworben wird. Bei dieser Variante ist mit Akzeptanzproblemen zu rechnen, da das externe Wissen nicht mit den organisationsinternen Paradigmen kompatibel ist und von den Mitarbeiter*innen abgelehnt wird. Die Integration dieses Wissens durch Aufnahme neuer Mitarbeiter*innen sorgt für eine bessere Passung des Wissens mit den kulturellen Gegebenheiten der Organisation (vgl. Probst et al. 2006, S. 93–95).
Wissensentwicklung
Sowohl bei der Erstellung von Produkten und Leistungen als auch bei der Verbesserung der Leistungsprozesse benötigen Organisationen Wissen und Fähigkeiten. Ist dieses Wissen noch nicht vorhanden, steht das Unternehmen vor einer Make-or-buy-Entscheidung. Nur, wenn die interne Entwicklung günstiger ist als der Erwerb am Markt, ist eine Eigenentwicklung ökonomisch sinnvoll. Dabei ist jedoch zu bedenken, dass durch die Entwicklung im Unternehmen zusätzliches Wissen entsteht, beispielsweise über den Entwicklungsprozess selbst. Es kann daher aus strategischen Gründen angezeigt sein, Wissen trotz höherer Kosten im Unternehmen zu entwickeln. Bei vollkommen neuen Problemstellungen stellt sich die Frage meist nicht, da es am Markt nicht erworben werden kann. Entweder, weil es noch nicht existiert, oder weil es von Mitbewerber*innen entwickelt wurde, die ihren Wissensvorsprung nutzen wollen (vgl. Probst et al. 2006, S. 114). Die Eigenentwicklung hat auch noch andere Vorteile. Durch die Bearbeitung einer Problemstellung entsteht bei den Mitarbeiter*innen implizites Handlungswissen. Dieses kann nur auf dem Weg der Erfahrung gewonnen werden, es ließe sich nur zukaufen, indem man die qualifizierten Mitarbeiter*innen zusätzlich am Arbeitsmarkt einkauft. Die Entwicklung einer Lösung zu einer komplexen Problemstellung kann in der Regel nicht durch eine einzelne Person erfolgen. Nur durch die Arbeit im Team, bei der individuelle Fähigkeiten kombiniert werden, ist das möglich. Die Entwicklung von Wissen ist daher ein sozialer Prozess, bei dem implizites Wissen nicht nur beim Individuum entsteht, sondern auch auf kollektiver Ebene (vgl. Probst et al. 2006, S. 123–126).
Wissens(ver)teilung
Wenn das relevante Wissen im Unternehmen identifiziert, entwickelt oder extern erworben wurde, kann es in der Organisation verteilt werden. Nicht jeder muss Zugang zum gesamten Wissen haben. Es nach dem Gießkannenprinzip gleichmäßig unter den Mitarbeiter*innen zu verbreiten wäre kontraproduktiv. Aus Datenschutzgründen oder wegen des Wettbewerbs kann es notwendig sein, sensible oder geschäftskritische Informationen nur einem kleinen Kreis von Mitarbeiter*innen zugänglich zu machen. Außerdem würde ein Übermaß an Informationen die Mitarbeiter*innen am effektiven Handeln behindern, da sie Zeit aufwenden müssten, die für sie relevanten Informationen herauszufiltern. Daher ist vor der Verteilung zu klären, wo welches Wissen benötigt wird und wie es aufbereitet werden muss, damit es den Anforderungen der Zielgruppe gerecht wird (vgl. Probst et al. 2006, S. 141–148). Für die Verteilung von Information ist daher ein Berechtigungssystem zu etablieren, das den Zugang für die unterschiedlichen Rollenträger*innen regelt. Bei der Aufbereitung der Information ist auf die Besonderheiten der menschlichen Wahrnehmung Rücksicht zu nehmen, damit der Lernprozess nicht behindert wird. Lernen wird durch die Aktivierung mehrerer Sinne gleichzeitig begünstigt. Wird die gesprochene Sprache durch Bilder und Animationen oder Video ergänzt, wird das visuelle und auditive Wahrnehmen gefordert. Durch Übungen wird die Lernerfahrung im wahrsten Sinne des Wortes greifbar, indem auch die taktile Wahrnehmung aktiviert wird.
Die bisher angesprochenen Aspekte sind mit technischen und pädagogischen Mitteln zu realisieren. Die Lösungswege sind etabliert und lange erprobt, ihr Einsatz ist damit nur eine Frage des finanziellen Aufwandes. Herausfordernd ist dagegen der kulturelle Aspekt, der bei allen Maßnahmen im Wissensmanagement berücksichtigt werden muss. Der Austausch von Wissen lässt sich nicht erzwingen und entzieht sich weitgehend einer direkten Steuerung. Wissensteilung kann daher nur durch Kontextsteuerung beeinflusst werden. Die in einem Unternehmen vorherrschende Kultur bestimmt die Einstellung der Mitarbeiter*innen durch ihre Normen und Werte. Beeinflussen lässt sich die Kultur beispielsweise durch die organisatorische Struktur oder durch räumliche Maßnahmen, durch die direkte Kommunikation gefördert wird (vgl. Probst et al. 2006, S. 149–162).
Auch die Personalentwicklung hat großen Einfluss auf die Motivation und Einstellung der Mitarbeiter*innen und kann damit die Unternehmenskultur ganz wesentlich prägen. Einerseits durch die vermittelten Inhalte, aber auch durch die verwendeten Methoden. Durch Train-the-Trainer Konzepte können neue Informationen in sehr kurzer Zeit in der ganzen Organisation verbreitet und durch die intensivere Auseinandersetzung der Mitarbeiter*innen mit den Themen tief verankert werden. In die gleiche Richtung wirken Job Rotation, sowie Teamarbeit, Qualitätszirkel, Lernstätten und andere Formen sozialen Lernens. Sie fördern das Verständnis des*der Einzelnen für die verschiedenen Aufgabenfelder der anderen Organisationsteile und tragen zur Vernetzung der Mitarbeiter*innen aus den verschiedenen Bereichen bei. Durch das Verständnis für die Zusammenhänge werden die vom Unternehmen verfolgten Ziele für den*die einzelne*n Mitarbeiter*in klarer. Durch den verstärkten Zusammenhalt wird es wahrscheinlicher, dass alle Mitarbeiter*innen ihre Anstrengungen in der gleichen Richtung unternehmen. Das Wissensmanagementziel ist es, die Barrieren zwischen den einzelnen Bereichen zu beseitigen, den Transfer von Wissen anzuregen und die unvernetzten Wissensinseln miteinander zu verbinden (vgl. Probst et al. 2006, S. 153). Sind die Voraussetzungen für einen erfolgreichen Austausch gegeben, können Werkzeuge wie Communities-of-Practice und Best-Practice-Transfer dazu verwendet werden, das Erfahrungswissen im Unternehmen zu verteilen.
Wissensnutzung
Die effektive und effiziente Nutzung des Wissens in den Geschäftsprozessen ist das eigentliche Ziel von Wissensmanagement. Die Bereitstellung der Infrastruktur reicht jedoch alleine nicht aus, um die Nutzung sicherzustellen. Die angebotenen Werkzeuge und Informationen müssen die Bedürfnisse der Nutzer*innen berücksichtigen (vgl. Probst et al. 2006, S. 175). Für die Systeme, wie auch für die zu verteilenden Informationen, gilt, dass sie den Kriterien Anschlussfähigkeit, Zeitgerechtigkeit und Einfachheit genügen müssen. Diese Kriterien müssen bei der Gestaltung von technischer, räumlicher und organisatorischer Infrastruktur berücksichtigt werden. Die räumliche Gestaltung des Umfeldes und jene der Arbeitsplätze kann Kommunikation zwischen den Mitarbeiter*innen fördern oder verhindern. Wenn sie die Kommunikation begünstigt, ist sie für den Austausch und die Nutzung von Wissen förderlich. Die Verfügbarkeit von Ansprechpartner*innen erhöht die Wahrscheinlichkeit dafür, dass Wissen mit anderen Personen getauscht und genutzt wird. Die Kriterien gelten auch auf individueller Ebene für die zur Verfügung gestellten Informationsobjekte, deren Gestaltung und Umfang sich an den Bedürfnissen und kognitiven Fähigkeiten der Zielgruppe orientieren muss. Die Präsentation der Inhalte soll den*die Nutzer*in bestmöglich unterstützen und keine zusätzliche Belastung darstellen (vgl. Probst et al. 2006, S. 178–184).
Die Wissensnutzung wird auch durch psychologische Faktoren beeinflusst. Eingefahrene Verhaltensweisen gepaart mit Betriebsblindheit verhindern, dass relevantes Wissen aus externen Quellen nicht identifiziert wird. Selbst wenn externes Wissen als solches wahrgenommen wird, verhindert mangelnde Akzeptanz oft seine Nutzung. Gründe dafür sind die Überschätzung der eigenen Fähigkeiten und die Angst vor dem Verlust des eigenen Expertenstatus. Diese weichen Faktoren zu beeinflussen, ist eine wesentlich anspruchsvollere Aufgabe als führen mit harten Zielen wie Kosten, Gewinnspanne, Umsatz usw. Die Führung ist gefordert eine Unternehmenskultur zu schaffen, die Werte wie Offenheit, Vertrauen, Lern- und Veränderungsbereitschaft, Neugierde und Fehlerfreundlichkeit fördert (vgl. Probst et al. 2006, S. 177–178).
Wissensbewahrung
Pensionierungen, großflächige Kündigungen aus wirtschaftlichen Gründen und natürliche Abgänge der Mitarbeiter*innen können die Wissensbasis eines Unternehmens gefährden. Die Sicherung des Erfahrungswissens ist die Aufgabe des Bausteins Wissensbewahrung. Wie bei der Wissensidentifikation muss auch in diesem Baustein eine Bewertung des vorhandenen Wissens durchgeführt werden. Diese ermöglicht eine Auswahl von relevantem Wissen bei gleichzeitigem, bewusstem Verzicht auf jenes Wissen, das in den Geschäftsprozessen nicht benötigt wird (vgl. Probst et al. 2006, S. 192–193). Nachdem die Auswahlentscheidung getroffen wurde, muss das Wissen in der Organisation verankert, bzw. gespeichert werden. Je nach Wissensart erfolgt die Speicherung auf individueller, kollektiver oder elektronischer Basis. Auf individueller Ebene muss eher von einem Verankern gesprochen werden. Wenn Wissensträger*innen das Unternehmen verlassen, ist damit unweigerlich der Verlust von Wissen verbunden. Maßnahmen zur Mitarbeiterbindung sollen den Abgang verhindern und die Mitarbeiter*innen im Unternehmen verankern.
Auf der Ebene von Gruppen gibt es das Phänomen des kollektiven Gedächtnisses. Gemeinsame Erfahrungen, in denen jede*r Mitarbeiter*in durch seine*ihre individuellen Stärken zu einer Teamleistung beiträgt, tragen zur Bildung von Prozesswissen bei. Dieses Wissen ist im Gedächtnis der Gruppe verankert, aber selten dokumentiert. Die qualitativen, handlungsleitenden Aspekte dieses kollektiven Wissens lassen sich auch nur bedingt in Prozessdiagrammen abbilden. Die Erfahrungen der Gruppe tragen zur Ausbildung einer eigenen Subkultur mit ganz eigenen Werten bei. Selbst Alltagsbegriffe können im Kontext der Gruppe eine ganz eigene Bedeutung entwickeln, die sich dem*der Außenstehenden nicht erschließt. Ein Team handelt kompetent, weil es keiner langwierigen Aushandlungsprozesse bedarf, um die Einzelaktivitäten zu koordinieren. Diese Kompetenz zu bewahren, heißt, die Gruppe als Ganzes zu bewahren. Das explizite Wissen wird in Informationsobjekten festgehalten. Liegen diese in elektronischer Form vor, können sie mit Hilfe von Informationssystemen verwaltet werden. Diese unterstützen die Benutzer*innen beim Erfassen, Speichern, Überarbeiten, bei der gemeinsamen Bearbeitung und bei der Ablage der Dokumente. Durch die Anreicherung mit Metadaten können die Informationsobjekte klassifiziert und in eine Struktur gebracht werden. Beides erleichtert ihre spätere Nutzung, weil die Inhalte nutzergerecht präsentiert und durchsuchbar gemacht werden können (vgl. Probst et al. 2006, S. 198–206).
Mit dem Ziel der Wissensnutzung vor Augen, ist die Sicherung der Aktualität der nächste wichtige Schritt. Mitarbeiter*innen erneuern ihr implizites Wissen laufend während des Arbeitsprozesses und nehmen an Personalentwicklungsmaßnahmen teil, um sich für neue Aufgaben zu qualifizieren. Dennoch kann es passieren, dass bereits erlernte Fähigkeiten verloren gehen, weil diese vergessen werden. Ist eine regelmäßige Auffrischung durch die Anwendung des Wissens nicht möglich, muss das Wissen durch Trainings aktiviert werden. Analog dazu müssen auch die elektronischen Informationsspeicher regelmäßig aktualisiert werden. Veraltete Informationen müssen revidiert oder ausgeschieden werden, neue Entwicklungen müssen in die Bestände aufgenommen werden (vgl. Probst et al. 2006, S. 207–209). Anhand dieser Überlegungen zeigt sich erneut, dass Wissensmanagement keine eigenständige Disziplin ist, sondern quer durch die Fachbereiche reicht, allen voran IT und HR.
Wissensbewertung
Der letzte Baustein ist die Wissensbewertung. Sie komplettiert den Managementkreislauf durch die Messung der Ergebnisse und durch ihren Vergleich mit den Wissenszielen. Wissen ist kontextgebunden und schwer objektivierbar. Da der Erfolg von Wissensmanagement nur anhand des Vergleichs von Zielen und Ergebnissen festgestellt werden kann, ist es notwendig Wissensziele zu quantifizieren (vgl. Probst et al. 2006, S. 213–214). Zur Bewertung des Wissens wurden Werkzeuge geschaffen, die das intellektuelle Kapital messen und darstellen konnten. Stärker strategisch ausgerichtet sind die Balanced Scorecard oder Wissensbilanzen, deren Erstellung seit dem UG 2002 für österreichische Universitäten verpflichtend ist.
Schlussfolgerungen
Die meisten Wissensmanagement-Modelle definieren Kernaktivitäten für den Umgang mit Wissen. Sie unterscheiden sich hinsichtlich der Anzahl und der Definition der Aktivitäten. Beispielsweise kommt das Fraunhofer Referenzmodell mit den vier Aktivitäten Wissen erzeugen, Wissen speichern, Wissen verteilen und Wissen nutzen aus. Diese Kernaktivitäten wurden mittels Umfragen erhoben und haben ihren Ursprung in der unternehmerischen Praxis (vgl. Mertins et al. 2003, S. 5–9). Die Bausteine des Wissensmanagements erweitern die Kernaktivitäten des Wissensmanagementprozesses um Wissensziele und Wissensbewertung. Damit vermitteln sie anschaulich, welche Aspekte bei der Implementierung von Wissensmanagement berücksichtigt werden müssen. Probst et al. orientieren sich ebenfalls an Fallstudien und verzichten weitgehend auf eine theoretische Fundierung ihres Modells. Aus diesem Grund wurde das Modell von Autor*innen kritisiert, die sich mit Wissensmanagement auf eine stärker wissenschaftlich orientierte Weise auseinandersetzten (vgl. Willke et al. 2001, S. 82). Dazu ist allerdings anzumerken, dass die Autor*innen der Bausteine des Wissensmanagements bewusst auf eine wissenschaftliche Auseinandersetzung verzichtet haben. Ihr Ziel war es, ein Modell für Wissensmanagement zu erschaffen, das für die praktische Anwendung geeignet ist.
IT-Systeme im Wissensmanagement
Obwohl es ein Fehler wäre, die Einführung von Wissensmanagement mit der Einführung eines IT-Systems, wie etwa eines Content-Management Systems, gleichzusetzen, ist der effiziente Umgang mit Wissen ohne die Unterstützung durch IT-Systeme undenkbar. Die Art des Wissens ist ausschlaggebend dafür, welche Werkzeuge auf der Systemebene benötigt werden. Zwar sind Informationssysteme vorwiegend für die Verarbeitung von Daten und Informationen prädestiniert, also zum Umgang mit explizitem Wissen. Ihr Einsatz ist aber auch für einen effizienten Austausch des impliziten Wissens erforderlich, beispielsweise zur Terminkoordination und Verwaltung der Ressourcen, oder durch Medien-gestützte Kommunikation, die physische Treffen zunehmend ersetzt. Dieser Aspekt wird durch Community-Management-Systeme, Groupware, Workflow-Management- Systeme, Instant Messaging, Screen Sharing und Video Conferencing-Systeme abgedeckt.
Die Verwaltung und gemeinsame Bearbeitung der Inhalte wird durch Dokumentenmanagement und Content-Management- Systeme ermöglicht, die durch Werkzeuge zur Suche nach Informationen und Analyse der Daten ergänzt werden. Enterprise- Content-Management-Systeme integrieren semantische Techniken in die Suche und Navigation. Die Informationen werden mit Metadaten angereichert und mit Hilfe von Ontologien miteinander verknüpft. Eine Suche im Internet fördert Seiten zutage, auf denen die Suchbegriffe vorkommen, und priorisiert die Ergebnisse nach dem Grad ihrer Verlinkung mit anderen Seiten im Web. Die semantische Suche kennt die Konzepte, die hinter den Suchbegriffen stehen. Eine Suche nach dem Begriff Käufer*in würde auch die Begriffe Kund*in und Abnehmer*in einschließen. Die Navigation kann diese semantisch verwandten Begriffe in Form einer Tag Cloud anbieten und beispielsweise auch Ergebnisse von verwandten Konzepten wie Markt oder Absatz anbieten (vgl. Blumauer, Pellegrini 2010, S. 185–186). Die Anreicherung der Inhalte ermöglicht es auch, sie weiteren Verwendungsmöglichkeiten zuzuführen. Sie können auf der eigenen Webseite angeboten werden, um sie für die Besucher*innen attraktiver zu machen, oder als Content für kommerzielle Portale vermarktet werden. Die Medienindustrie führt ihre Produkte einer Zweitverwertung zu, indem sie ihre elektronischen Bestände mit Metadaten anreichert und auf elektronischem Weg vertreibt. Wegen der hohen Automatisierbarkeit kann das mit geringen zusätzlichen Kosten realisiert werden, wodurch es erst ökonomisch sinnvoll wird (vgl. Blumauer, Pellegrini 2010, S. 192–193).
Die Kompetenzen der Mitarbeiter*innen werden in Kompetenzverzeichnissen erfasst, die meist in die Personalverwaltungsanwendungen integriert sind. E-Learning-Anwendungen unterstützen die Personalentwicklung und ermöglichen gleichzeitig die elektronisch gestützte Bewertung der Mitarbeiterkompetenz. Yellow Pages machen die Kompetenz für jede*n Mitarbeiter*in im Unternehmen sichtbar und begünstigen so den direkten Wissensaustausch. Intranets und Portale integrieren alle diese Funktionen und bilden den Ausgangspunkt für die tägliche Aufgabenerfüllung. Damit werden den Nutzern der Systeme ein einheitlicher Zugang und eine einheitliche Navigation angeboten, was die Akzeptanz und die Nutzungsintensität erhöht (vgl. Probst et al. 2006, S. 154–160; Riempp 2004, S. 88–90; North 2005, S. 298–300).
Wissensmanagement-Suiten wie etwa Opentext (vgl. Opentext), Hyperwave (vgl. Hyperwave) oder Content.Node (vgl. Content.Node) fassen die oben angeführten Funktionen in einem System zusammen. Das hat den Vorteil, dass die Verwaltung aller Funktionen mit einer einheitlichen Administrationsoberfläche erfolgt. Durch die Integration der Funktionen in Standardlösungen der großen Hersteller*innen wird Wissensmanagement in den Geschäftsprozessen verankert. Eine Wissensmanagement-Suite hat darüber hinaus auch den Vorteil, dass die Daten nicht mehr extra konsolidiert werden müssen, da sie in einer durchgängigen logischen Struktur abgelegt werden. Erfahrungsberichte in der aktuellen Literatur zeigen allerdings, dass viele Wissensmanagement-Projekte ohne den Einsatz solcher Suiten realisiert werden. Das Ziel bei der Implementierung eines neuen Systems ist meist die Lösung eines punktuellen Problems. Während Strategie, Prozesse und die kulturellen Aspekte im Gesamtzusammenhang betrachtet werden, beschränkt sich der Einsatz der Systeme vielfach auf punktuelle Lösungen wie die Einführung eines Wikis oder von Yellow Pages (vgl. Pircher 2010). Auf diese Weise entstandene Insellösungen können zum Problem werden, wenn die Daten der verschiedenen Systeme zusammengeführt werden sollen. Gibt es keine gemeinsame logische Struktur und existieren keine Mappings für Metadaten, müssen diese nachträglich hergestellt werden. Der damit verbundene Zeitaufwand ist in der Regel größer, weil die ursprünglichen Projektmitarbeiter*innen nicht mehr zur Verfügung stehen, oder sie sich erst wieder in das Thema einarbeiten müssen. Es ist daher empfehlenswert, Wissensmanagement-Systeme langfristig zu planen, aufeinander abzustimmen und bereits bei der Implementierung die notwendigen Schnittstellen für die Integration zu schaffen.
Wiederholungsaufgaben
- Charakterisieren Sie die Personalisierungsstrategie (Kodifizierungsstrategie) nach ökonomischen Gesichtspunkten und beschreiben Sie die Folgen für die Wissensmanagement-, HR- und IT-Strategie.
- Beschreiben Sie die Bausteine des Wissensmanagements nach Probst in Stichworten.
- Beschreiben Sie gängige IT-Systeme und ihre Aufgaben im Wissensmanagement.
Lösungen
Charakterisieren Sie die Personalisierungsstrategie (Kodifizierungsstrategie) nach ökonomischen Gesichtspunkten und beschreiben Sie die Folgen für die Wissensmanagement-, HR- und IT-Strategie.
Die Kodifizierungsstrategie setzt auf standardisierte Massenproduktion. Das dafür notwendige Wissen wird einmalig entwickelt und anschließend vielfach wiederverwendet. Die Standardisierung spart Kosten und ermöglicht es, Leistungen mit wenig Aufwand und gleichbleibender Qualität zu erbringen. Wissensmanagement unterstützt die Kodifizierung durch Instrumente zur Erstellung, Speicherung und einfachen Nutzung des externalisierten Wissens. Content-Management-Systeme unterstützen den Anwender*innen dabei und erschließen die verfügbare Information durch Navigationsstrukturen und Suchmöglichkeiten. Das Personalmanagement muss die Mitarbeiter*innen im effizienten Umgang mit den Informationssystemen unterweisen. Das Recruiting muss Mitarbeiter*innen finden, die effizient mit Informationen umgehen und diese nach vorgegebenen Methoden zu Lösungen kombinieren. Die Anreizsysteme müssen die schriftliche Dokumentation und deren Speicherung in den Informationssystemen belohnen.
Das Ziel der Personalisierungsstrategie ist die Erstellung einer hoch spezialisierten, individuellen Lösung für eine*n einzelne*n Auftraggeber*in. Das für die Lösung notwendige Wissen muss erst noch entwickelt werden, was eine gewisse Kreativität voraussetzt. Möglich wird dies durch den Einsatz hochrangiger Expert*innen verschiedener Fachbereiche. Die ökonomische Logik hinter der Personalisierung ist die Erzielung einer hohen Marge. Wissensmanagement muss den direkten Austausch zwischen den Mitarbeiter*innen durch die Bildung von Netzwerken ermöglichen. Der direkte Wissensaustausch und die gemeinsame Nutzung werden durch Anreizsysteme gefördert und durch organisatorische Maßnahmen abgesichert. Bewerber*innen müssen analytische Fähigkeiten besitzen, sowie schöpferischen Willen und Mut zur Gestaltung neuartiger Lösungen.
Beschreiben Sie die Bausteine des Wissensmanagement nach Probst in Stichworten
Der Wissensmanagement Prozess beginnt mit der Ableitung von Wissenszielen aus den Unternehmenszielen. Bei der Formulierung der Ziele ist zu beachten, dass diese messbar sein müssen, andernfalls ist ihre Erreichung nicht sicher festzustellen.
Die Wissensidentifikation macht das in der Organisation verteilte Wissen sichtbar. Sie ermöglicht dadurch einen Überblick über das im Unternehmen vorhandene Wissen, aber gleichermaßen auch über das fehlende Wissen.
Jedes Unternehmen muss Wissen aus externen Quellen erwerben, da nicht alles benötigte Wissen selber entwickelt werden kann. Der Erwerb schließt Informationsobjekte, Lizenzen, Methoden und Verfahren, Beratungsleistungen, aber auch Kompetenz in Form neuer Mitarbeiter*innen mit ein.
Manches Wissen ist zu stark auf die Anforderungen des jeweiligen Unternehmens zugeschnitten, als dass es am Markt erworben werden könnte. Dieses Wissen muss im Unternehmen entwickelt werden. Die Eigenentwicklung hat den zusätzlichen Nutzen, dass Wissen über den Entwicklungsprozess selbst entsteht.
Die Wissensverteilung versorgt die Mitarbeiter*innen mit den für den Arbeitsprozess benötigten Informationen. Die Präsentation und der Umfang der angebotenen Inhalte ist zielgruppengerecht aufzubereiten, um den Aufwand für die kognitive Verarbeitung zu minimieren. Wissensteilung beruht auf Freiwilligkeit. Die Bereitschaft dazu muss durch das Führungssystem mit Anreizen, organisatorischer Gestaltung und kulturbildenden Maßnahmen gefördert werden.
Die Wissensnutzung ist das oberste Ziel im Wissensmanagement. Der Zugang zum Wissen muss einfach und schnell sein. Dies wird durch kurze Kommunikationswege und die Integration der Wissensmanagement-Werkzeuge in die Systeme für die Abwicklung der Geschäftsprozesse erreicht. Die Nutzung fremden Wissens wird durch psychologische Barrieren gefährdet, die durch die Gestaltung der Unternehmenskultur überwunden werden müssen.
Die Wissensbewahrung muss das Wissen im Unternehmen verankern. Durch Mitarbeiterbindung bleiben dem Unternehmen das Prozesswissen ganzer Teams und die Kompetenz der Mitarbeiter*innen erhalten. Damit Wissen seinen Wert behält, muss es laufend aktualisiert werden. IT-Systeme speichern Daten und ermöglichen die Planung ihrer Aktualisierung und Archivierung mittels Wiedervorlageterminen.
Die Wissensbewertung beschließt den Managementkreislauf, indem sie die Ergebnisse misst und nach dem Grad der Zielerreichung bewertet. Auf der Grundlage des Status Quo können neue Wissensziele formuliert werden.
Beschreiben Sie gängige IT-Systeme und ihre Aufgaben im Wissensmanagement.
Teams nutzen Groupware zur Koordination, Planung und das Tracking ihrer Aufgaben. Bei ihrer Arbeit entstehen elektronische Dokumente, die sie in Content-Management-Systemen speichern. Diese unterstützen den Arbeitsprozess durch Berechtigungen, Versionierung, Indizierung und Suche, Workflows und Benachrichtigungen über Aktualisierungs- und Archivierungstermine. Darüber hinaus ermöglichen Enterprise-Content-Management-Systeme die Anreicherung der Dokumente mit Metadaten, die semantische Suche und Navigation, sowie die Extraktion und Aufbereitung der Daten für angeschlossene Systeme. E-Learning-Systeme unterstützen die Personalarbeit bei der Kompetenzentwicklung der Mitarbeiter. Die Kompetenzen und Kontaktinformationen werden in Verzeichnissen zusammengeführt und im Intranet des Unternehmens publiziert. Das erleichtert die Suche nach Ansprechpartner*innen, die mit Hilfe von Kommunikationsmitteln wie E-Mail und Instant-Messaging kontaktiert werden. Die weitere Zusammenarbeit erfolgt über Foren, Wikis, Video Conferencing und Screen Sharing.
Unternehmenskultur
Ziele der Lektion:
- Definition von Unternehmenskultur
- Vorstellung eines Modells zur Kulturanalyse
- Diskussion der Auswirkungen von Kultur auf Wissensmanagement
Die Unternehmenskultur bildet den Kontext für den Umgang mit Wissen und damit auch für alle Maßnahmen, die im Rahmen von Wissensmanagement gesetzt werden. Unternehmenskultur ist ein emergentes Phänomen, das sich einer direkten Steuerung entzieht, aber alle Bereiche einer Organisation beeinflusst. Die betriebswirtschaftliche Literatur untersucht seit Jahren das Phänomen Unternehmenskultur. Die Unternehmenskultur ist einerseits Ausdruck der vorhandenen Wertvorstellungen, Normen und Verhaltensmuster und wirkt andererseits selbst auf diese zurück. Kultur entsteht nicht im luftleeren Raum, sie ist ein soziales Phänomen und Ausdruck gemeinsamer Erfahrungen. Sie bestimmt das Denken und die Wahrnehmungen der Mitglieder einer sozialen Gruppe (vgl. Schein 2006, S. 36). Damit bildet sie den Rahmen für die Zusammenarbeit von Menschen in Organisationen. Kultur ermöglicht es den Mitarbeiter*innen, Annahmen über richtiges und falsches Verhalten zu treffen und ihre Handlungen danach auszurichten (vgl. Schein 2006, S. 39). Im folgenden Teil wird Unternehmenskultur anhand des Drei-Ebenen Modells von Schein dargestellt. Als Unternehmensberater orientiert er sich an der unternehmerischen Praxis und betont, dass Kultur so lange funktional ist, als sie zum Erfolg im primären Tätigkeitsbereich eines Unternehmens beiträgt. Richtig oder falsch wird im Kontext der Unternehmenskultur also dadurch bestimmt, ob sie dazu beiträgt, dass das Unternehmen wirtschaftlich erfolgreich ist (vgl. Schein 2006, S. 174).
Drei-Ebenen-Modell nach Schein
Kultur entsteht in Gruppen, deren Größe von kleinen Teams bis hin zu multinationalen Organisationen reichen kann. In diesen Gruppen müssen gemeinsame Erfahrungen und Traditionen vorhanden sein, die die Grundlage für die gemeinsame Kultur bilden (vgl. Schein 2006, S. 29). Kultur wirkt auf drei verschiedenen Ebenen, sie reicht von der sichtbaren Manifestation in Artefakten über die ausgesprochenen Werte bis hin zu den unsichtbaren, unausgesprochenen Annahmen. Das Zusammenwirken dieser Ebenen zeigt die folgende Abbildung(vgl. Schein 2006, S. 31).
Die oberste Ebene der Unternehmenskultur bilden die Artefakte, also alles, was man erleben, also sehen, hören oder spüren kann. Dazu zählen einerseits unbelebte Dinge wie Architektur, Kunstgegenstände und Einrichtung. Andererseits auch das Verhalten der Mitarbeiter*innen gegenüber Außenstehenden und untereinander (vgl. Schein 2006, S. S32). Grundlegende Überzeugungen und Werte werden oft in Form von Visionen und Leitbildern festgehalten und öffentlich bekundet. Die Werte können im Gegensatz zu den sichtbaren Artefakten stehen, etwa wenn Teamarbeit propagiert wird, die Belohnungssysteme aber auf individueller Leistung beruhen (vgl. Schein 2006, S. 32–33). Grundlegende gemeinsame Annahmen werden in einem gemeinsamen Lernprozess gebildet, in dem sie sich als wirksam und erfolgreich erwiesen haben. Diese Annahmen werden so weit verinnerlicht, dass sie unbewusst wirken, deswegen auch nicht artikuliert werden und für Außenstehende nicht direkt erkennbar sind (vgl. Schein 2006, S. 34–35). Wenn es gelingt, die unausgesprochenen Annahmen zu erschließen, können mit ihrer Hilfe die Diskrepanzen zwischen den öffentlich bekundeten Werten und den sichtbaren Artefakten einer Unternehmung erklärt werden (vgl. Schein 2006, S. 92).
Kultur ist der Ausdruck der gemeinsamen Erfahrungen einer Gruppe, sie bestimmt das Denken und die Wahrnehmungen ihrer Mitglieder (vgl. Schein 2006, S. 36). Kultur ermöglicht es den Mitarbeiter*innen, Annahmen über richtiges und falsches Verhalten zu treffen und ihre Handlungen danach auszurichten (vgl. Schein 2006, S. 39). Der positive Beitrag der Unternehmenskultur liegt in dem Umstand begründet, dass sie stabilisierend wirkt, indem sie Unsicherheiten nimmt und das Leben berechenbar macht. Die stabilisierende Wirkung hat jedoch zur Folge, dass sich Veränderungen nur schwer durchsetzen lassen (vgl. Schein 2006, S. 41). Veränderungen der Unternehmenskultur sind aufwendig und können nur in kleinen Schritten erfolgen, der gesamte Veränderungsprozess ist nur bedingt steuerbar (vgl. Schreyögg 2008, S. 481–483). So weist etwa Schein darauf hin, dass der Widerstand gegen Veränderungen in den Ängsten der Mitarbeiter*innen begründet ist (vgl. Schein 2006, S. 115). Veränderungen müssen daher immer vor dem Hintergrund der vorherrschenden Kultur geplant werden. Steht diese im Widerspruch zu den Zielen der Veränderung, werden die Maßnahmen nicht greifen. Der damit verbundene Verlust finanzieller Ressourcen sollte auch Skeptiker dazu bewegen, sich mit der Unternehmenskultur auseinanderzusetzen.
Wissenskultur
Kultur bestimmt die Wahrnehmung, reflektiert und beeinflusst die Werte, die in einem Unternehmen vorherrschen. Dadurch bestimmt sie auch darüber, was wichtig und relevant ist, welches Wissen also wertvoll ist und im Zentrum der Aufmerksamkeit steht (vgl. De Long, Fahey 2000, S. 116). Sollberger definiert Wissenskultur folgendermaßen:
„Die Wissenskultur ist Teil der Unternehmenskultur und umfasst die Gesamtheit der Normen und Werte in einer Unternehmung, die die Denk- und Verhaltensweisen der Unternehmensmitglieder im täglichen Umgang mit Wissen prägen. Werte der Wissenskultur sind Vertrauen, Zusammenarbeit, Offenheit, wahrgenommene Autonomie, Lernbereitschaft und Fürsorge.“ (Sollberger 2006, S. 119)
Wie Wissen in einem Unternehmen geschaffen, verteilt und genutzt wird, ist geprägt durch die Einstellung und das Verhalten seiner Mitarbeiter*innen und damit Folge der im Unternehmen vorhandenen Wissenskultur (vgl. Bohinc 2003, S. 374; Sollberger 2006, S. 110–111). Kultur beeinflusst die Wahrnehmung, indem sie die Auffassung darüber, was wichtig und relevant ist, prägt. Damit reguliert sie, welches Wissen wertvoll ist und im Zentrum der Aufmerksamkeit steht (vgl. De Long, Fahey 2000, S. 116). Die Einstellung der Mitarbeiter*innen und das Engagement, mit dem sie am Arbeitsprozess und im speziellen an Wissensmanagement-Prozessen teilnehmen, ist von den Werten der Unternehmenskultur abhängig. Als Ergebnis zahlreicher Studien und Untersuchungen zu den Merkmalen einer für Wissensmanagement förderlichen Kultur haben sich die folgenden Faktoren herauskristallisiert (vgl. Sollberger 2006, S. 120–128):
- Vertrauen: Erst durch gegenseitiges Vertrauen wird der Wissensaustausch zwischen Individuen ermöglicht. Es ist notwendig für beide beteiligten Parteien. Der*diejenige, der*die sein*ihr Wissen preisgibt, muss sich darauf verlassen, dass er*sie dadurch keinen Schaden erleiden wird. Der*die Wissenssuchende muss darauf vertrauen, dass die erhaltenen Informationen richtig und wahr sind. Mangels eigener Kompetenz ist eine Bewertung für ihn*sie schwierig und zeitraubend. Eine schnelle und effiziente Wissensnutzung ist daher nur möglich, wenn fremdes Wissen angenommen und verwendet wird, ohne zunächst einer langwierigen Überprüfung unterzogen zu werden. Um wirken zu können, muss Vertrauen in der gesamten Organisation verankert werden. Dies ist nur möglich, indem es bei der Unternehmensspitze beginnend durch die Führungskräfte vorgelebt wird. Der Austausch muss sichtbar mit Anerkennung verbunden sein, was sich beispielsweise durch eine entsprechende Gestaltung der Anreizsysteme erreichen lässt.
- Zusammenarbeit: Das für die Leistungserstellung notwendige Wissen entsteht bei den Mitarbeiter*innen durch ihre Zusammenarbeit mit Kolleg*innen. Durch die gemeinsame Erfüllung der Aufgaben tauschen sie Erfahrungswissen aus und schaffen damit neues Wissen. Die Arbeit im Team muss daher mit mehr Ansehen und Anreizen verbunden werden als die Erbringung von Einzelleistungen.
- Offenheit: Der Austausch von implizitem Wissen findet ausschließlich in der direkten Kommunikation statt. Die Offenheit für neue Erfahrungen, neue Menschen und neues Wissen regt die Kommunikation und damit den Austausch des impliziten Wissens an. Der Austausch verschiedener Meinungen kann zu Konflikten führen. Durch Offenheit können diese in kreativen Diskursen bearbeitet werden und zu völlig neuen Lösungen beitragen. Ohne einen offenen Umgang ist es nicht möglich aus Fehlern zu lernen, da diese sonst aus Angst verborgen werden.
- Autonomie: Es nützt wenig, Mitarbeiter*innen in Entwicklungsmaßnahmen zu schicken und ihr Können zu erweitern, wenn sie es am Arbeitsplatz nicht anwenden dürfen. Selbständiges Handeln ist wichtig für die Motivation der Mitarbeiter*innen und spornt diese dazu an, neue Lösungsansätze auszuprobieren. Autonomie begünstigt Eigeninitiative, die tägliche Innovation im Kleinen und die laufende Optimierung der Arbeitsprozesse durch die Mitarbeiter*innen. Dadurch wird unternehmerisches Denken gefördert, was nebenbei den Bedarf für Anreizsysteme verringert, da Erfolgserlebnisse die Mitarbeiter*innen intrinsisch motivieren.
- Lernbereitschaft: Menschen erwerben Wissen in Lernprozessen. Jede Erfahrung trägt zu einer Veränderung des Wissens bei, vorausgesetzt die beteiligten Individuen sind bereit, ihr bestehendes Wissen zu erweitern oder in Teilen zu revidieren. Letzteres gilt vor allem für das Lernen aus Fehlern. Durch die Tendenz diese zu verstecken, wird der Lernprozess behindert. Zur Lernbereitschaft gehört daher auch ein gewisses Ausmaß von Fehlertoleranz und Offenheit. Die Aufgabe von bestehendem Wissen heißt für die Beteiligten auch, dass sie die bisher gültige Wahrheit hinterfragen müssen. Die Angst vor Veränderungen hat darin ihre Wurzeln, da mit der Aufgabe einer Wahrheit auch ein Teil der Identität geopfert wird.
- Fürsorge: Der empathische Umgang mit Mitarbeiter*innen und Kolleg*innen bildet die Grundlage für gegenseitiges Vertrauen, für die Bereitschaft, Hilfe anzubieten und anzunehmen, oder auch für den Umgang mit Menschen, die einen Fehler begangen haben.
Vom Standpunkt des Wissensmanagers aus betrachtet, ist Wissenskultur eine notwendige Voraussetzung dafür, dass Wissensmanagement erfolgreich implementiert werden kann. Aus der Beschäftigung mit den Einflussfaktoren auf Unternehmenskultur wurden verschiedenste Gestaltungsempfehlungen abgeleitet. Der Austausch von Wissen setzt voraus, dass Mitarbeiter*innen einander kennen und soweit vertrauen, dass sie offen kommunizieren. Komplexe Projekte verlangen die Zusammenarbeit im Team. Für den unternehmensweiten Wissensaustausch werden Communities of Practice empfohlen. Das ist ein Netzwerk, bei dem Wissen quer über Fachbereiche und Hierarchien ausgetauscht werden kann. Kommen neue Mitarbeiter*innen ins Unternehmen, müssen sie rasch mit den Gegebenheiten vertraut gemacht werden. Daraus ergibt sich, dass der Einführungsphase große Bedeutung zukommt (vgl. Sollberger 2006, S. 270–274). Kurz gefasst müssen Mitarbeiter*innen neben der fachlichen Qualifikation sozial-kommunikative Fähigkeiten entwickeln, die sie befähigen, im Team mit Kolleg*innen zusammenzuarbeiten, Beziehungen mit Kund*innen aufzubauen, und sich in wechselnde Projektorganisationen zu integrieren (vgl. Picot/Scheuble 2000, S. 31). Zu der Befähigung muss auch das Wollen der Mitarbeiter*innen kommen, was durch die Ausgestaltung der Anreizsysteme erreicht werden kann.
Wiederholungsaufgaben
- Beschreiben Sie das Drei-Ebenen Modell von Schein.
- Welche positiven Auswirkungen hat Unternehmenskultur?
- Welche Probleme kann Unternehmenskultur verursachen?
- Wie wird Wissensmanagement durch Kultur beeinflusst?
- Welche Faktoren tragen zu einer Wissensmanagement-förderlichen Kultur bei?
Lösungen
Beschreiben Sie das Drei-Ebenen Modell von Schein.
Schein charakterisiert Kultur anhand der Elemente Annahmen, Werte und Artefakte. Er bringt diese Elemente in eine hierarchische Anordnung, indem er sie nach ihrer Sichtbarkeit anordnet. Grundlegende Annahmen bilden die Basis der Kultur. Sie sind so tief verinnerlicht, dass sie unbewusst sind und nicht extra ausgesprochen werden müssen, um ihre Wirkung zu entfalten. Aus diesem Grund sind sie für Außenstehende weitgehend unsichtbar und schwierig zu durchschauen. In der Ebene darüber liegen die öffentlich bekundeten Werte. Diese sind sprachlich ausformuliert und nehmen die Form von Visionen, Leitbildern, Strategien und Zielen an. An der Spitze stehen die Artefakte. Unter Artefakten subsummiert Schein alle sichtbaren Manifestationen von Kultur. Dazu zählen Strukturen und Prozesse, Architektur und räumliche Gestaltung, Statussymbole und Anreizsysteme, sowie das sichtbare Verhalten der Mitarbeiter*innen.
Welche positiven Auswirkungen hat Unternehmenskultur?
Die Normen und Werte einer Unternehmenskultur reduzieren die Vielzahl der Handlungsmöglichkeiten auf die sozial erwünschten. Damit steuern sie das Verhalten der Mitarbeiter*innen und wirken stabilisierend auf den Zusammenhalt von Gruppen.
Welche Probleme kann Unternehmenskultur verursachen?
Durch ihre stabilisierende Wirkung birgt Kultur die Gefahr, dass notwendige Veränderungen nicht durchgesetzt werden können und dass sich unerwünschte Verhaltensweisen verfestigen. Veränderungen lösen Ängste aus, da sie in Frage stellen, was bisher als selbstverständlich gegolten hat. Veränderungsprozesse müssen behutsam durchgeführt werden und sind daher sehr zeitaufwendig.
Wie wird Wissensmanagement durch Kultur beeinflusst?
Kultur definiert, was wahr oder falsch, erwünscht oder unerwünscht, relevant oder unwichtig ist. Damit bestimmt sie maßgeblich, welche Informationen die Mitarbeiter*innen wahrnehmen, als wertvoll bewerten und in ihre Tätigkeiten einfließen lassen. Wissensmanagement Projekte werden initiiert, um den Umgang mit Wissen zu verändern. Ist die Bereitschaft zur Veränderung nicht in den Werten der vorherrschenden Kultur
Welche Faktoren tragen zu einer Wissensmanagement förderlichen Kultur bei?
Vertrauen begünstigt den Austausch von Wissen. Wer Wissen preisgibt, muss darauf vertrauen können, dass er*sie nicht hintergangen wird. Auch die Nutzung fremden Wissens braucht Vertrauen in die Kompetenz des*der Wissensträger*in und die Richtigkeit seiner*ihrer Informationen.
Bei der Zusammenarbeit werden die individuellen Fähigkeiten der Mitarbeiter*innen kombiniert. Daraus entsteht neues Wissen auf einer höheren qualitativen Ebene.
Offenheit ist die Voraussetzung für die Kommunikation unter den Mitarbeiter*innen und für den Umgang mit Konflikten. Nur durch den offenen Umgang mit Fehlern kann der*die einzelne Mitarbeiter*in und die Organisation als Ganzes lernen.
Autonomie verschafft den Mitarbeiter*innen den notwendigen Freiraum zur Erprobung neuer Ideen und schafft damit die Möglichkeit, Erfahrungswissen zu erwerben.
Lernbereitschaft drückt sich durch den Willen aus, bestehendes Wissen zu erweitern oder zu revidieren. Es ist die Voraussetzung für die Erprobung neuer Verfahren und Methoden und für das Lernen aus Erfahrungen und Fehlern.
Der fürsorgliche Umgang eines Unternehmens mit seinen Mitarbeiter*innen schafft eine vertrauensvolle Umgebung, in der sich die bisher aufgezählten Werte entwickeln können.
Wissensmanagement-Modell: Integrierte Wissensmanagement-Systeme
Ziele der Lektion:
- Beschreibung von Wissen und Wissenskommunikation
- Darstellung der Zielebenen Strategie, Prozesse und Systeme
- Kennenlernen der Handlungsfelder und Ansatzpunkte für Wissensmanagement
- Vorstellen der Architektur integrierter Wissensmanagement-Systeme
- Darstellen der Wissensmanagement-Prozesse und der unterstützenden Systeme
Im Abschnitt über implizites Wissen wurde bereits auf den Nutzen von Modellen für den Transfer von Wissen hingewiesen (vgl. Abschnitt 1.2.1). Ein sehr anschauliches und durchgängiges Modell für Wissensmanagement im Unternehmen hat Gernot Riempp mit seinem Werk „Integrierte Wissensmanagement-Systeme“ erschaffen, in dem er die Implementierung von Wissensmanagement im Unternehmen anhand einer Architektur beschreibt. Riempp definiert Wissensmanagement durch seine Unterstützungsfunktion bei der Durchführung der Geschäftsprozesse in Organisationen. Seine Absicht war die Erschaffung eines Architekturmodells, das nicht auf einzelne Aspekte von Wissensmanagement beschränkt bleibt und einseitig soziale, organisatorische oder technische Maßnahmen aufgreift, sondern die Erschaffung eines umfassenden, integrierten Systems. Die Anforderungen an ein solches System ergeben sich aus der Geschäftsstrategie, aus der die operativen Tätigkeiten und Prozesse folgen, die durch Wissensmanagement unterstützt werden sollen (vgl. Riempp 2004, S. 3).
Riempp baut auf dem Drei-Ebenen-Modell des Business Engineering nach Österle auf. Dieses bringt die drei Gestaltungsfelder Strategie, Prozesse und Informationssysteme in eine hierarchische Ordnung, anhand derer sich die Wechselwirkungen und Zusammenhänge darstellen lassen. Mit Hilfe der Geschäftsstrategie definieren Unternehmen ihre Geschäftsfelder. Damit legen sie fest, auf welchen Märkten sie sich engagieren und welche Marktleistungen sie produzieren wollen. Außerdem legen sie auf dieser Ebene fest, welche Struktur ihre Aufbauorganisation hat, bilden ein Führungssystem aus und geben ihm die notwendigen Führungsinstrumente. Auf der Ebene der Prozesse werden die Produkte und Leistungen konkretisiert, mit denen die Marktleistung erbracht wird. Die Prozesse fassen die einzelnen Aufgaben zusammen, die zu ihrer Produktion notwendig sind.
Die obere Abbildung zeigt, wie diese Aufgaben auf der Ebene der Informationssysteme durch Funktionen unterstützt werden, welche durch Applikationen und ihre Datenbestände erbracht werden (vgl. Riempp 2004, S. 49).
Gegenstandsbestimmung
Wissen wird von Riempp anhand seiner Relevanz für ein betriebswirtschaftlich orientiertes Wissensmanagement definiert (vgl. Riempp 2004, S. 63–64):
- Wissen ist das Produkt sensorischer Erfahrungen, mittels derer Menschen ihre Umwelt wahrnehmen und verstehen. Die menschliche Fähigkeit zur Aufnahme und zum Verstehen dieser Umwelt ist dabei individuell ausgeprägt und damit mehr oder weniger begrenzt.
- Menschen machen sich ein Bild von ihrer Umwelt, die sie in Form von mentalen Modellen abbilden. Diese Modelle sind ein Produkt kognitiver Anstrengungen, unterliegen aber auch emotionalen und sozialen Einflüssen. Mentale Modelle sind daher kein exaktes Abbild der Umwelt. Sie sind ebenso ein Ausdruck von Phantasie und Kreativität und werden durch soziale Aushandlungsprozesse verändert. Sie sind tief in ihren Träger*innen verankert und nur zum Teil bewusst, daher sind sie auch nur bedingt explizierbar.
- Soziale Gemeinschaften beruhen auf geteilten mentalen Modellen. Die gemeinsamen Vorstellungen sind der soziale Konsens, der die Abstimmungsprozesse innerhalb einer Gemeinschaft vereinfacht und damit koordiniertes Handeln möglich macht.
- Wissen erlangt seinen Wert im unternehmerischen Kontext durch seine Eignung zur Lösung konkreter Problemstellungen. Es erlangt seine Wahrheit durch Bewährung und nicht durch eine objektiv-wissenschaftliche Richtigkeit. Aus diesem Anspruch folgt der handlungsleitende Aspekt von Wissen, das seinen Wert erst in der Anwendung erhält. Die Kompetenz eines Menschen bemisst sich daher nicht allein aus seinem Wissen. Sie beruht auf Kennen, Können und angemessenem Entscheiden.
- Wissen und mentale Modelle sind an ihre*n Träger*in gebunden. Nur diese*r kann angemessen entscheiden und handeln. Daher ist Wissen nicht unabhängig von seinem*seiner Träger*in und damit nicht unmittelbar managebar. Wissen kann aber ausschnittsweise abgebildet und in Form von Informationsobjekten externalisiert werden. Mit Hilfe dieser Informationsobjekte und ergänzender Kontextinformation kann das Wissen von einem Menschen zu einem anderen übertragen werden.
Kommunikationsmodell für den Wissenstransfer
Diese Definition von Wissen lässt bereits die Probleme erahnen, welche die Übertragung von Wissen zwischen zwei Personen gefährden. Anhand eines Modells für den Austausch von Wissen durch dessen Abbildung in Informationsobjekten und deren Rezeption durch eine*n Empfänger*in werden die Faktoren deutlich, die diesen Prozess beeinflussen. Das im Weiteren beschriebene Kommunikationsmodell ist in der unteren Abbildung dargestellt (Riempp 2004, S. 69).
Die im Rahmen einer Kommunikation ausgetauschten Informationen werden durch eine Reihe von Filtern reduziert, die bei Sender*in und Empfänger*in wirken. Der emotionale Ausgangsfilter (EAF) beruht auf der Tatsache, dass sich Kommunikation nicht ausschließlich auf der Sachebene abspielt. Jede zwischenmenschliche Kommunikation wird durch das Verhältnis auf der Beziehungsebene beeinflusst. Positive Emotionen regen den Austausch an, während negative Emotionen die Kommunikation beschränken oder verhindern. Der soziale Ausgangsfilter (SAF) wird durch die kulturellen Umgebungsbedingungen bestimmt, deren Normen und Werte darüber bestimmen, welche Informationen anerkannt und richtig sind und ob ihr Austausch sozial erwünscht ist. Die Explikationsfähigkeit (EF) ist Ausdruck der Kompetenz des*der Sender*in. Sie entscheidet darüber, in welchem Umfang und mit welcher Qualität die Abbildungsversuche des mentalen Modells erbracht werden. Die Empfänger-Kontext-Antizipation (EKA) ist die Einschätzung hinsichtlich der zu erwartenden Verstehensfähigkeit des Gegenübers und der Versuch, die Kommunikation an diese anzupassen.
Bei dem*der Empfänger*in wirken ähnliche Mechanismen. Die Kontext-Bewältigungsfähigkeit (KBF) bestimmt, in welchem Ausmaß der*die Empfänger*in die Informationen und den ihn*sie umgebenden Kontext aufnehmen und mittels seines*ihres eigenen mentalen Modells interpretieren und reflektieren kann. Der Relevanzfilter (RF) wird durch das Interesse des*der Empfänger*in bestimmt, das diese*r an den übertragenen Informationsinhalten hat.
Nur wenn diese für ihn*sie bedeutsam sind, wird er*sie die Anstrengung unternehmen, sie aufzunehmen und zu verarbeiten. Der soziale Eingangsfilter (SEF) ist durch die Kultur determiniert, die darüber bestimmt, ob Einzelleistung oder Teamarbeit, individuelle Schöpfung oder gemeinsame Wissensentwicklung geschätzt und belohnt werden. Schließlich wirkt bei dem*der Empfänger*in auch noch der emotionale Eingangsfilter (EEF). Die Gefühle gegenüber dem*der Kommunikationspartner*in tragen entweder dazu bei, die Kommunikation zu fördern, oder verhindern diese durch Flucht- und Abwehrverhalten (vgl. Riempp 2004, S. 69–70).
Anhand des Kommunikationsmodells ist ersichtlich, dass es eine Reihe von Voraussetzungen gibt, die für einen erfolgreichen Austausch von Information notwendig sind (vgl. Riempp 2004, S. 70–71):
- Die beiden Kommunikationspartner*innen müssen eine gemeinsame Sprache sprechen. Die Kenntnis von kulturellen Eigenheiten wie Ausdrucksweisen, Gestik und Mimik unterstützt die Kommunikation und erleichtert die Interpretation des Kontextes.
- Eine Übereinstimmung hinsichtlich der verwendeten Terminologie beschleunigt die Kommunikation. Ohne diese müssen die beiden Kommunikationspartner*innen die verwendeten Begriffe erst aushandeln, bevor sie verwendet werden können.
- Die Kommunikation zwischen zwei Individuen setzt voraus, dass es einen gemeinsamen Raum gibt, innerhalb dessen sie stattfinden kann. Diese Räume können reale physische Stätten sein, aber auch rein virtuell existieren. Dabei ist zu beachten, dass es räumliche und zeitliche Nähe den Kommunikationspartner*innen ermöglicht, das Verhalten des Gegenparts zu beobachten und daraus Rückschlüsse zu ziehen. Damit wird die Kommunikation durch Kontextinformationen bereichert, die die Integration der Informationen in die bestehenden mentalen Modelle erleichtern.
Handlungsfelder im Wissensmanagement
Dieses Modell für den Wissensaustausch verdeutlicht, welche Elemente für einen gelungenen Wissenstransfer berücksichtigt werden müssen. Gleichzeitig zeigt es auf, wo es zu Problemen kommen kann, die durch Managementmaßnahmen korrigiert werden müssen. Aus dem Modell lassen sich die Handlungsfelder bestimmen, die durch Wissensmanagement bearbeitet werden müssen (vgl. Riempp 2004, S. 71–72). Als Merkhilfe kann man sich die Begriffe im Englischen als die vier Cs einprägen (Competence, Content, Cooperation und Culture):
- Kompetenz: Menschen besitzen Fähigkeiten und Kenntnisse, die sie zur Erfüllung von Aufgaben einsetzen. In diesen Handlungen und Entscheidungssituationen entsteht Wissen darüber, was sich bewährt und was nicht. Die Kompetenz einer Person entsteht demnach durch die Anwendung von Wissen in praktischen Anwendungsfällen. Bezogen auf das Unternehmen, entscheidet sich die Kompetenz eines*einer Mitarbeiter*in durch seine*ihre Fähigkeit, sein*ihr Wissen zur Erreichung organisationaler Ziele einzusetzen.
- Inhalt und Kontext: Der Wissensaustausch zwischen mehreren Personen passiert über die teilweise Abbildung der mentalen Modelle mit Hilfe von Informationsobjekten. Eine Kombination verschiedener Verfahren (z.B. Text, Bild, Grafik, Animation, Video, etc.) führt zu einer reichhaltigeren Abbildung, in der neben der reinen Information auch Kontextinformationen enthalten sind. Dadurch fällt es dem*der Empfänger*in leichter, die empfangenen Informationen in sein*ihr eigenes mentales Modell einzuordnen. Die Kombination von Inhalt und Kontext wird als Content bezeichnet.
- Zusammenarbeit: Diese ist die Voraussetzung von Wissensarbeit, da die zunehmende Tiefe der einzelnen Wissensgebiete dazu führt, dass das Wissen mehrerer Spezialisten kombiniert werden muss, um ein wissensintensives Produkt zu erstellen. Die Zusammenarbeit findet in physischen und virtuellen Räumen statt. In physischen wie auch in virtuellen Räumen müssen Werkzeuge bereitstehen, die die Abbildung der Informationsobjekte unterstützen.
- Kultur: Die Bereitschaft, Wissen auszutauschen, steht und fällt mit der Kultur, die die emotionalen und sozialen Voraussetzungen dafür schafft. Eine förderliche Umgebung ermutigt Menschen, ihr Wissen zu explizieren und anderen mitzuteilen und motiviert sie umgekehrt auch, fremdes Wissen zu suchen und aufzunehmen.
Ansatzpunkte für Wissensmanagement-Maßnahmen
Analog zu den Handlungsfeldern lassen sich die Ansatzpunkte bestimmen, an denen Wissensmanagement-Aktivitäten ansetzen können. Die Entsprechungen zu den Handlungsfeldern Kompetenz, Inhalt und Kontext sowie Zusammenarbeit sind (vgl. Riempp 2004, S. 76):
- Human-orientiertes Wissensmanagement: Ansatzpunkt ist der Mensch mit seinen Kompetenzen. Deren Entwicklung muss durch Lernen und praktische Erfahrungen gefördert werden. Gibt es vorrangig Aktivitäten zu diesem Ansatzpunkt, wird eine Personalisierungsstrategie verfolgt. Dabei werden die individuellen Kompetenzen der Mitarbeiter*innen gefördert und zur Lösung neuartiger Problemstellungen eingesetzt.
- Technik-orientiertes Wissensmanagement: Im Mittelpunkt steht die Unterstützung des Menschen bei der Erzeugung von Informationsobjekten sowie bei deren Speicherung, Verteilung und Nutzung. Wissensmanagement-Aktivitäten in diesem Bereich sind ein Hinweis für die Kodifizierungsstrategie. Deren Merkmal ist die Wiederverwendung von Wissen durch Standardisierung von Abläufen und Dokumenten, um damit gleichartige Dienstleistungen mit hoher Qualität zu erbringen.
- Interaktions-orientiertes Wissensmanagement: Der Aufbau und die gemeinsame Anwendung von Wissen stehen hier im Vordergrund. Wissen wird sozialisiert und tief im Gedächtnis aller Mitarbeiter*innen verankert. Die breite Verteilung des Wissens berechtigt zu sagen, dass das Wissen in der Organisation selbst verankert wird, es kommt zum organisationalen Lernen. Das Bild der lernenden Organisation ist durchaus angemessen. Zwar bleibt das Wissen an den Menschen gebunden, jedoch führt normalerweise nur die Schließung des Betriebes dazu, dass alle Mitarbeiter*innen mit einem Schlag das Unternehmen verlassen und dieses Wissen damit verloren geht.
Drei-Ebenen-Gliederung
Ausgehend von der Gliederung des Drei-Ebenen-Modells des Business Engineering verortet Riempp Wissensmanagement-Aktivitäten auf den Ebenen Strategie, Prozesse und Systeme (vgl. Riempp 2004, S. 77–91).
Strategieebene
Beim Strategie-orientierten WM stehen die ökonomischen Ziele im Vordergrund, die durch eine geeignete Wissensmanagement-Strategie unterstützt werden sollen. Die Untersuchung von Hansen et al. hat den Zusammenhang der WM-Strategie mit den IT-und HR-Strategien gezeigt, sowie deren Ausrichtung an der Unternehmensstrategie (vgl. Abschnitt 2.1). Im Gegensatz zur operativen Planung mit ihren weitgehend quantitativen Zielen ist es bei der Strategieplanung schwieriger, Ziele, kritische Erfolgsfaktoren, sowie Mess- und Führungsgrößen zu definieren. Je nach Unternehmensstrategie wird die Wissensmanagement-Strategie einen der Ansatzpunkte Mensch, Organisation oder Technik bevorzugen. Meist wird diese außerdem eine der Aktivitäten Erfassen, Schaffen, Verteilen oder Nutzen von Wissen besonders betonen. Auf der Basis der von ihm durchgeführten Workshops und einer Auswertung der verfügbaren Literatur definiert Riempp die folgenden Ziele für Wissensmanagement (vgl. Riempp 2004, S. 132):
- Transparenzierung des in der Organisation vorhandenen Wissens
- Förderung des Austausches von Wissen
- Steuerung der Wissensentwicklung für aktuelle und künftige Anforderungen
- Sicherstellen der Effizienz von Wissensmanagement und Wissensnutzung
Ausgehend von den Zielen müssen die kritischen Erfolgsfaktoren bestimmt werden, ohne die die Ziele nicht erreicht werden können. So ist es beispielsweise bei der Personalisierungsstrategie notwendig, dass die Mitarbeiter*innen über die notwendige Expertise verfügen. Ohne diese bereits im Vorfeld aufgebaut zu haben, kann diese Strategie nicht verfolgt werden. Zur Ausgestaltung des Messsystems müssen die Ziele operationalisiert werden. Auf der Ebene der Informationssysteme finden sich viele Messgrößen, wie etwa Anzahl der Zugriffe auf Dokumente, Anzahl der Zugriffe auf das System, Anzahl der Suchvorgänge, das Nutzungsverhalten der Benutzer*innen etc. Bei den Prozessen wird es schon schwieriger, hier könnten die Anzahl der dokumentierten Prozesse sowie ihre Aktualität gemessen an der Zeitspanne zum letzten Review herangezogen werden. Das Messen der Kompetenz stellt in dieser Hinsicht die Königsklasse dar, da sie sich erst in ihrer Anwendung zeigt. Betrachtet man die Maßnahmen zur Evaluierung von Personalentwicklungsmaßnahmen in der Praxis, so beschränken sich die meisten Unternehmen darauf, die Zufriedenheit der Teilnehmer*innen direkt nach der Schulung zu erheben. Eine langfristige Beobachtung der Effektivität von Weiterbildungsmaßnahmen ist dagegen in der Praxis selten.
Prozessebene
Beim Prozess-orientierten Wissensmanagement liegt der Fokus auf den Aktivitäten, die im Zusammenhang mit Wissen stehen. Diese stehen in direktem Zusammenhang mit den vier strategischen Zielebenen (vgl. Riempp 2004, S. 81-82):
- Am Begin steht das Lokalisieren und Erfassen von implizitem Wissen, das in Form von Kompetenz bei den Mitarbeiter*innen im Unternehmen vorhanden ist, sowie von explizitem Wissen, dessen Inhalt und Kontext in Informationsobjekten abgebildet wurde.
- Der Austausch von Wissen zwischen seinen Träger*innen erfolgt in gemeinsamen Räumen. Diese können die Form von physischen Orten haben oder auch rein virtuell existieren. Voraussetzung für den direkten Austausch ist die Kenntnis von Personen, die die gesuchte Expertise haben. Hinweise dafür bieten beispielsweise Yellow Pages und ähnliche Kataloge, die die Kompetenz der Mitarbeiter*innen erfassen. Das Pendant zum Austausch impliziten Wissens ist die Verteilung der Informationsobjekte, in denen explizites Wissen festgehalten wurde.
- Das Wissen für zukünftige Produkte ist oft noch nicht vorhanden und kann aufgrund seiner Neuartigkeit auch nicht auf Märkten erworben werden. Es muss daher im Unternehmen selbst entwickelt werden. Wissen kann durch zielgerichtete Forschung, aber auch durch Lernprozesse entwickelt werden, die im Arbeitsprozess laufend stattfinden. Qualitätszirkel und kontinuierliche Verbesserungsprozesse sind ein Beispiel dafür, wie Wissen auch in Unternehmen geschaffen wird, die keine Forschung betreiben.
- Die Nutzung des Wissens ist schließlich der eigentliche Zweck aller Wissensmanagement-Aktivitäten. Wissen wird in den Geschäftsprozessen eingesetzt und leistet damit einen Beitrag zum ökonomischen Erfolg des Unternehmens.
Systemebene
System-orientiertes Wissensmanagement hat die Informationssysteme zum Gegenstand, die die Werkzeuge zur Umsetzung von Strategie und Prozessen bereitstellt. Je nach Handlungsfeld gibt es unterschiedliche Werkzeuge. Kompetenz wird durch Lernen entwickelt, das mit E-Learning unterstützt werden kann. Kompetenzprofile und –raster unterstützen den*die Personalentwickler*in bei der Planung von Schulungsmaßnahmen und sind die Grundlage für die Suche nach Wissensträger*innen über Kompetenzverzeichnisse. Kreativwerkzeuge wie Mind-Mapping Tools unterstützen die Entwicklung von Ideen, die mit Multimedia-Werkzeugen und Textverarbeitungswerkzeugen in Bild, Text, gesprochener Sprache usw. festgehalten werden. Die so erstellten Inhalte werden durch Dokumenten- und Content-Management-Systeme verwaltet und den Mitarbeiter*innen zur Verfügung gestellt. Die Zusammenarbeit wird durch die virtuellen Räume von Community-Management-Systemen unterstützt. IT-Systeme stellen Werkzeuge zum Lokalisieren von Wissensträger*innen, zum Kontaktieren dieser Personen, zum gemeinsamen Arbeiten an Aufgaben und zum Abwickeln von Prozessen zur Verfügung. In diesen Bereich fallen Instrumente zur Kommunikation wie Instant Messaging, Mail, Foren, Terminplanung, sowie Werkzeuge für Prozessmanagement. Die elektronische Datenhaltung begünstigt außerdem die Suche und Navigation, da sie die Daten strukturiert und mit Hilfe von Taxonomien zugänglich macht (vgl. Riempp 2004, S. 85-86).
Metamodell
Das Metamodell von Riempp basiert im Wesentlichen auf den oben beschriebenen Grundlagen. Im Zentrum stehen die drei Ebenen des Business Engineering: Systeme, Prozesse und Strategie. Zu diesen ergänzt er die Organisation als Mittel zur Umsetzung der Aktivitäten. Dazu kommt die Ausrichtung auf die zu unterstützenden Kundenprozesse als Ziel und Ausgangspunkt der Leistungserstellung. Den letzten wesentlichen Baustein bilden die Handlungsfelder für Wissensmanagement, die sich aus dem Kommunikationsmodell für Wissensmanagement ergeben (vgl. Riempp 2004, S. 120–121). Die untere Abbildung zeigt, wie Riempp aus diesen Grundlagen ein Metamodell formt, das nach Ebenen gegliedert ist, den Kundenprozess als Ausgangspunkt für die Marktleistung darstellt und die Handlungsfelder für Wissensmanagement abbildet (Riempp 2004, S. 123).
Der Kreislauf dieses Modells beginnt beim Kundenprozess, in dem ein Bedarf nach einer Leistung oder an einem Produkt entsteht. Dadurch entsteht die Voraussetzung dafür, dass ein Unternehmen eine Strategie entwickelt, welchen Markt es bearbeiten soll und welche Marktleistung erbracht werden soll. Wissensmanagement-Ziele stehen in einer Zweck-Mittel-Relation zu den Unternehmenszielen, folglich leitet sich die Wissensmanagement-Strategie aus der übergeordneten Unternehmensstrategie ab. Beiden Zielen ist gemein, dass ihr Erreichen von kritischen Erfolgsfaktoren abhängt. Deren Ausprägung wird in Mess- und Führungsgrößen operationalisiert, an denen die Ergebnisse der Prozesse gemessen werden. Folgt man der Grafik zunächst weiter zur Organisation, gelangt man zur Führungsorganisation, die sich der Führungsgrößen bedient, um damit die Organisationseinheiten zu leiten und die in ihnen eingegliederten Mitarbeiter*innen mit Anreizen zu führen. Die Organisation besitzt eine eigene Kultur, die die Umwelt für die Mitarbeiter*innen bildet. Diese bildet den Rahmen für Netzwerke, an denen die Mitarbeiter*innen teilnehmen und ihr Wissen austauschen. Mitarbeiter*innen besitzen verschiedene Rollen, die durch Aufgabenbündel charakterisiert sind. Durch diese Aufgaben nehmen sie an der Durchführung von Geschäfts- und Unterstützungsprozessen teil. Die Systemebene unterstützt die anderen Ebenen durch verschiedene Elemente. Es integriert Funktionen in Portalen, die den Mitarbeiter*innen bei der Erfüllung ihrer Aufgaben in den Prozessen zur Verfügung gestellt werden. Diese Funktionen werden durch Anwendungen und ihre Daten realisiert. Die Daten werden in den Speichern der Informationssysteme verwaltet und strukturiert. Zu diesen Daten kommen die Kompetenzprofile der Mitarbeiter*innen, sowie die Informationsobjekte, in denen sie ihr Wissen abgebildet haben. Eine Taxonomie gibt allen Objekten eine gemeinsame Struktur, die die Navigation und die Suche in den Beständen erleichtert. Durch die Kommunikationstechnik schafft die Systemebene Räume für die Zusammenarbeit der Mitarbeiter*innen. Neben den virtuellen Räumen bietet die IT auch Werkzeuge zur medialen Unterstützung, welche die direkte Kommunikation in physischen Räumen erleichtern (vgl. Riempp 2004, S. 123–124).
Architektur
Auf der Grundlage dieses Metamodells formt Riempp eine Architektur für integrierte Wissensmanagement-Systeme, in dem die Handlungsfelder in Form von drei Säulen und der alles umgebenden Kultur repräsentiert werden. Wie in folgender Abbildung zu sehen ist, ist auch die Architektur in die Ebenen Strategie, Prozesse und Systeme untergliedert (Riempp 2004, S. 126).
Strategie und Führung werden durch ein Messsystem unterstützt, in dem die Ausprägung der kritischen Erfolgsfaktoren durch Indikatoren messbar gemacht wird. Mit ihrer Hilfe kann der Führungsprozess die Zielerreichung feststellen und Maßnahmen ableiten.
Auf der Ebene der Prozesse befinden sich die zentralen Geschäftsprozesse, in denen die Produkte und Dienstleistungen erzeugt werden, sowie Entwicklungs- und CRM-Prozesse. Ergänzt werden diese Kernprozesse durch die Unterstützungsprozesse, zu denen die Prozesse von IT, HR und Finance zählen. Auch die Wissensmanagement-Prozesse sind nach ihrem Wesen nach Unterstützungsprozesse. Sie wurden nur zur besseren Verdeutlichung aus diesen herausgehoben und getrennt dargestellt. Dem Businessmodell des Informationszeitalters folgend sind die Prozesse eines Unternehmens Teil einer größeren Prozesskette, die jene von Lieferant*innen und Kund*innen einschließt. Diese Prozesse werden durch Portale verbunden, in denen die beteiligten Systeme über Schnittstellen gekoppelt werden. Durch den intensiven Einsatz von IT-Systemen können die Koordinationskosten niedrig gehalten werden. Neben den offenkundigen Funktionen eines Systems bei der Bewältigung der Aufgaben in den internen Prozessen, bemisst sich sein Wert an den Schnittstellen zu Fremdsystemen. Auch die Mensch-Maschine-Schnittstelle zu den Mitarbeiter*innen ist idealerweise durch ein Portal realisiert. Für den*die Mitarbeiter*in sollte es nicht wichtig sein, welche Anwendung welche Funktion realisiert und welche Kunstgriffe notwendig sind, diese Funktionen zur Erfüllung seiner*ihrer Aufgaben einzusetzen. Die Präsentation der Funktionen sollte einheitlich und aufgabenbezogen sein. Das Set der angebotenen Funktionen sollte sich überdies durch ein Rollenmodell an die Anforderungen des*der einzelnen Mitarbeiter*in anpassen lassen. Dadurch wird die Komplexität der einzelnen Produkte zumindest aus Sicht des*der Anwender*in reduziert.
Die in den Portalen angebotenen Funktionen werden von einem Informationssystem bereitgestellt. Die unterschiedlichen Erfordernisse an die Systeme entstehen aus den Handlungsfeldern, die durch Säulen dargestellt sind. Die traditionellen Funktionen etwa von ERP-Systemen werden in der Säule „Transaktionen“ realisiert. Hier werden die Aufgaben der Kernprozesse erbracht, wie Aufträge, Bestellungen, Buchungen, Lagerbewegungen, etc. Diese Aufgaben stellen nicht den Kernbereich von Wissensmanagement dar, müssen jedoch bei der Gestaltung von Wissensmanagement einbezogen werden. Schließlich sind es diese Prozesse, für die Wissensmanagement Unterstützung leisten soll. Die Säule „Inhalte“ beschreibt die Funktionen, die zum Erstellen, Verteilen und Nutzen von Inhalten notwendig sind. Unter Inhalten werden hier die eigentlichen Inhalte sowie Kontextinformationen verstanden, die durch den Begriff Content zusammengefasst werden. In der Säule „Kompetenz“ werden jene Aktivitäten erbracht, die zum Erstellen von Kompetenzprofilen notwendig sind, sowie die Entwicklung der Kompetenz der Mitarbeiter*innen durch berufliche Aus- und Weiterbildung. Die Säule „Zusammenarbeit“ stellt die virtuellen Räume bereit, in denen Mitarbeiter*innen gemeinsam Aufgaben bearbeiten und Prozesse abwickeln. Auch die medialen Werkzeuge in physischen Räumen fallen in diese Säule. In der Säule „Orientierung“ sind alle Funktionen zur Navigation und Suche angeordnet, sowie Hilfsfunktionen zur Administration und Authentifizierung der Benutzer*innen und zur Pflege von Rollen und Benutzerprofilen.
Über diesen Säulen wird ein Ordnungssystem aufgespannt, das durch eine zentrale Taxonomie für eine Terminologie sorgt, die von allen Mitarbeiter*innen verstanden wird. Durch die Vereinheitlichung der Begrifflichkeiten werden die Informationsobjekte, Kompetenzprofile und Daten strukturiert. Dadurch kann eine einheitliche Navigation und Suche quer über die Säulen realisiert werden. Die Darstellung macht deutlich, dass die Integration essenziell für den Erfolg der IT-Unterstützung ist. Dies wird auch an den darunterliegenden Schichten deutlich. Die Integration der einzelnen spezialisierten Applikationen, sowie ihrer Daten auf der Systemebene, schafft die Voraussetzung für eine optimale Unterstützung der Anwender*innen der IT-Systeme. Wie bereits bei den Portalen beschrieben, sollten die Anwender*innen nicht Spezialist*innen für die von ihnen genutzten Anwendungen werden müssen, um ihre eigentlichen Aufgaben zu erfüllen. Eine aufgabenorientierte Anordnung der Funktionen in einem Portal mit einer einheitlichen Benutzeroberfläche befähigt die Anwender*innen, diese Aufgaben schneller zu erfüllen, da sie sich auf die inhaltlichen Fragen konzentrieren können.
Die Kultur umrahmt alle Ebenen des Modells, um zu verdeutlichen, dass sie den Rahmen für alle Aktivitäten bildet. Änderungen an der Unternehmensstrategie müssen mit der vorherrschenden Kultur kompatibel sein. Wenn ein Unternehmen von einer Kodifizierungsstrategie zu einer Personalisierungsstrategie übergeht, müssen die Aktivitäten in den einzelnen Säulen anders gewichtet werden. Die Kodifizierungsstrategie betont die Säule „Inhalte“ und macht Investitionen beispielsweise in Content-Management-Systemen notwendig. Der Wechsel zur Personalisierungsstrategie verlagert den Schwerpunkt auf die Säulen „Kompetenz“ und „Zusammenarbeit“. Die Aktivitäten verlagern sich damit auch von der IT Abteilung zur HR, die für die Kompetenzentwicklung zuständig ist (vgl. Riempp 2004, S. 125–128).
Strategische Ebene
Vor der Ausbildung eines Messsystems zur Unterstützung der Führung steht die Definition der Ziele und der kritischen Erfolgsfaktoren, die für deren Erreichung notwendig sind. Die folgende Aufstellung nennt zu jedem der vier grundlegenden Ziele von Wissensmanagement Beispiele für die Säulen „Inhalt und Kontext“, „Zusammenarbeit“, „Kompetenz“, „Orientierung und Kultur“ (vgl. Riempp 2004, S. 133-134):
Transparenzierung des in der Organisation vorhandenen Wissens:
Erschließung der Inhalte durch die strukturierte Ablage in einem Content-Management-System.
Dokumentation der Aufgaben und Zuständigkeiten durch die Erfassung der Prozesse.
Sichtbarmachen der Fähigkeiten der Mitarbeiter*innen durch Kompetenzprofile.
Suche nach kompetenten Mitarbeiter*innen in Yellow Pages.
Fördern des Erfahrungsaustausches durch Einsatz der Methode Story Telling.
Förderung des Austausches von Wissen zwischen den Mitarbeiter*innen:
Abonnieren von Newslettern und RSS Feeds.
Etablieren von Communities und Netzwerken, Schaffen von Räumen zur Zusammenarbeit.
Sicherung der Erfahrungen in Projekten in Lessons-Learned-Workshops und schriftlicher Dokumentation. Dokumentation und Transfer von Best-Practices. Einarbeitung neuer Mitarbeiter*innen mit Patensystemen und Aufbau von Nachwuchsführungskräften durch Mentoring.
Systemunterstützung bei der Verwaltung von Communities, Netzwerken und Räumen zur Zusammenarbeit. Unterstützung bei der Terminplanung und –koordination.
Ermöglichen der Kommunikation durch die räumliche Gestaltung der Arbeitsumgebung. Freiräume und Events schaffen, bei denen auch informelle Gespräche stattfinden können.
Entwicklung des aktuell und zukünftig benötigten Wissens:
Standards für die Dokumentation der Arbeitsvorgänge festlegen. Sicherung der Ergebnisse von Arbeitsgruppen in Protokollen. Erweitern der Zielvereinbarungen mit den Mitarbeiter*innen um individuelle Wissensziele.
Einrichten von unternehmensweiten Arbeitsgruppen. Zusammenarbeit mit Forschungseinrichtungen und anderen Unternehmen.
Entwicklung der Wissensbasis durch Mitarbeiterentwicklung und Recruiting.
Schaffen von Kompetenzrastern und –skalen, anhand derer die Entwicklung des Mitarbeiterstamms gemessen und gesteuert werden kann.
Schaffen von Anreizen für Innovation und Prozessverbesserungen. Fördern der Teamarbeit durch geeignete Ziele und Anerkennung für gemeinsame Leistung.
Effizienten Umgang mit Wissen durch Wissensmanagement sicherstellen:
Integration der Funktionen zur Erstellung und Nutzung der Inhalte in die zur Erfüllung der Geschäftsprozesse benutzten Werkzeuge.
Befragen der Anwender*innen und Untersuchung der Usability der angebotenen Kommunikationswerkzeuge.
Evaluation der Mitarbeiterentwicklung anhand der Veränderung der Kompetenzprofile.
Anwenderbefragung zur Usability der Navigations- und Suchfunktionen. Einführung eines Bewertungssystems für Suchergebnisse.
Erheben der Einstellungen der Mitarbeiter*innen und des Arbeitsklimas in Mitarbeiterbefragungen.
Prozessebene
Wissensmanagement gehört zu den Unterstützungsprozessen, die Leistungen für die Geschäftsprozesse erbringen. Bezogen auf die Säulen des Architekturmodells sind dies das Management der Inhalte, das Management der Kompetenzen, das Management der Zusammenarbeit und das Management der Orientierungsfunktion.
Management der Inhalte
Gegenstand des Content-Managements sind die Informationsobjekte, mit deren Hilfe das explizierte Wissen abgebildet wird. Der Content- Managementprozess umfasst die Aktivitäten Erstellung, Klassifizierung, Freigabe, Publikation, Nutzung und Aktualisierung. Diese Kernaktivitäten werden ergänzt, um die Syndizierung von fremden Inhalten, die Archivierung von obsoleten oder veralteten Inhalten sowie der Weitergabe von Inhalten an andere Systeme. Durch die Weitergabe der Inhalte wird der Kreis der Adressat*innen sukzessive erweitert. Falls der Umfang und die Darstellung der Inhalte nicht bereits bei der initialen Erstellung für die unterschiedlichen Adressat*innen vorbereitet wurde, müssen sie im Zuge der Weitergabe überarbeitet werden. Faktoren, die dabei berücksichtigt werden müssen, sind die Kenntnisse der Zielgruppe und die Sensibilität der Inhalte. Speziell bei der Weitergabe an Unternehmensexterne sind die Informationsobjekte genau zu überprüfen, damit keine geheimen Informationen nach außen dringen. Durch die Überarbeitung wird der unten beschriebene Kernprozess auf einer höheren Ebene erneut angestoßen.
Die Erstellung eines Informationsobjektes durch eine einzelne Person, oder im Team wird durch Werkzeuge zur Abbildung der Informationen unterstützt, etwa durch Mind-Mapping Tools, Grafik- und Office-Anwendungen usw. Verbunden damit ist die Speicherung der Inhalte in elektronischer Form, sowie die Klassifizierung mittels Metadaten und Schlagworten. Die Verwendung von Taxonomien führt zu einer einheitlichen Terminologie, was die Suche und Navigation in den Informationsbeständen erleichtert. Der Speicherung durch den Ersteller folgt ein redaktioneller Prozess, in dem die Inhalte einer formellen und inhaltlichen Prüfung unterzogen werden. Nachdem gegebenenfalls Korrekturen eingearbeitet worden sind, wird das Dokument für einen berechtigten Benutzerkreis freigegeben. Im Zuge der Nutzung der Informationsobjekte oder schlicht durch Zeitablauf kann eine Überarbeitung und Aktualisierung der Informationsobjekte notwendig werden. Die Nutzung liefert auch Hinweise auf ungedeckten Bedarf, der die Erstellung weiterer Informationsobjekte auslöst. Mit den aktualisierten und zusätzlich geschaffenen Informationsobjekten beginnt der Kreislauf erneut bei der Speicherung (vgl. Riempp 2004, S. 144–147). Die untere Abbildung zeigt, wie bei der Weitergabe des Content an andere Systeme und Nutzergruppen der Content den Kreislauf erneut durchläuft (vgl. Riempp 2004, S. 145).
In der Praxis ist Content-Management das am häufigsten genutzte Wissensmanagement-Werkzeug. Ein Grund für die Dominanz dieses Prozesses in den Wissensmanagement-Aktivitäten vieler Unternehmen ist sicher die Tatsache, dass die notwendigen Werkzeuge in größeren Unternehmen oft schon vorhanden sind, da mit ihnen die Unternehmensintranets aufgebaut wurden. Die Grundfunktionen für Content-Management sind in gängigen Open Source CMS, aber auch in verbreiteten Lösungen kommerzieller Anbieter*innen abgebildet (vgl. Riempp 2004, S. 150). Dabei sollte auch nicht übersehen werden, dass Unternehmen nicht gerne von ihren Mitarbeiter*innen abhängig sind. Unternehmen sind bestrebt diese Abhängigkeit aufzulösen, indem sie das Wissen ihrer Mitarbeiter*innen in den unternehmenseigenen Datenbeständen abbilden.
Management der Kompetenzen
Die Kompetenz eines Menschen ist die Summe seines impliziten und expliziten Wissens, welches in Form von mentalen Modellen gespeichert ist. Dieses Wissen besteht aus Kenntnissen und praktischen Fertigkeiten, die die Basis zur Handlungs- und Entscheidungsfähigkeit bilden. Neben der Fachkompetenz benötigen die Mitarbeiter*innen soziale Kompetenz im Umgang mit Kolleg*innen, Selbstkompetenz für zielstrebiges motiviertes Vorgehen und Führungskompetenz für die Leitung von Teams und Projekten. Ein Handlungsfeld des Kompetenzmanagements ist damit der*die einzelne Mitarbeiter*in. Darüber hinaus sind jedoch noch die auf Team-, Abteilungs- und Bereichsebene, sowie auch die über die gesamte Organisation aggregierten Kompetenzen zu betrachten (vgl. Riempp 2004, S. 151). Aufgabe des Kompetenzmanagements ist es, die im Unternehmen vorhandenen Kompetenzen sichtbar zu machen und gemäß den Zielen der Organisation zu entwickeln. Daraus resultieren die folgenden zwei Bereiche als Handlungsfelder des Kompetenzmanagements (vgl. Riempp 2004, S. 151):
- Transparenzierendes Kompetenzmanagement erfasst die Kompetenzen der Mitarbeiter*innen in Kompetenzprofilen. Dadurch wird die individuell vorhandene Kompetenz über Abteilungsgrenzen hinweg sichtbar.
- Entwickelndes Kompetenzmanagement hat die Aufgabe, die Differenz zwischen den vorhandenen Kompetenzen und den aktuell oder zukünftig benötigten Kompetenzen zu überwinden, indem es die Mitarbeiter*innen fördert und entwickelt.
Das transparenzierende Kompetenzmanagement bildet die Grundlage für das entwickelnde Kompetenzmanagement. Erst durch die Identifikation der individuellen Kompetenzen und durch deren Lokalisierung wird es möglich, die Kompetenzen zu aggregieren und damit eine Planung für die gesamte Organisation zu erstellen. Auf individueller Ebene wird das Kompetenzprofil als Grundlage für die Karriereplanung der Mitarbeiter*innen verwendet. Kompetenzmanagement ist primär die Aufgabe der Personalentwickler*innen und damit der HR-Abteilung. Ein*e Wissensmanagement- Verantwortliche*r muss die strategischen Aspekte in diesen Prozess einbringen und dafür sorgen, dass die Kompetenzprofile auch für andere Aufgaben verfügbar sind.
Das Kompetenzmanagement bedient sich eines Kompetenzrasters, um die Kompetenzen nach verschiedenen Dimensionen zu kategorisieren. Die Gliederung kann nach Fach- und Methodenkenntnis, Branchenrelevanz, Führungserfahrung und ähnlichen Aspekten erfolgen. Durch dieses Raster schafft eine Organisation eine Taxonomie für Kompetenzen. Diese sichert eine organisationsweit einheitliche Verwendung von Begriffen für Kompetenz. Die Ausprägung der individuellen Kompetenzen wird durch eine Kompetenzskala klassifiziert. Erst durch diese Skala werden die Bewertung und der Vergleich von Kompetenz möglich. Basierend auf der Bewertung können Entscheidungen über die Entwicklung eines*einer Mitarbeiter*in getroffen werden. Sie ermöglicht auch die Zuordnung von Aufgaben und durch Aggregation die langfristige Planung der Personalentwicklung. Durch die Zuordnung der im Kompetenzraster vorhandenen Kompetenzen und einer Einordnung der jeweiligen Ausprägung anhand der Skala wird das Kompetenzprofil eines*einer Mitarbeiter*in erstellt. Auf der Basis des Kompetenzrasters können Soll-Profile erstellt werden, die für das Recruiting, aber auch für die Karriereplanung verwendet werden. Die einzelnen Kompetenzprofile werden in Kompetenzverzeichnissen zusammengefasst, die für verschiedene Zielgruppen im Unternehmen zugänglich gemacht werden können. Eine zentrale Anwendung sind Yellow Pages, in denen Mitarbeiter*innen nach Kolleg*innen suchen können, die über Kompetenzen verfügen, die sie selber nicht besitzen. Bei der Zusammensetzung von Projektteams können die Profile verwendet werden, um das Team mit allen benötigten Kompetenzen auszustatten. Personalentwickler*innen können durch Aggregation der Profile Personalentwicklungsmaßnahmen planen und deren Erfolg der individuellen Weiterentwicklung anhand der Skalen messen (vgl. Riempp 2004, S. 152–153).
Dem Idealbild der Transparenzierung von Kompetenz stehen in der Praxis verschiedenste Widerstände entgegen. Mitarbeiter*innen möchten die Vergleichbarkeit mit Kolleg*innen vermeiden. Abteilungsleiter*innen möchten die Kompetenz ihrer Mitarbeiter*innen verstecken, damit diese nicht für andere Aufgaben im Unternehmen abgeworben werden. Auch Betriebsräte können Projekte wie Yellow Pages behindern oder sogar gänzlich zu Fall bringen. Es ist daher schon in der Planungsphase eines Kompetenzmanagement-Projektes notwendig, die Unterstützung aller Beteiligen zu gewinnen und sich auf eine gemeinsame Zielsetzung zu einigen.
Der Nutzen eines Kompetenzverzeichnisses hängt von der Aktualität seiner Inhalte ab. Wie das Content-Management benötigt daher auch Kompetenzmanagement einen Ablauf, der die einzelnen Aktivitäten koordiniert und die Verantwortlichkeiten regelt. Initial müssen die Kompetenzen durch die Mitarbeiter*innen selbst, oder durch deren Führungskräfte erfasst und bewertet werden. Nach der Erstellung müssen die Profile geprüft und gegebenenfalls zur Nutzung freigegeben werden. Personalentwickler*innen, Führungskräfte und Wissensmanager*innen aggregieren die Profile und stellen dem die Anforderungen gegenüber. Dadurch können sie die Differenz zwischen Bedarf und den vorhandenen Kompetenzen bestimmen und Entwicklungsmaßnahmen planen. Da Lernen nicht erzwungen werden kann, müssen die Entwicklungsmaßnahmen zwischen Führungskräften und Mitarbeiter*innen vereinbart werden. Dafür bieten sie die regelmäßigen Mitarbeitergespräche an, in denen Ziele vereinbart werden, bzw. deren Erreichung überprüft wird. Zu diesen Zielen zählen auch die Entwicklungsziele der Mitarbeiter*innen. Die Führungskräfte müssen demnach an verschiedenen Stellen des Prozesses beteiligt werden. Darauf muss auch auf Systemebene Rücksicht genommen werden, etwa bei der Authentifizierung und beim Design der Userinterfaces. Die individuelle Entwicklung wird durch Seminare, arbeitsintegriertes Lernen und E-Learning realisiert. Unter Umständen wird es auch notwendig, den Bedarf durch die Aufnahme neuer Mitarbeiter*innen zu decken. Bei der Bewertung und Auswahl der Bewerber*innen werden die Soll-Profile verwendet. Durch die Entwicklung verändern sich die Kompetenzen, weshalb die Profile der Mitarbeiter*innen stetig aktualisiert werden müssen. Akutalisierung kann auch durch das Entfernen von nicht mehr benötigten Kompetenzen aus dem Raster und durch Archivierung von Profilen ausgeschiedener Mitarbeiter*innen erfolgen (vgl. Riempp 2004, S. 154–155). Die Schritte des transparenzierenden und entwickelnden Kompetenzmanagements zeigt die folgende Abbildung (vgl. Riempp 2004, S. 154).
Management der Zusammenarbeit
Die Zusammenarbeit ist vom Standpunkt des Wissensmanagements aus betrachtet ein ganz zentrales Element. Sie dient einerseits dazu, das Wissen verschiedener Spezialist*innen zu kombinieren und damit Leistungen zu erstellen, die ein*e Einzelne*r nicht zustande brächte. Andererseits kann Wissen nur durch eigene Erfahrung erlernt werden. Beim gemeinsamen Arbeiten machen die Mitarbeiter*innen neue Erfahrungen und tauschen diese untereinander aus. Zusammenarbeit ist daher immer auch ein gemeinsamer Lernprozess. Dabei darf nicht übersehen werden, dass dieser Prozess auch dysfunktionale Lernerfahrungen hervorbringen kann. Die Rahmenbedingungen der Zusammenarbeit werden durch zwei Faktoren bestimmt (vgl. Riempp 2004, S. 158):
- Das Vorhandensein von physischen oder virtuellen Räumen ist notwendig, damit Mitarbeiter*innen miteinander in Kontakt treten können.
- Die Organisationsform legt die Kommunikationswege fest, in denen Informationen durch das Unternehmen fließen. In hierarchischen Organisationen fließt sie hauptsächlich entlang der Linie. Flache und flexible Strukturen sollen die Grenzen beseitigen und den Informationsfluss anregen. Durch die Orientierung an Prozessen sollen Kompetenzkonflikte und Abteilungsgrenzen überwunden werden, die den Wissensfluss unterbrechen.
Ergänzend zu diesen räumlichen, systemischen und organisatorischen Gestaltungsmöglichkeiten kann Wissen in temporären Formen der Zusammenarbeit ausgetauscht und entwickelt werden. Eine Möglichkeit zur Flexibilisierung von hierarchisch organisierten Organisationen ist die Projektorganisation. Projekte sind flache, unbürokratische Parallelorganisationen, in denen Informationen rasch transportiert und Wissen leicht zwischen den Mitarbeiter*innen ausgetauscht werden kann. Weniger stark formalisiert sind Communities und Netzwerke. Communities haben informellen Charakter und verfolgen die Ziele ihrer Mitglieder. Die Mitglieder von Communities of Interest finden sich aufgrund gemeinsamer Interessen zusammen, währen bei der Community of Practice der Austausch von Erfahrung aus gleichartigen Aufgabenfeldern im Vordergrund steht. Netzwerke werden gebildet, um die Ziele der Organisation zu verfolgen, etwa indem sie eine praktische Problemstellung bearbeiten. Auch hinsichtlich der Zusammenstellung der Teilnehmer*innen unterscheiden sich Netzwerke von Communities. In Netzwerken werden Personen mit ausgewiesener Expertise zusammengebracht. Das Ziel ist vorrangig die Lösung des Organisationsproblems und nicht die Lernerfahrung der Teilnehmer*innen (vgl. Riempp 2004, S. 158–159). Der geringe Formalisierungsgrad von Communities macht eine organisatorische Absicherung des generierten Wissens notwendig. Im Community-Management-Zyklus sind das, wie folgende Abbildung zeigt, die Aktivitäten Festhalten und Weitergabe der Ergebnisse und Maßnahmen, die den späteren Kontakt der Teilnehmer*innen aufrecht erhalten und damit die Weiterverwendung des generierten Wissens ermöglichen (vgl. Riempp 2004, S. 160).
Management der Orientierungsfunktion
Ab einer mittleren Organisationsgröße wächst die Zahl der Informationsobjekte, der Räume für Zusammenarbeit und der Kompetenzträger*innen rapide an. Um den Mitarbeiter*innen einen raschen Zugriff auf benötigte Informationen zu verschaffen, müssen die Inhalte durch Such- und Orientierungsfunktionen erschlossen werden. Voraussetzung für eine effiziente Suche ist eine einheitliche Terminologie. Diese dient dazu, die Inhalte einheitlich zu kategorisieren und definiert die Begriffe, anhand derer die Bestände durchsucht werden können. Nur wenn alle Mitarbeiter*innen Begriffe gleich interpretieren und verwenden, können sie die gesuchte Information aus den Beständen herausfiltern. Bei Unkenntnis der zur Klassifizierung verwendeten Fachbegriffe, oder bei unterschiedlicher Verwendung und Interpretation der Begriffe, werden die Mitarbeiter*innen die gesuchten Informationen nicht finden, auch wenn diese in den Systemen abgelegt wurden. Die Terminologie kann den Mitarbeitern*innen in einem Glossar zur Verfügung gestellt werden, das die zu verwendenden Begriffe erläutert. Eine andere Möglichkeit stellt die Taxonomie dar. Diese ordnet die Begriffe und zeigt ihre Beziehung untereinander auf. Während das Glossar primär dazu dient, die einheitliche Verwendung der Terminologie sicherzustellen, ermöglicht die Taxonomie die Klassifizierung und Strukturierung der Information.
Das Terminologie-Management ist damit ein zentraler Bestandteil des Managements der Orientierungsfunktion. Die Erstellung einer Terminologie muss mit der gesamten Organisation abgestimmt werden. Änderungsanforderungen, die bei der Nutzung entstehen, müssen konsolidiert und eingearbeitet werden. Mit der dabei entstandenen Terminologie können Informationsobjekte und Kompetenzprofile klassifiziert und strukturiert werden. Zur durchgängigen Orientierung für den*die Benutzer*in wird die Terminologie für die Strukturierung der Navigation verwendet. Durch die Indizierung der Informationsobjekte anhand der Terminologie wird die Suche für die von den Mitarbeiter*innen verwendeten Suchterme optimiert (vgl. Riempp 2004, S. 165–166). Wie die folgende Abbildung zeigt, kann der Aufbau der Terminologie durch Zukauf einer Branchenterminologie realisiert werden, wodurch die Aufbauphase stark verkürzt werden kann (vgl. Riempp 2004, S. 166):
Systemebene
Die Systemebene beschreibt die Struktur der Informationssysteme. Sie illustriert, wie mit Applikationen und den zugehörigen Daten Funktionen realisiert werden, um die durch die Strategie vorgegebenen Prozesse zu unterstützen. Im Idealfall werden diese Funktionen weitgehend abstrahiert und in einem Portal zusammengefasst. Die Funktionen werden dadurch nicht nach Anwendungen organisiert, sondern nach dem Verwendungszweck. Die Elemente der Informationssysteme können in Schichten angeordnet werden, die den steigenden Abstraktionsgrad repräsentieren. Außerdem können die Elemente und Funktionen anhand der Ebenen und Säulen der Architektur für integrierte Wissensmanagement-Systeme aufgegliedert werden, wie die untere Abbildung zeigt (Riempp 2004, S. 171).
Über der Hardwareschicht liegen die Datenspeicher der Anwendungen. In natürlich gewachsenen Umgebungen sind die Datenmodelle der einzelnen Anwendungen unterschiedlich, was einen direkten Austausch oder die gemeinsame Nutzung der Daten auf dieser Ebene verhindert. Über der Datenschicht ist daher eine Integrationsschicht angeordnet, in der die Daten aus den unterschiedlichen Quellsystemen aufbereitet werden. Die darüber liegende Applikationsschicht verwendet die integrierten Daten, um eine höhere Informationsqualität zu erzielen. Über den Anwendungen liegt eine weitere logische Schicht, in der ein Ordnungsrahmen über die zu präsentierenden Informationsobjekte und Funktionen gelegt wird. Die einzelnen Funktionen werden im Idealfall in einem Portal zusammengefasst, wobei die Benutzer*innen abhängig von ihrer Rolle nur jene Funktionen sehen, die sie tatsächlich benötigen. Die Funktionen können noch weiter in primäre und sekundäre Funktionen unterteilt werden. Die primären Funktionen realisieren die Unterstützung der Kernprozesse, während die sekundären Funktionen der Administration der Systeme dienen (vgl. Riempp 2004, S. 170–171). In den folgenden Abschnitten werden die zentralen Funktionen der Systemebene, gegliedert nach den Säulen „Content“, „Kompetenz“ und „Zusammenarbeit“, genauer vorgestellt.
Content-Management-Systeme
Gegenstand des Content-Managements sind Informationsobjekte im Sinne von elektronischen Abbildungsversuchen des in mentalen Modellen gespeicherten Wissens. Die Systemebene stellt Funktionen für die verschiedenen Phasen (Erstellung, Syndizierung, Klassifizierung, Speicherung, Freigabe, Bereitstellung, Überarbeitung und Nutzung) des Content-Lebenszyklus zur Verfügung. Diese primären Funktionen werden durch sekundäre Funktionen ergänzt. Dazu zählt beispielsweise die Archivierung obsoleter Informationsobjekte, Workflow-Management, Erinnerungsfunktionen für die Überarbeitung und Kontrolle der Aktualität usw. Durch Logging und Reporting können die Zugriffe auf die Informationsobjekte erfasst werden. Anhand der Zugriffsstatistik können Rückschlüsse auf die Nutzung der Inhalte gezogen werden. Ein kritischer Aspekt ist die leichte Bedienbarkeit und die Integration der Funktionen. Das Design der Benutzerschnittstellen muss an dieser Anforderung ausgerichtet werden und damit schon vor der Implementierung erfolgen. Andernfalls besteht die Gefahr, dass das Systemdesign die Möglichkeiten der später entwickelten Benutzeroberfläche einschränkt. Anwender*innen müssen die Funktionen dann so benutzen, wie sie das System bereitstellt, anstatt dass das System den*die Anwender*in dort unterstützt, wo er*sie Hilfe benötigt. Im Idealfall können die Anwender*innen für die Erstellung und Pflege der Inhalte die gewohnten Benutzeroberflächen benutzen, wie etwa Office Anwendungen. Content-Management-Systeme müssen daher in der Lage sein, die gängigsten Dateiformate zu lesen, um den Inhalt für die Indizierung und für andere Darstellungsformen zu erschließen.
Der Ordnungsrahmen hilft dabei, die Informationsobjekte einheitlich zu strukturieren und für die schnelle Navigation und Suche vorzubereiten. Das wird durch einheitliche Vorlagen und Datenstrukturen, durch eine Taxonomie für die Klassifizierung und durch Suchindizes erreicht. Die durchgängige Datenstruktur sorgt dafür, dass ein einheitliches Subset an Metainformationen zur Verfügung steht, die um objekt-spezifische Metainformationen ergänzt werden. Ein Dokument und ein Foto teilen sich Metadaten wie den*die Ersteller*in und das Erstellungsdatum, haben aber auch individuelle Metadaten wie Auflösung, GPS Daten des Aufnahmeortes beim Foto, oder Anzahl der Zeichen und Schlagworte beim Dokument. Auch auf der Ebene der Metadaten ist auf Integration und Benutzerfreundlichkeit zu achten. Daten zu Ersteller*in und Bearbeiter*in können ebenso wie Zeitstempel der Bearbeitungen automatisch aufgezeichnet werden. Durch die Struktur des CMS können Vorschläge für Kategorien und Schlagworte vorgeschlagen werden, sodass der*die Benutzer*in nicht sämtliche Metadaten eingeben muss. Zwischen der Anwendungsschicht und der Datenschicht ist eine weitere Integrationsebene, welche die Daten der einzelnen Anwendungen und jene aus weiteren internen wie externen Quellen zusammenfasst (vgl. Riempp 2004, S. 172–179). Die folgende Abbildung zeigt die Architektur für Content-Management-Systeme im Detail (Riempp 2004, S. 173).
Kompetenzmanagement-Systeme
Mittels der Kompetenzmanagement-Systeme werden Funktionen für die zentralen Aufgaben Transparenzierung und Entwicklung realisiert. Transparenzierendes Kompetenzmanagement identifiziert die Wissensträger*innen und macht deren Kompetenz in der Organisation sichtbar, indem die individuellen Kompetenzen der Mitarbeiter*innen in Profilen erfasst werden. Auf dieser Grundlage kann eine Suchfunktion für Kompetenzen realisiert werden, die für die Zusammenstellung von Projektteams, oder für die Suche nach einem Kollegen mit bestimmten Fähigkeiten in Yellow Pages genutzt werden kann. Durch die Aggregation der Profile und Aufbereitung der Abweichungen kann die Personalabteilung Entwicklungsmaßnahmen planen oder sich für den Zukauf von fehlender Kompetenz am Arbeitsmarkt entscheiden. Über die Planungsunterstützung hinaus unterstützt die Systemebene interne Entwicklungsmaßnahmen durch E-Learning-Anwendungen und Community-Funktionen, die eine Koordination und Zusammenarbeit der Mitarbeiter*innen im Lernprozess ermöglichen.
Die oben genannten Funktionen werden durch sekundäre Funktionen unterstützt, die analog zu jenen des Content-Managements administrative Aufgaben abdecken. Workflow-Management stellt die zeitgerechte Aufgabenerfüllung durch die beteiligten Mitarbeiter*innen sicher. Durch die Planung von Kontrollterminen werden die Mitarbeiter*innen regelmäßig an die Aktualisierung, bzw. Archivierung der Profile erinnert. Der*die Kursleiter*in einer E-Learning-Veranstaltung kann den Teilnehmer*innen Zugriff auf Lernunterlagen geben, für Foren und Wikis freischalten, Aufgaben publizieren und deren Abgabe überwachen. Die Authentifizierung und Rechtevergabe sind aufgrund der sensiblen Personaldaten zentrale Funktionen, die von einem Kompetenzmanagement-System geboten werden müssen. Können diese nicht fein abgestuft werden, können die Profilinformationen nicht ausreichend differenziert werden, was eine breite Nutzung im Unternehmen verhindert. Den Ordnungsrahmen des Kompetenzmanagements bildet die Taxonomie als Grundlage für Indizierung und Strukturierung der Profile und E-Learning-Inhalte, sowie das Kompetenzraster in Kombination mit den Kompetenzskalen zur Erfassung der Kompetenzprofile (vgl. Riempp 2004, S. 181–188).Folgende Abbildung zeigt die Architektur für Kompetenzmanagement-Systeme im Detail (Riempp 2004, S. 182).
Community-Management-Systeme
Die Aufgabe von Community-Management-Systemen ist die Bereitstellung von virtuellen Räumen für die Zusammenarbeit. In diesen können die Community-Mitglieder Informationen mittels synchroner oder asynchroner Kommunikation austauschen und gemeinsam an der Erfüllung von Aufgaben arbeiten. Die Resultate der Zusammenarbeit werden in elektronischer Form gespeichert, was durch die Integration der Content-Management-Funktionen erreicht wird.
Zu den primären Funktionen gehört die Suche nach kompetenten Personen, die Kontaktaufnahme, die Zusammenarbeit zur Erfüllung von Aufgaben, die Speicherung der erstellten Informationsobjekte, sowie die Navigation und Suche in den Informationsbeständen. Zu den aus den anderen Säulen bekannten sekundären Funktionen kommt die Administration der virtuellen Räume hinzu, mit der neue Räume angelegt und Berechtigungen für den Zutritt vergeben werden. Spezifisch für Community-Management-Systeme sind Anwendungen für die direkte Kommunikation (Video Conferencing, Instant Messaging, Application Sharing), wie für die indirekte Kommunikation (E-Mail, Foren, Wikis) sowie Planungsinstrumente (Gruppenterminplanung und Ressourcenplanung). Das Telefon wird durch Anwendungen wie Instant Messaging, Desktop und Application Sharing und Video Conferencing weitgehend verdrängt. Durch die Integration der Systeme sieht der*die Benutzer*in den Verfügbarkeitsstatus des*der Kommunikationspartner*in und kann den geeigneten Kanal wählen.
Der entscheidende Faktor vom Wissensmanagement-Standpunkt aus gesehen ist die höhere Informationsqualität, die durch Video-Konferenzen und die Desktopfreigabe erreicht wird. Die Teilnehmer*innen nehmen die Informationen mit mehreren Sinnen war und erhalten zusätzliche Kontextinformationen durch den Klang der Stimme, den Ausdruck und die Gestik der Kommunikationspartner*innen (vgl. Riempp 2004, S. 189–197). Die obere Abbildung zeigt die Architektur für Community-Management-Systeme im Detail (Riempp 2004, S. 191).
Systeme für Orientierung und Suche
Navigation und Suche sind zentrale Bausteine eines integrierten Wissensmanagement-Systems. Die Orientierungsfunktion erschließt die Inhalte der Säulen „Content“, „Kompetenz“ und „Zusammenarbeit“ und gehört dort zu den primären Funktionen. Mit ihrer Hilfe finden die Mitarbeiter*innen rasch jene Informationen oder Ansprechpartner*innen, die sie gerade im Arbeitsprozess benötigen. Nur durch eine durchdachte Ausgestaltung der Orientierungsfunktion kann eine effiziente Nutzung des im Unternehmen verfügbaren Wissens sichergestellt werden. Aus diesem Grund wird sie in der Architektur als eigene Säule dargestellt, obwohl sie ohne die Integration in die anderen Säulen nicht existieren würde. Durch einen einheitlichen Seitenaufbau wird die Navigation für den*die Anwender*in erleichtert, da er*sie sich beim Wechsel zwischen verschiedenen Aufgaben nicht umgewöhnen muss. Gleichermaßen wichtig ist, dass sich das Design an gängigen Designstandards orientiert. Die Navigation verteilt sich in der Regel auf eine Top Level Navigation am oberen Rand und eine Second Level Navigation am linken Rand. Damit bleibt für die Anwendungen nur der Raum unterhalb und rechts dieser Navigationsframes frei. Unterhalb der Top Level Navigation wird auf Webseiten oft noch eine Orientierungshilfe durch sogenannte Breadcrumbs angeboten. Generell gilt für die Gestaltung eines webbasierten Portals, dass die Konventionen des Webdesigns eingehalten werden sollten, da die Anwender*innen sich dadurch nicht umgewöhnen müssen.
Zu den primären Funktionen gehört neben Navigation und Suche die Personalisierung. Diese wird durch Benutzerrollen realisiert, die mit der Hilfe von User-Profiling definiert werden. Abhängig von ihrer Rolle erhalten Benutzer*innen nur auf jene Informationen und Funktionen Zugriff, für die sie berechtigt sind, bzw. die sie für die Erfüllung ihrer Aufgabe benötigen. Der Zugang wird nicht nur wegen sensibler Daten beschränkt, sondern auch, um die Komplexität der Systeme für den*die Benutzer*in zu reduzieren und ihn*sie nicht mit Dingen zu belasten, die er*sie für die Erfüllung seiner*ihrer Aufgaben nicht benötigt. Zur weiteren Erleichterung für den*die Benutzer*in sollten die Funktionen in Portalen zusammengefasst und einheitlich präsentiert werden. Die Funktionen werden durch den Ordnungsrahmen in eine logische Struktur gebracht und im Portal angeordnet. Auf der Anwendungsebene dieser Säule sind besonders die Portal Server hervorzuheben, mit deren Hilfe sich die in Portlets gekapselten Funktionen organisieren lassen (vgl. Riempp 2004, S. 198–204). Die erste der beiden Abbildungen zeigt die Architektur für Orientierungsmanagement-Systeme im Detail (Riempp 2004, S. 199). Die Orientierungsfunktion kann durch visuelle Hilfsmittel angereichert werden, mit denen die Zusammenhänge zwischen den Informationen dargestellt werden.
Taxonomien lassen sich mit Topic Maps darstellen, die die Beziehungen zwischen den Termen aufzeigen. Einen ähnlichen Ansatz verfolgt Mind Mapping, mit dem Gedanken in eine Struktur gebracht werden können. Zur Darstellung komplexer Konzepte werden Concept Maps verwendet. Die obere Abbildung zeigt einen Ausschnitt einer Concept Map zum Thema Mapping (vgl. Döbeli Honegger).
Organisation und Kultur
Die Aufgaben in Wissensmanagement-Prozessen werden in Rollenbündeln zusammengefasst. Abhängig von der Intensität, mit der Wissensmanagement betrieben wird, können die Rollen zur Ausbildung von Positionen führen, die ausschließlich Wissensmanagement-Aufgaben übernehmen, oder als zusätzliche Aufgabe von Personen in der bestehenden Organisation übernommen werden. Die Rollen können anhand der Architektur in einer Ebene und einem Handlungsfeld positioniert werden, wie die untere Abbildung zeigt (Riempp 2004, S. 211).
Der Chief Knowledge Officer hat die Aufgabe, Wissensmanagement strategisch in der Organisation zu verankern. Er tut dies, indem er dem Führungssystem Wissensziele und ein Messsystem zur Verfügung stellt. Wissensarbeiter*innen nutzen das Wissensmanagement-System zur Erledigung ihrer Aufgaben in den Geschäftsprozessen. Auch bei der Wissensnutzung entstehen neue Informationsobjekte. Die
Wissenssarbeiter*innen sind daher nicht nur Konsument*innen von Information, sondern auch aktiv am Wissensmanagement-Prozess beteiligt. Sponsor*innen übernehmen die Mittlerrolle zwischen Strategie- und Prozessebene. Sie initiieren neue Projekte und statten diese mit den notwendigen finanziellen und personellen Ressourcen aus. Expert*innen stellen ihre Kompetenz bei Bedarf zur Verfügung. Wenn sie ihr Wissen in Informationsobjekten festhalten, übernehmen sie die Autorenrolle. Themenverantwortliche sind für bestimmte Wissensgebiete zuständig und verfolgen selbständig deren Weiterentwicklung. Qualitätsmanager*innen sichern die Einhaltung der Standards, beispielsweise hinsichtlich des Informationsgehalts von Dokumenten. Researcher*innen suchen im Auftrag der Wissensnutzer*innen in internen und externen Quellen nach Information und bereiten diese auf. Knowledge Networker*innen initiieren die Bildung von Netzwerken und Communities. Ähnlich wie Sponsor*innen müssen sie über gute Kontakte und Reputation verfügen, um Teilnehmer*innen zu gewinnen. Moderator*innen übernehmen die Leitung der Communities. Sie helfen dabei, Konflikte zu bearbeiten und Themen weiterzuentwickeln. Auch Boundary Spanner müssen über gute Kontakte verfügen. Ihre Aufgabe ist die Verbindung der einzelnen Communities und Netzwerke. Durch sie knüpfen Mitarbeiter*innen Kontakte im gesamten Unternehmen, was den informellen Wissensfluss anregt. Die Kompetenz der Mitarbeiter*innen wird durch die Personalentwickler*innen gemäß den strategischen Zielen entwickelt und durch Gutachter*innen gemessen und beurteilt. Terminolog*innen pflegen die Taxonomie und sorgen für eine einheitliche Verwendung der Begriffe in allen Unternehmensbereichen.
Auf der Systemebene gibt es verschiedene Rollen, die Unterstützungsleistungen erbringen. Durch diese Einteilung ist jedoch nicht festgelegt, dass diese Rollen in eigenständigen Stellen zusammengefasst sind. Jede dieser Rollen kann von Mitarbeiter*innen zusätzlich zu ihren Aufgaben in den Geschäftsprozessen übernommen werden. Content Manager*innen veröffentlichen Informationsobjekte und sind bei der Bearbeitung und Konvertierung behilflich. Designer*innen erarbeiten ein einheitliches Erscheinungsbild für Dokumente und Benutzeroberflächen. Redakteur*innen überarbeiten Informationsobjekte für die Publikation in internen und externen Systemen. Template-Redakteur*innen erstellen Vorlagen für Dokumente und Webseiten. Archivar*innen müssen veraltete Informationen aus dem System nehmen und ablegen. Die Zusammenarbeit in Projekten und Communities muss durch Project-Officer mittels Terminplanung und Dokumentation unterstützt werden. Skill Manager*innen erstellen ein Kompetenzraster, das die strategisch wichtigen Kompetenzen erfasst. In Zusammenarbeit mit den Gutachter*innen entwickeln sie eine Skala zur Messung der individuellen Ausprägungen von Kompetenz. Webmaster*innen pflegen die Infrastruktur für die Bereitstellung der Portale. Search Manager*innen betreiben Suchmaschinen und optimieren deren Effizienz durch fortlaufende Entwicklung der Suchalgorithmen. Portal-Architekt*innen entwerfen die Struktur und das Layout, sowie die Navigation der Portale (vgl. Riempp 2004, S. 83–84; Riempp 2004, S. 147; Riempp 2004, S. 155; Riempp 2004, S. 160; Riempp 2004, S. 166–167).
Die Kultur wird in der Architektur für integrierte Wissensmanagement-Systeme als Rahmen für alle anderen Elemente des Systems dargestellt. System, Organisation, Prozesse und Systeme sind gleichsam in das kulturelle Umfeld eingebettet und in ihrer Ausgestaltung durch die Kultur vorbestimmt. Die Kultur findet ihren Ausdruck im Leitbild und den Zielen einer Organisation. Sie ist die Grundlage für das vorherrschende Menschenbild, Annahmen über die Motivation der Mitarbeiter*innen und die damit verbundenen Führungsgrundsätze. Die Aufnahme neuen Wissens durch Lernen und die Bereitschaft Wissen mit anderen zu teilen, hängen von den Einstellungen der Mitarbeiter*innen ab, die durch die Normen und Werte der Unternehmenskultur maßgeblich beeinflusst werden. Eine für Wissensmanagement förderliche Kultur beruht auf den Werten Vertrauen, Offenheit, Fairness, Gegenseitige Anerkennung und Motivation (vgl. Riempp 2004, S. 212–213).
Um die angestrebte Kultur in einem Unternehmen zu schaffen, können die Werte durch verschiedene Maßnahmen beeinflusst werden, einer direkten Steuerung entzieht sich die Kultur aufgrund ihres diffusen Charakters. Die Führungsorganisation ist der zentrale Ansatzpunkt für Gestaltungsmaßnahmen, da sie die Beziehung der Mitarbeiter*innen zum*zur Vorgesetzten und dem durch ihn*sie repräsentierten Unternehmen bestimmt. Qualifizierte Mitarbeiter*innen möchten an den Führungsentscheidungen beteiligt werden, daher ist die Führung nach den Grundsätzen der Partizipation zu gestalten. Dies kann beispielsweise im Rahmen von Mitarbeitergesprächen geschehen, in denen Ziele vereinbart und die Erreichung vergangener Zielvereinbarungen beurteilt werden. Die Motivation zur Erreichung von Zielen wird durch Anreiz Systeme unterstützt, die monetäre und non-monetäre Belohnungen versprechen. Die Gestaltung der Systeme und Prozesse, wie auch der Räume für Zusammenarbeit ist ebenfalls Ausdruck der Kultur. Sie spiegelt das vorherrschende Menschenbild und legt fest, wie und in welchem Ausmaß Kommunikation stattfinden kann. Neben diesen Aspekten der formalen Organisation kann die Kommunikation auch durch Communities und Netzwerke stimuliert werden, oder durch Veranstaltungen wie World-Cafés und Wissensmärkte (vgl. Riempp 2004, S. 213–215).
Einführung von Wissensmanagement-Systemen
Entsteht in einem Unternehmen der Bedarf für Wissensmanagement, liegt das meist am ineffizienten Umgang mit Wissen. Dieser sorgt bei Mitarbeitern und Führungskräften zunehmend für Unzufriedenheit. Wenn der Leidensdruck zu groß wird, werden Mittel bewilligt, um die Lage zu verbessern. In dieser Situation ist die Gefahr groß, dass voreilige und punktuelle Maßnahmen gesetzt werden, die keine nachhaltige Wirkung erzielen. Dies ist nur durch ein strukturiertes und überlegtes Vorgehen zu erreichen, das die Gesamtzusammenhänge im Blickfeld behält. Wissensmanagement erfordert daher die Unterstützung des Top Managements, da die Wissensstrategie gemeinsam mit der Unternehmensstrategie geplant werden muss. Initiativen auf darunter liegenden Managementebenen fehlt es an dieser strategischen und ganzheitlichen Perspektive, daher sind Einzelinitiativen aus der Sicht der Gesamtorganisation weniger wirkungsvoll. Es ist jedoch ebenso notwendig, sich die Akzeptanz der späteren Benutzer zu sichern. Die Projekte müssen daher in kurzer Zeit sichtbare Erfolge erzielen, etwa indem sie eine für den Benutzer wahrnehmbare Arbeitserleichterung bewirken. Für die Einführung von Wissensmanagement bedeutet das, dass die Planung Top-Down erfolgen muss. Beim Implementieren einzelner Maßnahmen sollte bei den dringendsten Problemen begonnen werden. Durch deren Beseitigung gewinnt man die Akzeptanz und das Vertrauen der Mitarbeiter. Auf diesem Weg wird das Wissensmanagement-System in kleinen Schritten aufgebaut und erweitert. Jeder einzelne Schritt folgt jedoch der vorgegebenen Linie und trägt zur Gesamtstrategie bei.
Bei der Einführung von Wissensmanagement ist jedoch nicht nur darauf zu achten, dass alle Maßnahmen mit den Unternehmenszielen abgestimmt werden, sondern dass diese auch mit der vorherrschenden Kultur harmonieren müssen. In einer Kultur, in der schriftliche Dokumentation und deren Publikation durch Anreize und einen Zuwachs an Ansehen begünstigt werden, muss der Schwerpunkt auf der Säule „Inhalt und Kontext“ liegen. Wenn die vorherrschende Kultur dagegen die Kommunikation und den direkten Austausch von Wissen bevorzugt, müssen die Maßnahmen primär entlang der Säule „Zusammenarbeit“ stattfinden. In Organisationen mit einem hohen Expertenanteil stehen die persönlichen Entwicklungsmöglichkeiten der Mitarbeiter im Vordergrund. Die Wissensmanagement-Aktivitäten müssen dann verstärkt beim Kompetenzmanagement ansetzen (vgl. Riempp 2004, S. 215–216).
Nachdem die Strategie und die vorrangigen Handlungsfelder feststehen, müssen Maßnahmen für die einzelnen Wissensziele überlegt werden. Die Reihenfolge, in der diese Ziele verfolgt werden, ist zumindest bei der Einführung von Wissensmanagement nicht beliebig. Wissensmanagement- Projekte sollen Defizite im Umgang mit Wissen beseitigen (vgl. dazu die strategischen Ziele in Abschnitt 4.7.1). An erster Stelle steht dabei oft das Problem, dass es keinen Überblick über Kompetenzen und Fähigkeiten der Mitarbeiter und die Informationsbestände gibt. Das erste Ziel ist es daher, Transparenz hinsichtlich des vorhandenen Wissens zu schaffen. Mit dem notwendigen Überblick über das vorhandene Wissen können im nächsten Schritt Maßnahmen zur Förderung des Austausches und der Entwicklung von Wissen gesetzt werden. Die Sicherstellung der Effizienz von Wissensmanagement kann erst nach der Etablierung von Wissensmanagement im Unternehmen gemessen werden. Die Voraussetzungen dafür müssen allerdings bereits bei der Konzeption geschaffen werden, da ohne geeignete Indikatoren und Messsysteme eine spätere Bewertung nicht möglich ist. Der Ablauf bei der Umsetzung der Wissensziele ist daher nicht so linear, wie in diesem Ablauf beschrieben. Tatsächlich werden die einzelnen Ziele sowohl zyklisch, als auch gleichzeitig verfolgt, da die Maßnahmen zu den Säulen der Architektur in mehreren parallelen Projekten implementiert werden.
Wiederholungsaufgaben
- Beschreiben Sie Hindernisse für den Wissensaustausch.
- Nennen Sie die Voraussetzungen für Kommunikation in Stichworten.
- Welche Handlungsfelder für Wissensmanagement leiten sich aus dem Kommunikationsmodell für den Wissensaustausch ab?
- Beschreiben Sie kurz die drei Ebenen für Wissensmanagement.
- Geben Sie Beispiele für die vier grundlegenden Wissensziele im Handlungsfeld Kompetenz.
- Beschreiben Sie die Content-Management-Aktivitäten anhand des Content-Lebenszyklus.
- Beschreiben Sie die zwei wesentlichen Bereiche des Kompetenzmanagements.
- Beschreiben Sie Möglichkeiten zur Unterstützung und Förderung der Zusammenarbeit.
- Beschreiben Sie das Management der Orientierungsfunktion.
- Diskutieren Sie kritische Aspekte bei der Implementierung eines Content-Management-Systems.
- Nennen Sie zwei Systeme, die das Kompetenzmanagement unterstützen und beschreiben Sie deren Funktionen kurz in Stichworten.
- Beschreiben Sie, welche Funktionen von Community-Management die Zusammenarbeit räumlich getrennter Mitarbeiter*innen ermöglichen.
- Beschreiben Sie die Vorteile der Personalisierung von Informationssystemen.
- Beschreiben Sie anhand eines Beispiels, wie sich organisatorische Maßnahmen auf die Kultur auswirken.
- Beschreiben sie grob die Abfolge bei der Einführung von Wissensmanagement.
Lösungen
Beschreiben Sie Hindernisse für den Wissensaustausch.
Voraussetzung für erfolgreiche Kommunikation ist eine intakte Beziehungsebene. Positive Emotionen begünstigen die Bereitschaft zur Wissensteilung, während Abneigung und Ängste die Kommunikation im Keim ersticken. Das soziale Umfeld beeinflusst die Einstellungen der Kommunikationspartner*innen und damit indirekt die Relevanzkriterien für Information und welcher Wert dem Austausch und der gemeinsamen Nutzung von Wissen beigemessen wird. Wenn der*die Sender*in nicht in der Lage ist, sein*ihr Wissen zu artikulieren, scheitert der Wissensaustausch. Andererseits scheitert er auch, wenn die Inhalte gut aufbereitet sind, aber bei dem*der Empfänger*in nicht auf Interesse stoßen. Annahmen des*der Sender*in über die Aufnahmefähigkeit des*der Empfänger*in und dessen*deren tatsächliche Aufnahmefähigkeit entscheiden über die übertragenen Inhalte. Der Wissensaustausch kann daher sowohl daran scheitern, dass zu wenig Information übertragen wird, als auch durch die mangelnde Interpretationsleistung des*der Partner*in.
Nennen Sie die Voraussetzungen für Kommunikation in Stichworten.
Raum für Kommunikation, gemeinsame Sprache und übereinstimmende Terminologie.
Welche Handlungsfelder für Wissensmanagement leiten sich aus dem Kommunikationsmodell für den Wissensaustausch ab?
Wissen muss für den Austausch expliziert und in die Form von Inhalt und Kontextinformation gebracht werden. Letztere bereichern den Inhalt mit zusätzlichen Informationen und erleichtern damit die Interpretation der Inhalte. Inhalt und Kontext werden als Content bezeichnet.
Kompetenz ist die Summe des Wissens und der Fähigkeiten der Mitarbeiter*innen. Kompetenz ist daher die Basis für den Austausch von Wissen.
Wissensarbeit und Wissensschaffung im Unternehmenskontext setzt die Zusammenarbeit mit anderen voraus.
Kultur wirkt auf das soziale Umfeld und auf Einstellungen und Emotionen der Mitarbeiter*innen. Damit bestimmt sie Art und Umfang der Kommunikation und des ausgetauschten Wissens.
Beschreiben Sie kurz die drei Ebenen für Wissensmanagement.
Auf der Strategieebene werden die Grundlagen geschaffen, damit Wissensmanagement die Geschäftsprozesse optimal unterstützen kann. Dies wird durch den Abgleich der geschäftlichen Ziele und Strategien mit jenen von Wissensmanagement erreicht. Nur durch die Top-Down Planung passen sich die Wissensmanagement-Prozesse und -Systeme später in die bestehende Umgebung ein. Die zweite Top-Management-Aufgabe ist der Entwurf eines Mess- und Bewertungssystems. Damit wird das darunter liegende Führungssystem mit den notwendigen Kontroll- und Steuerungsinstrumenten ausgestattet.
Die Wissensmanagement-Prozesse unterstützen die Geschäftsprozesse, indem sie den Mitarbeiter*innen das notwendige Wissen situations- und zeitgerecht zur Verfügung stellen. Bestandteile des Wissensmanagement-Prozesses sind das Lokalisieren und Erfassen von Informationsobjekten und Wissensträger*innen, der Austausch von Wissen, die Wissensentwicklung und die effiziente Nutzung von Wissen.
Die Systemebene stellt Infrastruktur, Datenbanken und Systeme bereit. Darauf werden Anwendungen betrieben, die Funktionen zur Erledigung der Aufgaben in den Geschäfts- und Unterstützungsprozessen bereitstellen. CMS verwalten die Inhalte und bereiten diese für die effiziente Navigation und Suche auf. HR Software erfasst die Kompetenzen der Mitarbeiter*innen, die in Verzeichnissen veröffentlicht werden, um die Suche nach kompetenten Mitarbeiter*innen und Kolleg*innen zu ermöglichen. Groupware und Community-Management-Systeme unterstützen die Zusammenarbeit. Die Kommunikation wird durch E-Mail, Instant Messaging und Video Conferencing unterstützt.
Geben Sie Beispiele für die vier grundlegenden Wissensziele im Handlungsfeld Kompetenz.
Transparenzierung: Veranstaltung von Wissensmärkten zur Sichtbarmachung der Kompetenz einzelner Mitarbeiter*innen und von Abteilungen.
Förderung des Austausches: Einrichten von Qualitätszirkeln und Erfahrungsaustauschgruppen.
Entwicklung: Etablieren eines E-Learning-Systems zur Vermittlung von unternehmensspezifischem Anwendungs- und Prozesswissen.
Sicherstellen der Effizienz: Durchführen von Mitarbeiterbefragungen zur Ermittlung der Zufriedenheit hinsichtlich Führung und Weiterbildung.
Beschreiben Sie die Content-Management-Aktivitäten anhand des Content-Lebenszyklus.
CMS unterstützen Anwender*innen bei der Erstellung und gemeinsamen Bearbeitung von Dokumenten. Diese werden mit Metadaten angereichert, klassifiziert und strukturiert abgelegt. Vor der Freigabe für einen größeren Benutzerkreis werden die Inhalte redaktionell überprüft. Danach werden die Dokumente gegebenenfalls noch einmal überarbeitet oder gleich publiziert. Damit steht der Inhalt zur allgemeinen Nutzung bereit. Aus dieser kann sich der Bedarf für weitere Überarbeitungen, Aktualisierungen und Ergänzungen ergeben. Durch die Weitergabe der Inhalte an andere Systeme werden größere Nutzerkreise erschlossen. Diese stellen andere Anforderungen an die Informationen. Regelmäßig wird man der breiteren Öffentlichkeit außerdem bestimmte Informationen vorenthalten wollen, etwa sensible Daten oder geschäftskritische Informationen. Die Inhalte müssen daher überarbeitet werden, wodurch der Zyklus aus Speichern und Klassifizieren, Prüfen und Freigeben, Publizieren, Nutzen und Überarbeiten erneut durchlaufen wird. Verbunden mit der Aktualisierung der Inhalte ist die Archivierung obsoleter Dokumente.
Beschreiben Sie die zwei wesentlichen Bereiche des Kompetenzmanagements.
Das transparenzierende Kompetenzmanagement erfasst die in der Organisation vorhandenen Kompetenzen der Mitarbeiter*innen anhand eines einheitlichen Rasters, in dem alle für das Unternehmen maßgeblichen Kompetenzen aufgeführt sind. Die Bildung von Skalen ermöglicht die Messung der individuellen Ausprägungen. Auf dieser Grundlage kann für jede*n Mitarbeiter*in ein Kompetenzprofil erstellt werden. Dieses ist die Basis für die Lokalisierung des Wissens im Unternehmen. Durch Aggregation der Profile wird das gesamte im Unternehmen verfügbare Wissen erfasst und kann den Wissenszielen gegenübergestellt werden. Die Abweichung zwischen den beiden Größen bildet die Grundlage für Maßnahmen des entwickelnden Kompetenzmanagements. Auf der Organisationsebene geht es um die Entwicklung der aggregierten Größe Mitarbeiterkompetenz. Dazu gehört neben der Personalentwicklung auch die Aufnahme neuer Mitarbeiter*innen, die anhand von Sollprofilen beurteilt werden. Auf der individuellen Ebene müssen die Kompetenzen der Mitarbeiter*innen durch Personalentwicklung gefördert werden.
Beschreiben Sie Möglichkeiten zur Unterstützung und Förderung der Zusammenarbeit.
Das Ausmaß der Zusammenarbeit wird durch die Organisation vorgegeben. Die Orientierung an Prozessen und die Projektorganisation begünstigen die unmittelbare Zusammenarbeit und verkürzen die Kommunikationswege. Durch bauliche Maßnahmen kann ein offenes Umfeld mit Räumen zur Begegnung und Zusammenarbeit geschaffen werden. Große Distanzen zwischen den Mitarbeiter*innen können durch virtuelle Räume der Zusammenarbeit überbrückt werden. Community-Management-Systeme erleichtern die Kommunikation, Tracken offener Aufgaben und unterstützen die Workflows. Communities und Netzwerke bringen Mitarbeiter*innen auf der Basis gemeinsamer Interessen oder Aufgaben zusammen. Dort können Sie ihre Erfahrungen einbringen und von denen der anderen Teilnehmer*innen profitieren. Netzwerke verbinden ihre Mitglieder über längere Zeiträume hinweg. Damit sichern sie spätere Zugriffsmöglichkeiten auf benötigtes Wissen.
Beschreiben Sie das Management der Orientierungsfunktion.
Die Klassifizierung und Strukturierung von Inhalten setzt einen durchgängigen Gebrauch von Begriffen voraus. Zu diesem Zweck wird eine Terminologie erstellt, deren Verwendung für die Mitarbeiter*innen verbindlich ist. Die einzelnen Terme werden in einem Glossar erläutert, damit deren Bedeutung von allen Mitarbeiter*innen gleich interpretiert wird. Eine Taxonomie bringt die Terme in eine hierarchische Ordnung und ermöglicht damit eine Klassifizierung und Strukturierung von Information. Dies ist die Basis für die Navigation und die Suche, da die Mitarbeiter*innen bei der Erstellung und Ablage die gleichen Begriffe verwenden, wie später bei der Suche.
Diskutieren Sie kritische Aspekte bei der Implementierung eines Content-Management-Systems.
Im Hinblick auf die Unterstützungsfunktion muss der Zugriff für den*die Anwender*in schnell und einfach sein. Die Benutzeroberfläche muss sich an der Logik der Anwender*innen orientieren, damit diese an jenen Stellen Unterstützung bekommen, wo sie sie brauchen. Die Suche nach Information ist ein zeitraubender Prozess – Zeit, die für die Erledigung der Aufgaben in den Geschäftsprozessen abgeht. Eine effiziente Suche und Orientierung in den Informationsbeständen ist daher kritisch, wenn die Systeme für den*die Anwender*in von Nutzen sein sollen.
Nennen Sie zwei Systeme, die das Kompetenzmanagement unterstützen und beschreiben Sie deren Funktionen kurz in Stichworten.
E-Learning-Systeme: Verwalten der Kursteilnehmer*innen, Unterlagen bereitstellen, Terminkoordination, Zusammenarbeit der Teilnehmer*innen, Prüfungen abhalten.
Kompetenz-Verzeichnisse: Pflege der Kompetenzprofile, Berechtigungssystem für Pflege und Zugriff, Suche nach Kompetenzen.
Beschreiben Sie, welche Funktionen von Community-Management die Zusammenarbeit räumlich getrennter Mitarbeiter ermöglichen.
Community-Management-Werkzeuge koordinieren die Aufgabenerledigung verteilter Teams durch gemeinsame Terminplanung, Workflows und Aufgaben-Tracking. Entscheidend ist auch die Bereicherung der Kommunikationswege, die durch Desktop Sharing in Verbindung mit Telefon und Video-Konferenzen möglich wird. Die Kommunikation wird damit effektiver, als jene über einen einzelnen Kanal, weil neben den Sachinhalten zusätzliche Kontextinformationen übertragen werden.
Beschreiben Sie die Vorteile der Personalisierung von Informationssystemen.
Personalisierung bedeutet, dass die Informationssysteme dem*der Anwender*in nur jene Informationen und Funktionen anbieten, die für ihn*sie relevant sind. Der*die Anwender*in kommt so rascher an sein*ihr Ziel und wird auf seinem*ihrem Weg nicht unnötig belastet. Die bei der Suche und Orientierung im System eingesparte Zeit steht für die Erledigung der Aufgaben im Geschäftsprozess zur Verfügung.
Beschreiben Sie anhand eines Beispiels, wie sich organisatorische Maßnahmen auf die Kultur auswirken.
Die Führung von Mitarbeiter*innen mit Zielen fördert ihre Eigeninitiative und gibt ihnen den notwendigen Freiraum, um ihre Aufgaben eigenständig zu planen und Verbesserungspotential zu nutzen. In der Zielvereinbarung können Wissensziele aufgenommen werden, wie etwa die Dokumentation der Prozessverbesserungen oder deren Weitergabe an andere Mitarbeiter*innen. Ohne Wissensziele würde der*die Mitarbeiter*in seine*ihre Arbeitsprozesse vermutlich auch optimieren, um seine*ihre operativen Ziele zu erreichen, das Wissen stünde der Organisation jedoch nicht zur Verfügung und ginge verloren, wenn der*die Mitarbeiter*in das Unternehmen verlässt. Das Anreizsystem muss die verschiedenen Zielebenen berücksichtigen und neben der Erreichung der operativen Ziele auch jene der Wissensziele belohnen.
Beschreiben sie grob die Abfolge bei der Einführung von Wissensmanagement.
Zunächst muss die oberste Führungsebene die Wissensstrategie und die Wissensziele festlegen, die sie für die Realisierung ihrer Geschäftsstrategie benötigt. Die Wissensstrategie ist auf Vereinbarkeit mit der Unternehmenskultur zu prüfen. Gegebenenfalls müssen zusätzliche organisatorische Maßnahmen ergriffen werden, um die Veränderungsprozesse zu unterstützen. In der Regel wird ein Wissensmanagement-Projekt primär bei einem Handlungsfeld ansetzen. Solange dabei die spätere Integration und Schnittstellen zu anderen Systemen im Auge behalten werden, ist das kein Problem. Am Beginn eines Wissensmanagement-Projektes muss ein Überblick über das vorhandene Wissen, über Kompetenzen, Systeme, Prozesse und Informationsbestände hergestellt werden. Nachdem diese erschlossen wurden, kann sich das Projekt dem Aspekt der Verteilung widmen. Durch die Transparenz hinsichtlich des vorhandenen Wissens werden auch die Lücken sichtbar, die durch Wissensentwicklung beseitigt werden müssen. Die Sicherstellung der Effizienz ist eigentlich kein eigenständiges Ziel, sie gilt für sämtliche Maßnahmen auf allen Zielebenen.
Literaturverzeichnis
Alwert, Kay (2005a): Wissensbilanzen - Im Spannungsfeld zwischen Forschung und Praxis. In: Mertins, Kai (Hg.): Wissensbilanzen. Intellektuelles Kapital erfolgreich nutzen und entwickeln. Berlin: Springer, S. 19–39.
Alwert, Kay; Heisig, Peter; Mertins, Kai (2005): Wissensbilanzen - Intellektuelles Kapital erfolgreich nutzen und entwickeln. In: Mertins, Kai (Hg.): Wissensbilanzen. Intellektuelles Kapital erfolgreich nutzen und entwickeln. Berlin: Springer, S. 1–17.
Amelingmeyer, Jenny (2004): Wissensmanagement. Analyse und Gestaltung der Wissensbasis von Unternehmen. Techn. Univ., Diss. Darmstadt, 1999. 3. Aufl. Wiesbaden: Dt. Univ.-Verl.
Bateson, Gregory; Holl, Hans Günter (2006): Ökologie des Geistes. Anthropologische, psychologische, biologische und epistemologische Perspektiven. 9. Aufl. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
Blumauer, Andreas; Pellegrini, Tassilo (2010): Enterprise 2.0: Über die Rolle semantischer Technologien und interoperabler Metadaten. In: Pircher, Richard (Hg.): Wissensmanagement, Wissenstransfer, Wissensnetzwerke. Konzepte, Methoden und Erfahrungen. Erlangen: Publicis Publ., S. 179–197.
Bohinc, Thomas (2003): Wissenskultur - Begriff und Bedeutung. In: Reimer, Ulrich; Abecker, Andreas (Hg.): WM2003: Professionelles Wissensmanagement - Erfahrungen und Visionen. Beiträge der 2. Konferenz Professionelles Wissensmanagement - Erfahrungen und Visionen, 2. - 4. April in Luzern, Schweiz. Bonn: Ges. für Informatik (GI-EditionP, Proceedings, 28), S. 371–379.
Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur: Wissensbilanz-Verordnung. WBV, vom 15.02.2006.
De Long, David W.; Fahey, Liam (2000): Diagnosing cultural barriers to knowledge management. In: Academy of Management Executive, Jg. 14, H. 4, S. 113–127.
Denning, Stephen (2005): The leader's guide to storytelling. Mastering the art and discipline of business narrative. 1. ed., [repr.]. San Francisco: Jossey-Bass/A Wiley Imprint.
Edvinsson, Leif; Brünig, Gisela (2000): Aktivposten Wissenskapital. Unsichtbare Werte bilanzierbar machen. Wiesbaden: Gabler.
Heisig, Peter (2005): Integration von Wissensmanagement in Geschäftsprozesse. Techn. Univ., Diss. Berlin, 2005. Berlin: Berichte aus dem Produktionstechnischen Zentrum Berlin.
Koch, Günter R. (2004): Die Wissensbilanz in der Praxis. In: Personalwirtschaft, H. 12/2004, S. 26–28.
Lechner, Karl; Egger, Anton; Schauer, Reinbert (2008): Einführung in die allgemeine Betriebswirtschaftslehre. 24., überarb. Aufl. Wien: Linde (Fachbuch Wirtschaft).
Lyotard, Jean-François (2009): Das postmoderne Wissen. Ein Bericht. 6., überarb. Aufl. Wien: Passagen-Verl. (Passagen Forum).
Mandl, Heinz; Reinmann-Rothmeier, Gabi (2000): Die Rolle des Wissensmanagements für die Zukunft. Von der Informations- zur Wissensgesellschaft. In: Mandl, Heinz; Reinmann-Rothmeier, Gabi (Hg.): Wissensmanagement. Informationszuwachs - Wissensschwund? ; die strategische Bedeutung des Wissensmanagements; München: Oldenbourg, S. 1–17.
Maturana, Humberto R.; Varela, Francisco J. (2009): Der Baum der Erkenntnis. Die biologischen Wurzeln menschlichen Erkennens. 2. Aufl. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag.
Mertins, Kai; Heisig, Peter; Vorbeck, Jens (Hg.) (2003): Knowledge management. Concepts and best practices. 2. ed. Berlin: Springer.
Nonaka, Ikujiro; Konno, Noboru: The Concept of "Ba": Building a foundation for knowledge creation. In: California Management Review, S. 40–54.
Nonaka, Ikujiro; Takeuchi, Hirotaka; Mader, Friedrich (1997): Die Organisation des Wissens. Wie japanische Unternehmen eine brachliegende Ressource nutzbar machen. Frankfurt/Main: Campus-Verl.
North, Klaus (2005): Wissensorientierte Unternehmensführung. Wertschöpfung durch Wissen. 4., aktualisierte und erw. Aufl. Wiesbaden: Gabler (Gabler Lehrbuch).
Österreichischer Nationalrat: Universitätsgesetz 2002. UG 2002, vom 01.10.2002.
Picot, Arnold; Scheuble, Sven (2000): Die Rolle des Wissensmanagements in erfolgreichen Unternehmen. In: Mandl, Heinz; Reinmann-Rothmeier, Gabi (Hg.): Wissensmanagement. Informationszuwachs - Wissensschwund? ; die strategische Bedeutung des Wissensmanagements, München: Oldenbourg, S. 19–37.
Pircher, Richard (Hg.) (2010): Wissensmanagement, Wissenstransfer, Wissensnetzwerke. Konzepte, Methoden und Erfahrungen. Erlangen: Publicis Publ.
Polanyi, Michael; Sen, Amartya (2009): The tacit dimension. Chicago, London: University of Chicago Press.
Probst, Gilbert; Raub, Steffen; Romhardt, Kai (2006): Wissen managen. Wie Unternehmen ihre wertvollste Ressource optimal nutzen. 5., überarbeitete Auflage. Wiesbaden: Betriebswirtschaftlicher Verlag Dr. Th. Gabler | GWV Fachverlage GmbH Wiesbaden (Springer-11775 /Dig. Serial]).
Riempp, Gerold (2004): Integrierte Wissensmanagement-Systeme. Architektur und praktische Anwendung ; mit 26 Tabellen. Berlin: Springer (Business Engineering).
Schein, Edgar H. (2006): Organisationskultur. The Ed Schein Corporate culture survival guide. 2., korrigierte Aufl. Bergisch Gladbach: EHP Ed. Humanistische Psychologie (EHP-Organisation).
Schreyögg, Georg; Geiger, Daniel (2003): Kann die Wissensspirale Grundlage des Wissensmanagements sein? 1. Aufl. Berlin: Freie Universität Berlin (Diskussionsbeiträge des Instituts für Management, N.F.,20).
Schreyögg, Georg (2008): Organisation. Grundlagen moderner Organisationsgestaltung ; mit Fallstudien. 4. Auflage. Wiesbaden: Gabler.
Sollberger, Bettina Anne (2006): Wissenskultur. Erfolgsfaktor für ein ganzheitliches Wissensmanagement. 1. Aufl. Bern: Haupt (Berner betriebswirtschaftliche Schriften, 38).
Spitzer, Manfred (2009): Lernen. Gehirnforschung und die Schule des Lebens. [Nachdr.]. Berlin: Spektrum Akad. Verl.
Stevenson, Doug (2008): Die Storytheater-Methode. Strategisches Geschichtenerzählen im Business. Offenbach: Gabal.
Sveiby, Karl Erik (1998): Wissenskapital - das unentdeckte Vermögen. Immaterielle Unternehmenswerte aufspüren, messen und steigern. Landsberg/Lech: Verl. Moderne Industrie.
Weick, Karl E.; Hauck, Gerhard (2007): Der Prozess des Organisierens. 1. Aufl., [Nachdr.]. Frankfurt am Main: Suhrkamp (Suhrkamp-Taschenbuch Wissenschaft, 1194).
Willke, Helmut; Krück, Carsten; Mingers, Susanne (2001): Systemisches Wissensmanagement. Mit 9 Tabellen. 2., neubearb. Aufl. Stuttgart: Lucius & Lucius.
Willke, Helmut (2007): Einführung in das systemische Wissensmanagement. 2. Aufl. Heidelberg: Carl-Auer Verl.
Internetquellen
Content.Node. Online verfügbar unter http://www.gentics.com/.
Döbeli Honegger, Beat: Concept Map. Online verfügbar unter http://beat.doebe.li/bibliothek/bibliomap/w01948.png.
Hyperwave. Online verfügbar unter http://www.hyperwave.com.
Opentext. Online verfügbar unter http://www.opentext.de.