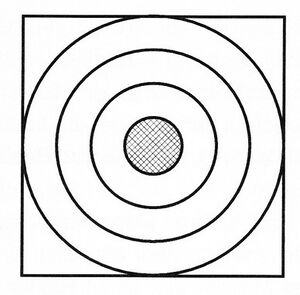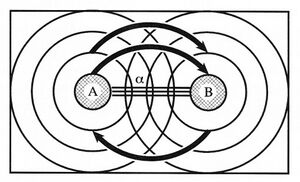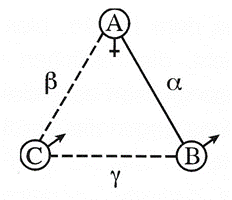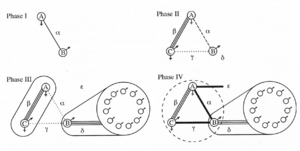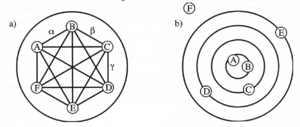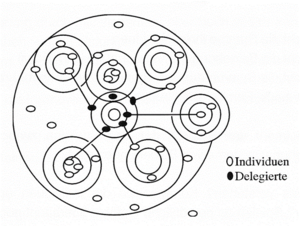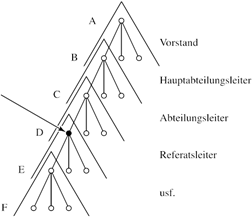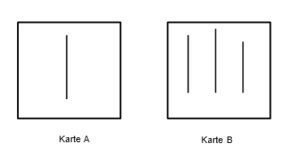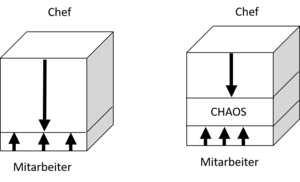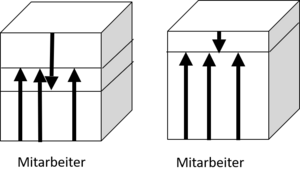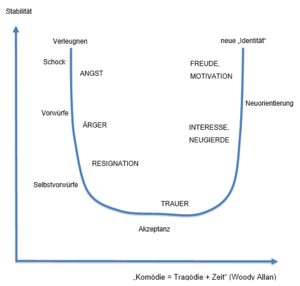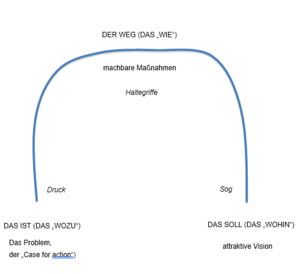MN436 - Gruppen- und Organisationsdynamik - Gesamt
Dr. Guido Schwarz, Jahrgang 1966, Dr. phil. an der Uni Wien 1997
Philosoph und Gruppendynamiker. Als selbständiger Unternehmensberater in Wien tätig. Autor zahlreicher Fachbücher.
Spezialgebiete: Qualitative Motivforschung, Organisationsentwicklung, Konfliktmanagement und Teamentwicklung, Coaching und Training sowie die Betriebsübergabe von Familienunternehmen.
Einleitung
Dieses Skriptum hieß jahrelang „Change Management“. Das führte immer wieder zu Missverständnissen, weil die Erwartungen in Richtung „Change-Management-Techniken“ bzw. Prozessabläufen ging. Wir wollen uns dem Thema aber auf eine andere Art nähern und sehen uns die Strukturen an, die in einem Veränderungsprozess wichtig sind. Gegen Schluss gibt es aber auch praktische Modelle und Techniken für das Management von Veränderungen.
Veränderung erzeugt Widerstand und wer die Strukturen versteht, aus denen der Widerstand kommt, kann ihn leichter managen. Von dieser Annahme geht die Grundidee der folgenden Lektionen aus. Mit Gruppe und Hierarchie haben wir die beiden Organisationsformen, in denen wir leben und arbeiten. Diesmal beschäftigen wir uns speziell mit der Gruppe.
Dieses Skriptum unterscheidet sich in ein paar Punkten von anderen:
Es ist ein bunter Mix aus Theorien, Geschichten, Erläuterungen und Übungen.
Der wissenschaftliche Anspruch in der Gruppendynamik unterscheidet sich erheblich von naturwissenschaftlichen Ansätzen. Dort werden Hypothesen aufgestellt, überprüft und erlangen Geltung so lange, bis sie durch neue, bessere ersetzt werden. In dieser Zeit gelten sie als „Wahrheit“, zumindest innerhalb des wissenschaftlichen Rahmens. In der Gruppendynamik ist das anders. Hier entsteht „Wahrheit“ in der Interaktion, in der Kommunikation, als gemeinsame Vereinbarung, als aufeinander abgestimmte und in vielen Fällen ausgestrittene Übereinkunft. Sie ist hinterfragbar, bricht oftmals auf und muss neu gebaut werden. Selbstreflexion und Feedback spielen eine wichtige Rolle und Objektivität ist ein zu Recht angezweifelter Terminus.
Dies alles gilt auch für das didaktische Prinzip in der Gruppendynamik. Ich will nicht Wissen vermitteln, obwohl sich das sicherlich nicht vermeiden lässt, sondern vor allem zum Nachdenken anregen. Es ist nicht notwendig, alles selbst zu entdecken, nicht jede*r muss das Rad neu erfinden. Daher gibt es bereits fertige Modelle und Interpretationsvorschläge. Mein Fokus liegt woanders: Wo betrifft es Ihr Leben, wo gibt es Verbindungen zu Ihnen? Ich möchte das Lehrverständnis durch ein Lernverständnis ersetzen, das ich Ihnen anbiete – auch wenn ich mir der Untrennbarkeit von Lernen und Lehren bewusst bin.
Die Aufgaben am Schluss jeder Lektion funktionieren somit nicht nach dem Prinzip eines Tests oder einer Prüfung, sondern sollen zum Nachdenken über die eigene Situation dienen: Wie geht es mir eigentlich mit diesem Thema, inwiefern betrifft es mich? Wenn Sie in Zukunft als Führungskraft in einem Unternehmen oder auch selbständig tätig sind, dann spielen eigene Erfahrungen, Werte und Ansichten auch in Ihren Führungsstil mit hinein – unabhängig davon, ob Sie das wollen oder nicht. Ich sehe meine Aufgabe darin, Sie zum „Erwerben“ der Fähigkeit zu ermuntern, Ihre persönlichen Werte und Ansichten zu unseren sozialen Kontexten (insbesondere Gruppe und Organisation) zu hinterfragen und weiterzuentwickeln. Diese Arbeit haben jedoch Sie zu leisten.
Auch der Titel der Lehrveranstaltung ist nicht völlig ident mit dem Inhalt dieses Studienheftes. Menschen agieren miteinander, kommunizieren, verharren, entwickeln weiter, kurz: Sie sind in Bewegung, sie sind dynamisch, auch in ihren Organisationsformen Gruppe und Hierarchie, die wiederum einander nicht mögen und gerne aus der Balance geraten. Ich versuche eine Ausbalancierung und lade Sie dazu ein, mitzuarbeiten.
Nicht nur in der Organisationspraxis spielen die sozialen Systeme Gruppe und Organisation zusammen (oder gegeneinander). Auch historisch gehen die Konzepte der Gruppendynamik und der Organisationsentwicklung auf denselben Begründer zurück: den Sozialpsychologen Kurt Lewin (1890-1947). Lewin entwickelte in den „National Training Laboratories“ ab 1947 diese beiden Konzepte samt ihren Methoden-Baukästen. Lewin war dabei stets von der Ambition geleitet, dass Wissenschaft einen konkreten Nutzen für die Gesellschaft zu stiften hat. Dieser Nutzen liegt für ihn vor allem in der Erhellung jener sozialen Prozesse und Dynamiken, die uns Individuen umgeben, unbewusst beeinflussen und die wir steuern möchten. Auch der Prozess der Erkenntnisgewinnung trägt bereits zur Veränderung des sozialen Gefüges bei, das es zu erkennen gilt. Es gibt also in den Sozialwissenschaften keine neutrale, objektive Forschung, keine Trennung von Forscher*in und Beforschtem, sondern jeder Forschungsprozess beeinflusst bereits den Forschungsgegenstand. Dieses Forschungsverständnis nennt Lewin „Aktionsforschung“ [1] .
Was ist „Gruppendynamik“?
Nach Durcharbeit dieses Kapitels sollten Sie in der Lage sein:
- den Unterschied zwischen sozial- und naturwissenschaftlichem Ansatz besser zu erkennen;
- einen Einblick in Geschichte und Definition von Gruppendynamik zu haben.
„Der gemeinsame Wille aller ist stets gut.“
Diese Erkenntnis von Immanuel Kant ist zwar nicht die Geburtsstunde der Gruppendynamik, weist aber auf ihre zentrale Stärke hin: eine Kraft zu sein, die nicht unterschätzt werden sollte.
In den 1950er Jahren wurden die ersten Experimente mit (Menschen-) Gruppen gemacht. Aus den Besonderheiten der Ergebnisse dämmerte den damals damit befassten Psycholog*innen und Soziolog*innen, dass hier Kräfte am Werk waren, die noch bei weitem nicht ausreichend und schon gar nicht wissenschaftlich untersucht waren.
Besonders hervorzuheben sind hier die Arbeiten des Amerikaners Kurt Lewin, den man quasi als „Vater der Gruppendynamik“ bezeichnen kann.
Im Zuge seiner Forschungen mit Studenten soll sich ungefähr folgendes zugetragen haben:
Kurt Lewin saß für ein Experiment hinter einer Holzwand und hörte zu, wie eine Gruppe von Studenten diskutierte. Irgendwann brauchten sie dann einen Rat vom Professor und ein Student holte ihn zur Gruppe. Es wurde weiterdiskutiert und nach einiger Zeit holte man Lewin noch einmal und dann noch einmal. Irgendwann kam die Erkenntnis: Eigentlich könnte er ja gleich sitzenbleiben, denn die Studenten wussten ohnehin, dass er nur wenige Meter entfernt hinter der Wand saß und ihnen zuhörte. So entstand – angeblich – die sogenannte „T- Gruppe“.
Auch wenn das „nur“ eine Geschichte ist, wir können daraus eine Menge lernen:
- Im Gegensatz zu naturwissenschaftlichen Experimenten widersetzen sich Menschen derjenigen Form von Beobachtung, die das Beobachtete unberührt lässt. Bei der Beobachtung und Erforschung eines Steinbrockens stellt uns diese (natur-)wissenschaftliche Forderung vor keine allzu großen Probleme (manche Expert*innen bezweifeln sogar das), sobald jedoch Menschen ins Spiel kommen, kann man den Ansatz schlicht und einfach ins wissenschaftliche Museum entsorgen. Daher gilt: Beobachtete Dinge verändern sich durch die Beobachtung. Das alleine wäre schon schlimm genug, wenn Menschen ins Spiel kommen, wird die Sache noch komplizierter: Sie verändern nicht nur ihr Verhalten, sondern beginnen auch mit dem*der Beobachter*in zu kommunizieren, was wiederum diese*n verändert. Kaum hat man einen Moment nicht aufgepasst, findet man sich schon in einer fröhlichen Interaktion zwischen allen Beteiligten und kann die „objektive Fernbeobachtung“ ins Reich der Wünsche transferieren.
- Lernen, wissenschaftliches Beobachten und Arbeiten umfasst also stets das Beobachtete, die Beobachter*innen und die Beobachtung selbst, die ihrerseits auch noch einmal beobachtet bzw. dokumentiert sein will. Wem das jetzt schon zu kompliziert ist, der möge sich einmal in eine so genannte „T-Gruppe“ setzen. Das Ergebnis wird ein gerütteltes Maß an Eigenverunsicherung sein, sicher jedoch auch einer der wertvollsten Lerneffekte des bisherigen Lebens. „T-Gruppe“ steht übrigens für „Trainings-Gruppe“, wenngleich auch dort Tee getrunken wird, zumindest wenn sie im Winter stattfindet. Diese Form der gruppendynamischen Arbeit ist in der heutigen Praxis der Organisationsentwicklung leider nicht mehr sehr häufig zu finden, weil der Trend zu einer ständigen Verkürzung und Komprimierung von Inhalten, aber auch den dazugehörigen Settings geht. Als Gruppendynamiktrainer*in kommt man mit großen Erwartungen zum*zur Auftraggeber*in und bekommt dann zu hören: „Könnten wir das Seminar, das Sie (ohnehin schon mit Ächzen und Stöhnen) auf drei Tage angesetzt haben, nicht in zwei Tagen machen – oder besser noch: in einem Tag, vielleicht aufgeteilt auf zwei Nachmittage?
- Wenn Sie das jetzt an das Design mancher Lehrgänge an einer Fachhochschule erinnert, dann nicht ganz zufällig. „Zeit sparen“ ist das Thema in der heutigen Wirtschaft, was in einem Tag zu schaffen ist, kann auch in einem halben erledigt werden. In der Gruppendynamik ist das anders, hier versucht man Lernprozesse zu beobachten und daraus zu lernen. Eine Erkenntnis besteht etwa darin, endlich den Spruch der alten Griechen zu verstehen, der da lautet:
„Du kannst noch so oft an der Olive zupfen, sie wird deswegen nicht früher reif.“
Menschen brauchen Zeit, um zu lernen – die einen weniger, die anderen mehr. Wenn man versucht, diese Zeit zu ökonomisieren, dann tritt der Lerneffekt nicht ein oder mit erheblichen Abschlägen. Da diese Abschläge meist nicht sofort sichtbar sind, versuchen vor allem Ökonom*innen die Erkenntnisse der Gruppendynamik in das „Paperlapapp-Reich“ zu verdammen und sprechen gerne von „Soft Skills“. Sie meinen damit, dass die Gruppendynamik in eine Art „weichen“ Bereich gehört und somit eigentlich unwichtig ist, ersatzlos zu streichen quasi, im Gegensatz zu den „Hard Skills“, zu denen selbstverständlich ihre eigenen Bereiche gehören.
Die leichte Polemik in den gerade eben getätigten Ausführungen entsteht nicht nur aus dem Frust der Gruppendynamiker*innen, die ihr wichtiges Fach nicht ausreichend verstanden und gewürdigt sehen, sondern hat auch Methode, die sozusagen aus der ihnen eigenen Methodik selbst stammt: In der Gruppendynamik überhöht man von Zeit zu Zeit Beobachtungen bzw. deren Rückmeldungen an die Gruppe, um sie leichter sichtbar zu machen. Diese Beobachtung wird dann von der Gruppe aufgenommen und diskutiert. Daraus entstehen neue Beobachtungen, die dann wieder rückgemeldet und diskutiert werden – inklusive der an sich selbst beobachteten Lerneffekte und Erkenntnisse, die ihrerseits wieder in Frage gestellt werden. Dann listet man sie auf und hat das Gefühl, sich selbst zwar nicht mehr so gut zu verstehen wie noch vor der Sitzung, aber dennoch etwas Wichtiges gelernt zu haben.
Somit können wir uns einer ersten Definition von Gruppendynamik nähern: Es ist die Lehre von der Dynamik in Gruppen, also von all dem, was in Gruppen so passiert und daraus als Erkenntnis abzuleiten ist. Im Gegensatz zu anderen wissenschaftlichen Ansätzen ist Gruppendynamik jedoch mehr, sie unterscheidet sich in einem wesentlichen Punkt: Das Beobachtete fließt ständig in seine eigene Wissenschaft ein, es verändert die Gruppendynamik selbst, ist quasi eine Art institutionalisiertes, iteratives Lernen mit sich selbst, ein Dauerexperiment unter Beobachtung inklusive einer ordentlichen und der Methodik implizierten Portion Selbstreflexion.
So wie diese Ausführungen, die Sie gerade lesen, ist die Gruppendynamik in sich oft unstrukturiert, weil sie auf die gerade auftretenden Bedürfnisse der in ihr Tätigen Rücksicht nehmen muss, weil genau diese der Gegenstand der Beobachtung sind. Die ständige wechselseitige Beeinflussung von Gegenstand und Wissenschaft ist selbst wiederum das Thema, das reflektiert werden muss.
Selbstverständlich schert man da und dort einmal aus und fasst zusammen, stellt fest und kann sich auch einmal aus der Beobachtung herausnehmen (und sich einen Tee gönnen, außerhalb der T-Gruppe). Dies wird am Ende dieser Lektion passieren, wo die gerade hier und jetzt durchgeführten Erläuterungen zusammengefasst werden. Dann können Sie auch Ihren eigenen Senf dazugeben und sich mit eigenen Überlegungen einbringen, leider jedoch ohne sofortige Rückmeldung. Da das Design dieses Lehrgangs kein gruppendynamisches ist, fehlt diese Möglichkeit, wenngleich sie auch in den Online-Interaktionen ein wenig aufzublitzen vermag.
In den Präsenzphasen sollen und dürfen Sie dann höchstpersönlich und voll physisch anwesend mitwirken. Auch dort wird die Möglichkeit entstehen, zu neuen, eigenen Erkenntnissen zu gelangen, idealerweise auch noch selbst gesteuert, etwa durch die Menge und Qualität des selbst Eingebrachten.
Es gibt in der Gruppendynamik einige Grundthemen, Problemfelder sozusagen, die sich durch alle Bereiche hindurchziehen. Sie werden in den folgenden Lektionen im Zentrum der Betrachtung stehen. Eines davon ist der Widerspruch von männlich und weiblich, heute gerne „Genderproblematik“ genannt. Auch in diesem Skriptum tritt dieser Widerspruch auf und zeigt sich in der immer wieder ungelösten Frage, wie die Sprache zu strukturieren ist. Soll ein „Binnen-I“ den Frauen andeuten, dass auch sie gemeint sind, wenn die Männer geschlechterendungsmäßig benannt werden? Oder – wie oft gefordert – soll generell die weibliche Endung dominieren, weil die Frauen in der Realität unserer Gesellschaft ohnehin zu kurz kommen und ein wenig Kompensation nicht schaden kann, nein, sogar notwendig ist, eigentlich unumgänglich und: Wer jetzt von „Überkompensation“ spricht, gerät ins Kreuzfeuer weiblicher Schlagkraft? Oder soll man (frau...) gar versuchen, für alles „geschlechtsneutrale“ Formulierungen („Mensch“ statt „Mann“ und „Frau“, also etwa „jedermensch“) zu finden, bis die Köpfe rauchen? Wir haben uns entschieden, die Lesbarkeit in den Vordergrund zu stellen, jedoch von Zeit zu Zeit allen schnell Vergesslichen in Erinnerung zu rufen, dass das Thema ein für uns wichtiges ist, etwa indem wir immer wieder bewusst weibliche Endungen einflechten (siehe dazu auch den Abschnitt in der Einleitung).
Gruppendynamik ist bunt, vielfältig, ständig in Veränderung und verändert ihrerseits wiederum diejenigen Interessierten, die sich mit ihr befassen. Sie steht in ständigem Kampf mit der Dominanz der hierarchischen Organisationsform („Hierarchie“ kommt von den griechischen Worten „arché“ und „hieros“, was so viel wie „Ordnung“ und „heilig“ bedeutet, also „heilige Ordnung“), die weltweit unsere Organisationen und Institutionen strukturiert und somit auch unser Denken.
Der Gegenspieler ist also die Hierarchie. Als dominantes, wenngleich auch jüngeres Organisationsmodell war sie ja schon Thema im Kurs „Management und Organisation“. Sie dominiert als vorherrschende Organisationsform das Denken der Menschen und steht großteils in Widerspruch zur anderen Organisationsform, der Gruppe. Beide sind männlich dominiert bzw. sogar von Männern erfunden bzw. entwickelt worden – Frauen stehen eher für Familienverband bzw. Clan. Wenn man diese beiden Organisationsformen aneinander reibt, so sprühen die Funken. Das ist auch z. B. für Wirtschaftsinformatiker*innen relevant, weil sie in ihren Jobs auch mit beiden Organisationsformen konfrontiert werden und lernen müssen, mit dem Widerspruch sinnvoll umzugehen, vor allem als Führungskraft. Wie reagieren Sie, wenn Sie eine*n Außenseiter*in in der Gruppe haben? Was machen Sie, wenn Sie den Verdacht haben, dass sich ihre Mitarbeiter*innen gegen Sie zusammenrotten? Gibt es hier Modelle, nach denen man vorgehen kann oder obliegt das der persönlichen Intuition? Davon und mehr in den folgenden Lektionen.
Gruppendynamik besteht zum Großteil aus Tun, die Theorie kann maximal erklären und hinterlegen und sie steht nie im Vordergrund. Daher ist es auch schwierig, ein entsprechendes Skriptum anzufertigen, denn eigentlich müsste man die Dynamik in Gruppen erleben, schon allein wegen der Frage nach der eigenen Reaktion in solchen Situationen. Das lässt das Setting eines FH-Lehrgangs nur sehr bedingt zu und somit sind wir gezwungen, zu improvisieren.
In den folgenden Lektionen gibt es die vorhandene Theorie, die jedoch mit Vorsicht zu genießen ist. Erstens kann sie nie vollständig sein, zweitens ist sie erklärungsbedürftig und drittens nimmt sie jede*r Leser*in anders wahr. Damit sie stimmt (Wahrheitsanspruch), muss sie besprochen werden. Wahrheit entsteht nicht als von oben verordnete Doktrin oder Aussage oder Befehl, sondern induktiv durch das miteinander reden, durch das Ausstreiten, durch das Diskutieren. Das ist auch hier so und ein kleines Forum dazu bieten die Online-Abschnitte der Lehrveranstaltung bzw. die Präsenzphasen.
Aufgaben
Was habe ich damit zu tun?
Nun wird es insofern schwierig, als Sie selbst mit der Reflexion beginnen müssen. Wie ist das bei mir selbst? Was habe ich in der Vergangenheit erlebt, wo betrifft das mein eigenes Leben?
Denken Sie an den obigen Spruch:
„Du kannst noch so oft an der Olive zupfen, sie wird deswegen nicht früher reif.“
Finden Sie 1-3 Erlebnisse, wo Sie an der Olive gezupft haben. Was ist da passiert? Wo hat versuchte Beschleunigung letztendlich zu einer Verlangsamung geführt? Konnten Sie daraus etwas lernen, und wenn ja, dann was?
Wie gehen Sie persönlich mit Veränderung und Ungeduld um? Schließlich sind wir bei einer Lehrveranstaltung zum Thema Change Management...
Verwenden Sie dazu bitte das Handout, das Sie im Online-Forum zur Lektion 1 finden. Es ist im Word-Format, damit Sie es ausfüllen können. Dann machen Sie bitte ein PDF daraus und stellen es ins Forum.
Es ist stets spannend zu sehen, welche Geschichten hier auftauchen. Wenn Ihre Geschichte zu persönlich für das Forum ist, dann können Sie diese auch per Mail an den*die LV-Leiter*in schicken. Das gilt übrigens auch für alle nachfolgenden Lektionen.
Organisationsdynamik [2]
Um die verschiedenen sozialen Phänomene, die mit „Gruppe“ zusammenhängen, überhaupt verstehen zu können, müssen wir den Bogen weiter aufspannen. Wir können feststellen, dass es überall „menschelt“ und dass wir stets auf Emotionen treffen, die sich mit rationalen Modellen oft nicht gut vertragen. Trotzdem müssen wir damit umgehen – ganz nach unseren Fähigkeiten. In diesem Kapitel geht es um den Aufbau sozialer Beziehungen. Sie beginnen bei uns selbst, weil wir als Individuum stets eine Beziehung zu unserer Umwelt und auch zu uns selbst haben.
Die folgende Lektion ist ein Streifzug durch die zahlreichen sozialen Ebenen, auf denen Beziehungen existieren und das Sozialgefüge nicht nur dominieren, sondern erst erzeugen. Was ist Gesellschaft? Diese Frage ist auch für Wissenschaftler*innen schwer zu beantworten. Vielleicht ist es die Summe aller sozialen Beziehungen auf allen sozialen Ebenen, vom Individuum bis zum Kosmos sozusagen. Aus diesem Grund ist das auch die längste Lektion, sie verdient eine ausführliche Beschäftigung mit dem Thema. Nach Durcharbeit dieses Kapitels sollen Sie in der Lage sein, mehrere Erkenntnisse für Ihre Praxis zu haben:
Welche sozialen Ebenen gibt es und wie stehen sie zueinander in Beziehung?
Welche Rolle spielt die Gruppe in unserem Leben und welchen Stellenwert nimmt sie in den Organisations- und Lebensformen ein?
Einleitung
Möglicherweise haben nur ganz wenige Menschen ein Herz für Organisationen. Warum sollten wir? Wir haben keinen Grund, der uns ihr Verständnis schmackhaft machen könnte. Denn Organisationen sind spröde, formal, unpersönlich, anonym, funktional, kalt, unflexibel und starr. Menschen hingegen lieben Wärme, Persönlichkeit, Nähe, Gefühl, Verständnis, Entgegenkommen und Geborgenheit.
Eine Paarbeziehung, eine Familie und allenfalls eine Gruppe mag das noch bieten können, denn dort kennt jede*r jede*n, jede*r kann sich zu Wort melden, wenn es um seine*ihre Interessen geht. Aber können das auch Organisationen bieten? Vermutlich nicht. Auf der Suche nach einer Begründung möchte ich mittels eines Kunstgriffes in die Vergangenheit zurückgehen und sehen, welches Trauma die Organisation seit ihrer Geburtsstunde begleitet.
Das Trauma des Anfangs
Menschen scheinen wenig Lust zu haben, mit Fremden oder Andersartigen zu kooperieren. Sie bleiben lieber im Kreis ihrer Bekannten und bei den selbstverständlich bekannten Verhaltensweisen. Sie kennen ihren Stall, mögen seinen Geruch, wissen um ihren Platz, kennen das Essen und die Bräuche. Daheim ist daheim. Es war sicher nicht die Humanität, die die Menschen zu gruppenübergreifender Kooperation trieb, sondern die pure Not.
Ein Nomadenstamm musste weiterziehen, weil die Steppe leer gefressen war, und in den saftigen Gebieten grasten schon andere Herden. Was tun? Noch schlimmer war es, wenn gleich zwei unterschiedliche Kulturen und Normensysteme aufeinanderprallten, etwa Hirten und Ackerbauern. Denn die Ackerbauern waren selbstverständlicherweise stocksauer, wenn die nomadisierenden Viehhirten ihre Herden auf die bebauten Felder trieben, weil es dort gar zu schön grünte. Man denke an den tödlichen Streit zwischen dem rückständigen Hirten Abel und dem ökonomisch fortschrittlichen Ackerbauern Kain.
Es muss, wenn man die Frühgeschichte der Menschheit betrachtet, entsetzliche Opfer gekostet haben, bis verschiedene Stämme, Sippen und Völker Methoden des wechselseitigen Auskommens gefunden haben. Denn zu den Menschen im eigentlichen Sinne rechnete man ja doch nur die Angehörigen des eigenen Clans. Andere gelten als Nicht-Menschen, als Tiere oder Sachen, die man ohne weiteres verwenden oder auch töten durfte. Ein gemeinsames WIR mit Fremden war undenkbar.
Solange die Vernichtung des*der Anderen, Fremden, Gegner*in leicht ging, wurde sie als Konflikt- Lösung fraglos präferiert. Erst als man beim Versuch, den*die Anderen zu vernichten, auch die eigene Vernichtung riskierte, verfiel man langsam und zähneknirschend auf andere Methoden. Das ist die Geburtsstunde der Organisation. Wundert es, dass ein unter solchem Stern geborenes Kind immer wieder mit wilden Schicksals- und Rückschlägen konfrontiert wird – bis auf den heutigen Tag?
Allerdings sollte ja von der Vergangenheit die Rede sein. Ich sprach von Clans und nicht von großen Firmen, von Sippen und nicht von Tochtergesellschaften, von feindlichen Kriegern und nicht von der Konkurrenz, sprach von alten Totem-Verbänden wie den Falken und Hunden in Ägypten, nicht aber von verschiedenen Hauptabteilungen wie Technik und Verkauf.
Welches Pfand nun haben feindliche Stämme, das ihnen ihre wechselseitige Anerkennung als Tausch- und Handelspartner, ja als menschen-ähnliche Wesen garantieren kann? Angesichts der drohenden wechselseitigen Vernichtung war der höchste Einsatz gerade hoch genug, um die Identität der eigenen und die Lebensberechtigung der Feind-Gruppe auf Dauer zu stellen: nämlich die Menschen selbst.
Der Tausch von Menschen, insbesondere der Frauentausch und die Ausheirat (Exogamie) legten den Grundstein zu jeder Form von Organisation. Jede Gruppe hatte die wichtigsten Produktionsmittel, die Frauen, als Geiseln gegeben und genommen. Noch heute kann man jedes diplomatische Corps als Ansammlung von Geiseln betrachten, die besonderen Schutz brauchen, damit sie dem Anpassungsdruck jeder Gesellschaft standhalten können. Denn nur wenn sie in der Fremde auch Fremde bleiben, sind sie als Geiseln und Vergegenwärtigung aller äußeren Feinde im eigenen Land brauchbar.
Das führte zu erweiterten und vernetzten Verwandtschaftsorganisationen, die z. B. in Österreich bis 1918 als Legitimationsmodell politischer Herrschaft von Kaiser und Adel Geltung hatten.
Unsere Organisationen sind Männerorganisationen
Eine letzte historische Bemerkung: Die Familialorganisation, die den Adel, den mittelalterlichen Bauernhof, den städtischen Gewerbebetrieb kennzeichnete, hat heute nur noch wenig Einfluss und Verbreitung im Verhältnis zu den großen Organisationen, die heute das Wirtschaftsleben beherrschen. Unsere Groß-Organisationen knüpfen eher an die eingeschlechtliche Jagdbande an, in der sich die vom mütterlichen Herd vertriebenen und für den weiteren Bestand des Stammes an sich unnötigen Männer zusammenschlossen und wechselseitig ihrer welterhaltenden Unentbehrlichkeit versicherten: unsere Arbeitswelt. Diese von der Verwahrlosung bedrohten Männerhorden (Ausgestoßene sind oft unberechenbar) werden durch strenge Regeln und Rituale an die jeweilige Gruppe gebunden, indem sie sich auf heilige Ziele, hohe Ideale und imposante Leistungsvorgaben einschwören. Denken Sie an die Kirche, die Orden, an das Militär, an die Beamtenschaft und überhaupt an jede Form von Bürokratie.
Alle diese Organisationen verfügen über Kulte und Kultstätten, wo versucht wird, die anonymen und unpersönlichen Strukturen durch symbolische Gemeindebildungen zu entschärfen, die Gläubigen beim richtigen Glauben und bei der wahren Kirche zu halten. Emotional wird mit diesen Symbolen und Zusammen(ge)hörigkeits-Beschwörungen an die alten Heimeligkeits-Gefühle der Familie angeschlossen. Tatsächlich ersetzen diese Organisationen den Männern die Wärme des mütterlichen Herdes und Schoßes. Und dabei wollen sich die Männer von wirklichen Frauen nicht mehr stören lassen. „Denn das sind ja auch solche, die UNS – wenn nur erst Nachwuchs kommt – vor die Tür der Heimeligkeit setzen und in die kalte Welt hinaustreiben.“
Wenn daher der Personalchef eine Bewerberin fragt, wie sie's denn mit Kindern halte, meint er im Grunde: „Wir wissen schon jetzt, dass Sie uns wahrscheinlich verraten werden an Ihr nächstbestes Kind.“ Frauen sind also nur beschränkt verfügbar, entziehen sich dem absoluten Zugriff der Organisation, haben auch noch anderes im Kopf als die Firma. Das ist Verrat, also bleiben wir Vertriebene unter uns. Einmal verlassen worden zu sein, das genügt. Was muss sich also ändern, damit sich das ändert?
Die heute einflussreichen Gesellschaften sind Männer-Organisationen, in denen sich Vorgesetzter und Mitarbeiter nach dem Modell von Vater und Sohn gegenüberstehen, unterstützen und lieben.
Der adäquate Ausdruck dieser Söhne-Gesellschaften findet sich im christlichen Trinitäts- Dogma. Die Heilige Dreifaltigkeit besteht aus einem allmächtigen Vater, einem Sohne, und das Prinzip der Kirche als der Gemeinschaft der Erlösten ist der Heilige Geist. Er wird definiert als die Liebe zwischen Vater und Sohn. D.h.: Die Liebe zwischen (zwei) Männern ist organisations-konstitutiv, wobei die Autoritätsverhältnisse „natürlicher Weise“ unumkehrbar sind, denn ein Vater kann nie der Sohn seines Sohnes werden. Haben Sie die Sache schon einmal von dieser Seite betrachtet?
An diesen Geschichten interessiert uns nicht so sehr das Historische; sie sollen uns vielmehr daran erinnern, dass erstens in jeder Organisation ungeheure Kräfte gegenseitiger Vernichtung zwischen unterschiedlichen Menschengruppen in den Dienst eines gemeinsamen Überlebens umgeformt werden müssen. Gelingt also Organisation nicht, muss man jederzeit mit dem Ausbrechen dieser archaischen Mächte und Konflikte rechnen; und zweitens, dass in unseren Breiten Organisation fast immer mit männerrechtlicher Söhne-Organisation identisch ist.
Organisation als Form des Zusammenlebens
Sehen wir uns die verschiedenen Formen des Zusammenlebens an, die sich in einer Organisation ansammeln, dann verstehen wir schnell, warum jede Organisation ein Wespennest unvermeidlicher Konflikte ist. Wir unterscheiden - zunächst äußerlich der Größe folgend -
- Individuum
- Paar
- Triangel
- Familie
- Gruppe
- Organisation
- Institution,
- Gesellschaft
- Staat
- Weltgesellschaft...
Als Einführung in die eigentümliche Dynamik, die in und zwischen jeder dieser Stufen herrscht, möchte ich kurz Individuum, Paar und Dreieck vorstellen, um dann das Verhältnis Gruppe – Organisation darstellen zu können. Was dazwischen und danach kommt, bleibt uns hier nicht wichtig.
Das Individuum
Individuen sind, wie der Name sagt, „unteilbar“ (lateinisch „individuum“). Sie müssen sich und ihre Privatsphäre nach außen abgrenzen können. Wir haben verschiedene Grenzen und Verteidigungslinien um unsere Identität gezogen, teils aus der Veranlagung heraus, aber teils auch, um an die Kommunikationsnarben von früheren Wunden nicht rühren zu lassen. Ein nicht geringer Teil unserer Kräfte ist durch die Instandhaltung unserer Chinesischen Mauer gebunden.
Graphisch simpel dargestellt zeigt sich ein Kern, umgeben von ringförmigen Verteidigungsanlagen. Man kann mit verschiedenen Menschen unterschiedlich distanziert verkehren. Manche bleiben überhaupt draußen, andere lasse ich bis zur vierten, wieder andere bis zur inneren Verteidigungslinie kommen. Aber gewahrt bleibt meine Individualität dann, wenn ich jederzeit den Abstand selbst bestimmen und verteidigen kann.
Die Gesellschaft jedenfalls ist skeptisch gegenüber der Lebensform “Individuum”, die ja historisch gar noch nicht so lang existiert und auch in manchen Gesellschaften unserer Zeit (in Teilen Chinas etwa) keine so große Rolle spielt wie bei uns: der Wert der Gruppe, der Gemeinschaft übersteigt den des*der Einzelnen, der*die dies mit einer gewissen Wehleidigkeit zu Kenntnis nimmt bzw. nehmen muss.
Gesellschaften pflegen Individuen zu vereinnahmen – der*die junge Student*in, der*die das erste Mal nach Wien kommt und hier eigentlich keine Menschenseele kennt, wird schnell in die eine oder andere Gruppe und somit in eine neue Gesellschaft aufgenommen: er*sie findet dort eine neue emotionale Heimat und ist dafür bereit, einen gewissen Preis zu zahlen – je nach dem, wem er*sie zuerst in die Hände fällt, wird er Mitglied der revolutionären Marxisten oder einer schlagenden Burschenschaft.
Das soll nicht heißen, dass Mitgliedschaften beliebig austauschbar sind – selbstverständlich bringt diese*r junge Student*in eine Vergangenheit mit, die ihn*sie möglicherweise auch schon politisch geprägt hat – trotzdem ist das Phänomen zu beobachten, dass es hier eine gewisse Beliebigkeit gibt.
Das Individuum wird für die Gesellschaft dann zur Gefahr, wenn es autonom ist - und somit nicht beeinflussbar, weil nicht erpressbar. Die Gesellschaft kann an ein autonomes Individuum keine Ansprüche stellen und wird daher immer misstrauisch sein gegenüber Einzelgänger*innen, Einsiedler*innen und ähnlichen, dubiosen Gestalten.
Das Individuum ist jedoch nicht nur für die Gesellschaft ein meist ungebetener Gast, sondern auch für die Zweierbeziehung, für das Paar – obwohl, oder besser GERADE weil dieses Paar aus zwei Individuen besteht.
Die Paarbeziehung
War dem Individuum die Abgrenzung alles, so entwickelt sich in der Paar-Beziehung etwas Neues: sie ist sicher nicht bloß die Summe ihrer Teile (der Individuen), sondern gewinnt selbst so etwas wie eine eigene Identität. Ja, bis zu einem gewissen Grad verselbständigt sich das Paar sogar gegenüber den Individuen und entwickelt eine Eigendynamik, die dem Zugriff der Partner*innen nicht selten entgleitet. Das macht ja den thrill (die Angstlust) einer Paar- Beziehung aus, dass die Grenzen und Verteidigungslinien in irgendeiner Form geöffnet werden müssen. Wechselseitiger Ein-Fluss wäre ja sonst nicht möglich. Außerdem übertragen wir oft Anteile unseres Selbst dem anderen – zu einer besseren Verwendung, als sie möglicherweise bei uns gefunden hätten. Mit manchen Anteilen von mir kann mein*e Partner*in durchaus mehr anfangen als ich selbst.
Graphisch ist dies sehr schwer dazustellen. Annäherungsweise könnte man es so versuchen:
A und B wären die Kerne der Individuen, rundherum die sich mehr oder weniger überlappenden Grenzen und Grenz-Territorien, die verschiedenen Tore, Tunnel, Brücken zur Verbindung; zwischen den Kernen – und außen herum die gemeinsame Grenzlinie als Symbole für die Beziehung.
Während wir also Individuen sind, sofern wir uns abschließen und abgrenzen können gegenüber anderen und so unverwechselbar wir selbst sind, macht die Paar-Beziehung das pure Gegenteil: sie reißt Mauern ein, bricht Hindernisse nieder, baut Tore, gräbt unterirdische Tunnel, wirft Botschaften über verbotene Tore, legt Leitern an feste Türme usf. usf.
Kurz: Die Paar-Beziehung ist der natürliche Feind des Individuums. Und umgekehrt: Das Individuum ist der natürliche Feind der Paar-Beziehung.
Wie das? Die meisten von uns wollen doch beides! Also wollen wir den Konflikt, und zwar permanenten Konflikt, und kämpfen ein Leben lang um die Balance. An den beiden Extremen zeigt sich's, wie's misslingen kann:
- Geht eine*r oder gehen beide Individuen völlig in der Paar-Beziehung auf, verlieren sie ihre selbständige Überlebensfähigkeit und aus dem lebendigen Spannungsfeld ist ein Friedhof „Zum ewigen Frieden“ geworden, in dem beide noch zu Lebzeiten begraben sind. (Und gibt es nicht – Hand aufs Herz – im Leben tatsächlich Momente, in denen wir es unserem*unserer Partner*in äußerst übelnehmen, wenn er*sie allein überlebensfähig ist oder sein will?) “Wenn der Ferdinand noch leben würde, er hätt´ damit keine Freud´” – solche oder ähnliche Sätze hört man oft von alten Frauen, die trotz schon lange verschiedenem Ehemann noch immer in der Zweierbeziehung leben, das eigene Ich ist so fragmentiert, dass es nur mehr selten zutage tritt. „Wir haben nächsten Mittwoch schon was vor” klingt auch deutlich anders als „Die Brigitte und ich haben nächsten Mittwoch schon was vor” oder gar „ICH habe nächsten Mittwoch schon was vor und muss meine Frau noch fragen, wie das bei ihr aussieht...”
- Beharren hingegen die Individuen auf ihrer unantastbaren Identität und Eigenständigkeit, zerbricht die Paar-Beziehung ebenso und reisst nicht selten die Individuen ins gleiche Schicksal mit.
In jedem Fall ist der Zustand der gegenseitigen Abhängigkeit prinzipiell als unerträglich einzustufen, wäre da nicht ein interessanter Mechanismus, der uns dies leichter ertragen lässt: in der Liebe übernehmen Mann und Frau mütterliche Funktionen, geben einander Hautkontakt, Sicherheit, Geborgenheit und empfinden dies auch als durchaus sehr angenehm – und dies nicht ohne Grund: Das Paradigma jeder Paar-Beziehung ist das Mutter-Kind-Verhältnis (und keineswegs das von Mann und Frau). Und auch jede spätere Paar-Konstellation hat gewaltige Anteile dieser Mutter-Kind-Relation an sich (Der ganze Katalog der Zärtlichkeiten stammt aus der frühen Brutpflege, denken Sie nur an die für alle Außenstehenden unerträgliche Baby-Sprache der Verliebten jeglichen Alters). In dieser haben wir die Grundbegriffe und Verhaltensweisen im Paaren gelernt. Das hat enorme Folgen: Denn im Mutter-Kind-Schicksal strotzt es nur so von Abhängigkeit, Macht und Ohnmacht, Liebe und Hass, Anhänglichkeit und ständigem Losreißen, von Verselbständigung und Rückkehr, von Klammern und Flüchten, genüsslichem Verschmelzen und unbändiger Freiheitssehnsucht.
Wenn wir uns die möglichen Beziehungsmuster von Paaren ansehen, dann ergeben sich interessante Konstellationen:
A B A B A B A B
In der linken Graphik sind die beiden in ihrer Paarbeziehung gefangen, es gibt keine wichtigen Außenbeziehungen – hier finden wir auch die infantile Sprache: Schnucki, Mausi, Bärli, Hasi etc.
Die zweite Graphik zeigt eine fortschrittliche Beziehung – es gibt Kontakte nach außen und man ist auch gegenseitig in Verbindung, jedoch nicht ständig und komplett.
Die dritte Graphik ist ein Zeichen für die Hölle, die manche Menschen miteinander haben: einerseits keine wirklichen Beziehungen nach außen, aber auch nicht zueinander. Bei alten Paaren lässt sich diese Konstellation manchmal finden.
Die vierte Graphik zeigt ein Pärchen, bei dem jede*r jeden Morgen aus einer anderen Richtung nach Hause kommt – wenn überhaupt.
Wie gesagt, es ist nicht unser Thema, und das Verhältnis von Individuum und Paar soll uns nur als Analogie dienen für das zwischen Gruppe und Organisation. Nur so viel sei noch allgemein gesagt: Die meisten wollen nun aber sowohl als Individuum frei sein und doch in einer Paar-Beziehung leben. Und sie merken bald, anfangs mit Erstaunen, später mit reifem Ergeben und Genießen, auf welchen Dauerbrenner von Konflikt und Versöhnung sie sich da eingelassen haben. Wo gerade wegen der heftigen Polarität eines nur mit dem anderen wachsen kann.
Man könnte auch sagen: die Ausbalancierung von Individuum und Paar ist das Grundmuster aller Dialektik...
Dreieck und Familie
Konnte man bei Individuum und Paar schon feststellen, dass sie sich als Formen des Zusammen-Lebens gar nicht grün sind, so nimmt das oft dramatische Formen an, wenn etwa eine dritte Person in eine gut eingespielte Partnerschaft tritt. Kommt die Sprache auf Dreiecksbeziehungen, schmunzeln die Leute manchmal ein wenig verhalten und genüsslich - aber nur am Anfang, denn offensichtlich haben sie eher den romantischen Anfang im Auge und nicht das dicke Ende. Nehmen wir wieder eine einfache Grafik:
Frau A und Herrn B sind einander liebevoll verbunden, Herr B und Herr C bestens befreundet, gemeinsame Sportsfreunde etwa. Herr C ist oft zu Gast bei den beiden. Und – man kennt es aus der Literatur – es ergibt sich Sympathie zwischen Frau A und Herrn C. Und eines Tages war's plötzlich mehr. Was tun? Rein summarisch gibt's jetzt mehr Liebe als vorher. Aber ein Dreieck ist weder erklärbar aus der Summe der Personen, noch aus der Summe der Beziehungen. Denn die Personen vertragen sich ja alle. Genau das aber ist das Problem. Denn die Beziehung alpha wird die Beziehungen beta und gamma nicht untangiert lassen. Die Personen vertragen sich, nicht aber die (Paar-)Beziehungen. Und die Paarbeziehungen vertragen sich schlecht mit der Dreieckssituation. Das Gefühl zu diesem Konflikt heißt „Eifersucht“. Je besser es zweien miteinander geht, desto schlechter geht's dem Dritten.
Kurz: Paar und Dreieck vertragen sich äußerst schlecht, und das Dreieck ist der natürliche Feind der Paarbeziehung.
Das sieht man daran, dass in der Kriminal- und Mordstatistik Eifersucht als Tatmotiv an oberster Stelle steht. Da kann einem das ursprüngliche Schmunzeln vergehen. Beim Dreieck geht's offenbar schnell einmal um Leben und Tod.
Natürlich gibt's auch Leute, denen jede echte Paarbeziehung zu eng ist und die bei Gefahr im Verzug sofort in eine Dreiecksbeziehung flüchten, um wieder Luft zum Atmen zu bekommen... Da wird dann das Dreieck zum Verbündeten des Individuums gegen die Paarenge. Aber wenn nur einer der drei mehr will, geht sofort das Drama los.
Was ist nun das Paradigma, Urbild und Prototyp jedes Dreiecks? Vater - Mutter - Kind.
Ehe und Familie vertragen sich daher denkbar schlecht. Wer also beides will, muss die Ehe gegen die Familie verteidigen und umgekehrt die Familie gegen die Ehe, den permanenten Konflikt also pflegen. Wer kennt nicht den liebestötenden Ton im Ohr: Mammi, ich kann nicht schlafen“, bevor sich's die Kinder zwischen den Eltern bequem zu machen suchen. Wer verstünde nicht den alten, lieben, jüdischen Witz: Sarah, erschöpft vom Trubel, den ihr die vier bis fünf Kinder täglich bereiten, fleht ihren geliebten Moische an: Magst mich nicht da rausholen und heiraten?
Wie viele vergessen, sich während des Heranwachsens der Kinder Zeit für die Ehe zu nehmen. Gehen die Kinder aus dem Hause, bleibt oft nur die Konkursmasse der Familie, die meist nicht ausreicht, die restlichen satten 20 bis 30 Ehe-Jahre mit Lebensfreude zu füllen... Genauso müssen aber die Rechte der Kinder auf Erziehung, die Rechte aller auf Familien- Pflege gegen die Ehe verteidigt werden - der zugegeben seltenere Fall.
Also nochmals das Bild und die Phasen des Prozesses: Matristische Familie und Jagdbande der vertriebenen Söhne
Phase I: heftige Freude der Liebenden (A und B) aneinander (Beziehung a)
Phase II: es meldet sich ein Kind (C) an, in der Aussendung steht: wir sind jetzt drei. Wem wendet die Mutter (A) ihre bevorzugte Aufmerksamkeit zu? dem Kinde (C) und der Beziehung (beta); zu wessen Lasten? zu Lasten des Mannes (B) und der Beziehung (alpha). Das heißt die Mutterrolle wird ganz wichtig, die Rollen der Geliebten und der Frau gehen stark zurück – für wie lange? Die Vaterbeziehung ist anfangs natürlich eher marginal (gamma).
Phase III: Trostsuche. Wo tröstet sich der Mann? Entweder bei einer anderen Frau (statistische Befunde zeigen fürs erste Kindesjahr deutliche Signifikanzen). Aber eine andere Frau könnte auch schwanger werden, sie bietet daher den nötigen Trost nur „auf Abruf“. Sichereren Schutz bietet vorübergehend der Stammtisch, der Sportverein, definitiv die Arbeitswelt der Männer (D), Beziehung (delta). Es ist wesentliche Aufgabe der Gruppe, Auffangstation Trostbedürftiger zu sein. Das Resultat ist oft eine alleinerziehende Frau mit ihren Kindern, die Kernfamilie ist noch kerniger geworden, auch wenn die Männer noch zu Hause wohnen oder schlafen. Die Männer versuchen ihr Glück aber eher in der (Arbeits-)Welt, sind nicht wirklich „familialisiert”, wie das die Familiensoziolog*innen nennen.
Phase IV: Gibt's die schon? Wie man sieht, liegen die Entwicklungsmöglichkeiten in den jetzt ziemlich vernachlässigten Beziehungen gamma (Vater-Kind), alpha (Ehe) und epsilon (die beruflichen Außenkontakte der Frau). Sie sind hier stark ausgezeichnet. Leicht wird es nicht sein, die dafür nötigen Energien aufzutreiben. Woher soll nun z.B. der Mann die Kräfte für die stärkenden Beziehungen nehmen? Die Männerbande okkupiert ihn voll, selbst dort, wo nicht einmal mehr genug Arbeit für alle da ist. Lässt man die saloppe Sprache weg, bleibt folgender Befund: nach allen Regeln fortpflanzungsbiologischer [3] paläoanthropologischer [4] und ethnopsychoanalytischer [5] Kunst ist der Mann für die weitere Aufzucht überflüssig. Die Urform menschlicher Sozietät sind – so heißt es – Mütter-Kinder-Gruppen. Diese (matristischen) Gruppen bilden einen „biosozialen Leib“ zum Schutze des Nachwuchses der Gattung. Wie oft braucht diese Gruppe die Männchen? Vielleicht einmal im Jahr. Alle? Sicher nicht, höchstens die ein, zwei Träger des besten Genguts. Um die herauszufinden, müssen die Männchen endlose Rivalenkämpfe bestehen. Der Rest geht entweder dabei zugrunde oder kann sich solitär und frei flottierend durch die Welt schlagen – wahrscheinlich Business Class... . Wann werden die Jungmännchen aus der Mütter-Kinder-Sozietät vertrieben? Natürlich mit ihrer Geschlechtsreife. Dafür sorgen die älteren Männchen, die gerade das (genetische) Sagen haben.
Man denke an den strahlenden Helden der Griechen, den unvergleichlichen Achill. Selbst dieser versteckte sich in Frauen(=Kinder-)kleidern, als ihn Odysseus in den trojanischen Krieg holen wollte. Denn die Knaben wuchsen wie die Mädchen die ersten Jahre bis zur Geschlechtsreife in den Gemächern der Frauen-Mütter auf. Er wäre liebend gerne dortgeblieben und hatte dort auch schon einen Sohn (Pyrrhus mit Namen) gezeugt. Aber Odysseus als Repräsentant der älteren Männer holte ihn von den Müttern und Kindern weg. Um möglichst rasch wieder Zugang zu den Weibchen zu erhalten, wurde Achill ein Held. Held des Krieges, Erfolgsmanager eines großen Konzerns im militärisch-industriellen Komplex – allerdings mit Todesfolge, heldenüblich.
Männer also sind zu einem Großteil genetisch überflüssig, fast alle für die Zeugung, alle für die Aufzucht. Umgangsform unter den Männchen: einsames Streunen oder tödliche Rivalität. Chancen, sein Gengut weiterzugeben: sehr limitiert. Umgangsformen unter den Weibchen: Kooperation zum Zwecke der gemeinsamen Aufzucht der Jungen. Wenig Kooperation zwischen den Geschlechtern.
Wie schon in der Einleitung stellen wir uns jetzt nochmals die Frage: Wie kommt es bei dieser Ausgangslage zum gegenwärtig weitverbreiteten Modell der Arbeitsteilung zwischen weiblich dominierten Einzel-Familien und männlich dominierten Gemeinschaft-Gruppen und Organisationsformen?
Die historischen Rekonstruktionsversuche lesen sich allesamt wie spannende Kriminalromane [6] . Das Resultat ist jedenfalls eine männerzentrierte hierarchische Gesellschaftsordnung mit Monogamieregeln zur Kanalisierung männlicher Rivalitätsenergien.
Die Leistungen der männerzentrierten Hierarchie
Was sind wahrscheinlich die Leistungen von Hierarchie, die bis jetzt offenbar nur um den Preis der Unterdrückung der Frau(en) möglich waren/sind?
Übernahme von Gattungsarbeit („professionelle“ Nahrungsbeschaffung und Verteidigung) durch die Männerbande. Der zentralen Leistung der Mütter, Menschen zu gebären und aufzuziehen, können die Männer endlich etwas entgegensetzen: Produkte (zu Deutsch: Hervorbringungen, Kunst-Kinder). Die Überflüssigkeit der Männchen ist gemildert;
Selbstzähmung der Männchen (Sklaverei und Arbeitswut, Ordnung und Disziplin, Sublimierung), damit die Mütter sie in ihrer und der Kinder Nähe überhaupt dulden;
Aufbau von Allianzen zwischen den Söhnen;
Abflachung des Rivalitäts-Gefälles zwischen den Männchen in der Bedeutung für die Gattung (Fortpflanzung, Weibchennähe); Aufbau von Rangstufen;
„Gerechte“ Aufteilung der Weibchen: jedem Männchen eins (Monogamie als Söhnekartell und Erbfolge vom Vater auf den Sohn);
Zur Sicherung dieses Erbrechts vom Vater auf den Sohn müssen die Weibchen allerdings die Familialbedingungen der Einzelhaft akzeptieren; diesbezügliche Unklarheiten lassen sofort wieder den Krieg der eifersüchtigen Männchen ausbrechen;
Belohnung der außerhäusigen Männerarbeit mit Geld (die familiale Haushalts- und Erziehungsarbeit bleibt „unbezahlbar“, ehrenamtlich). Die Männer werden dadurch in den Familien zu Arbeitgebern ihrer Frauen, Frauen von ihren Erhaltern abhängig. Hätten sie sonst an diesem Modell von Ehe, Familie und Monogamie Interesse?
Die Weibchen erhalten als „Gegengabe“ die Herauslösung aus der alles total kontrollierenden Mütter-Bande;
Garantierter Schutz (Nahrung und Verteidigung) für die eigene Brut - mit dem Fazit: Jedes Männchen und jedes Weibchen erhält Garantien dafür, eigene Kinder zu haben, der Unsterblichkeit des eigenen Gengutes sicher zu sein;
Das erlaubt die ständige Nähe der Männchen bei den Frauen, deren Zugehörigkeit zur Sozietät. Allerdings herrscht beständig die Angst, dass jede Änderung der Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern dieses fragile System sozialer Errungenschaften gefährde.
Insofern besteht eine grundsätzliche Systemunverträglichkeit von (vaterferner) Familien- Gruppe und (mütterferner) Männer-Jagdbanden-Gruppe (Beruf und Arbeitswelt).
Wenn daher heute die Frauen a) in die Berufswelt drängen, b) öffentliche Rechte im Berufs- und im gesellschaftlichen Leben geltend machen, c) gemeinsame Verantwortung für Kinderaufzucht und Familienerhalt fordern, d) sich in der Ehe Männer statt Söhne wünschen, Liebhaber statt Pflegefälle, Freunde statt Arbeitgeber, dann rüttelt das an den Grundfesten der traditionellen Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern, zwischen Familie und Berufswelt und gefährdet den höchst zerbrechlichen Frieden innerhalb der „reinen“ Männerbande. Es steht viel auf dem Spiel. Es wäre jedoch viel zu gewinnen – auch für die Männer. Das Thema wird uns auch bei der Besprechung der Gruppe noch einmal einholen.
Die alte Fragestellung lautete: Welchen Mann, welche Frau, welche Familie und welche Organisation muss sich daher die (Männer-)Organisation im Spannungsfeld Beruf - Familie wünschen?
Die neue Frage lautet eher: Wie könnte eine Organisationsform und die Arbeitsteilung von Familie und Berufs-Organisation aussehen, in der sich Männer und Frauen die Verantwortung für die Familien- und Berufsarbeit wirklich gerecht teilen?
Es gibt Anzeichen einer Veränderung:
Frauen müssen nun – seit Geburtenkontrolle und Berufstätigkeit – die mit ihrer Rolle in der Männer-Gesellschaft verbundenen Abhängigkeiten nicht länger hinnehmen. Sie wehren sich, weil sie auch außerhalb der traditionellen Rollennormen überleben müssen und können. Sie müssen sich dann zwar oft als Alleinerziehende am Rande der neuen Armut durchkämpfen, sind dafür aber auch frei und nicht mehr erpressbar.
Aber es gibt auch Anzeichen, dass den Männern der Preis ebenfalls zu hoch geworden ist a) sowohl in den Männer-Organisationen, b) als auch in ihren Ehen und Familien. Sie fragen sich: Wie viel müssen wir uns – als Arbeits-Sklaven – gefallen lassen, um zu gefallen? oder: Auf wie viel Leben will ich (arbeitend) verzichten, nur um zu überleben? oder: Welche interessante Frau will auch die zweite Lebenshälfte mit einem arbeitswütigen Pflegefall verbringen?
Conclusio: Die Liebe der Frauen erwies sich als Fürsorge von Müttern, die Arbeit der Männer als domestizierende Selbstversklavung der Söhne. Vielleicht finden wir doch noch Möglichkeiten, die Errungenschaften von Matriarchat und Patriarchat zu retten, ohne dass entweder ein Geschlecht das andere oder beide sich wechselseitig über Gebühr unterdrücken müssen? In jedem Fall sind wir nun reich und reif genug für eine neue Runde des Geschlechterkonflikts.
Bevor wir den Faden, der uns über die Gruppe (als Männerbande) zur Organisationsdynamik führen soll, wieder aufnehmen, eine Zwischenbemerkung: Bei aller Frauen-Zugewandtheit handelt es sich bei dieser Sicht um eine Männer-Theorie. Wir wissen, dass viele Frauen sie zwar sehr faszinierend finden, aber fest überzeugt sind, es müsste auch eine weibliche Variante geben, diese Geschichte zu erzählen. Hoffentlich ist sie bald zu hören. Ansätze gibt es ja.
Die Gruppe
Warum sich Gruppen bilden
Es bleibt jedoch die Frage: Warum bilden sich überhaupt Gruppen? [7] Es gibt keinen Grund, Gruppen zu bilden, es sein denn aus Not. Eine gewissermaßen prototypische Notsituation ergibt sich dadurch, dass alle Kinder irgendwann von ihrer „natürlichen“ Nahrungsquelle, der Mutterbrust, lassen müssen - sei es, weil jüngere Geschwister kommen, sei es, dass die Mutter stirbt oder ihre Ressourcen selbst braucht, nicht mehr will usf.
Die Trennung von der Mutter durch das Abstillen kommt zunächst einer Verstoßung gleich, obwohl sie in der Folge natürlich die Tür zur Autonomie auftut. In manchen Elendsvierteln dieser Welt ist damit auch die Phase der Fürsorge durch die Mütter schon erledigt. Wer dann nicht für sich selber sorgen kann, geht zugrunde.
Wenn weiters – wie im vorigen Abschnitt ausgeführt – die Mütter-Kinder-Gruppen die ursprünglichen Sozietäten sind, so haben doch Knaben und Mädchen ein unterschiedliches Schicksal. Die Knaben müssen anlässlich dieser Verstoßung aus dieser Gruppe raus, die Töchter bleiben, übernehmen Brutpflegeaufgaben (aunting), werden später selber Mütter usf.
Dadurch entsteht bei den vertriebenen Knaben das Bedürfnis nach der Kreation einer noch nie dagewesenen Sozietät geweckt: der Gruppe. Dieser Gruppenbildung geht eine gemeinsam erlebte Verlusterfahrung voraus, die zu Solidarität und Gemeinsamkeit führt. Die Grundlage dafür bildet ein Bewusstsein gleichen Schicksals, die Identifikation mit anderen in gleicher Notlage. Dadurch kommt es zur Bildung eines sozialen Leibes, um den Schreck nicht zu groß werden zu lassen und durch die artifizielle Nachahmung des mütterlichen Leibes wieder Sicherheit zu erlangen.
Ein weiteres Element der Gruppenbildung ist die Suche nach einer Autorität, die über die Kompetenz verfügt, diese schreckliche Notsituation auch zu meistern und Schutz vor weiteren tödlichen Verstoßungen zu gewährleisten. Erlösungshoffnungen kommen auf.
Diese Autorität kann entweder durch das Los bestimmt, oder, wie die Buddhas, als ein besonderes Kind in irgendeinem Kloster gefunden werden. Diese Auswahl findet nach keinen bestimmten Qualifikationen statt. Ausschlaggebend sind die Erwartungen und Hoffnungen der Leute. Die gefundene Autorität muss keinerlei Beweise für die Rechtfertigung ihrer Position erbringen, wenn sie nur als Brennpunkt aller Hoffnungen dient, wobei sich dieser Vorgang ohne jede Verständigung untereinander vollziehen kann. Der soziale Leib hat noch keine Konturen. Zugehörigkeit ist nicht wichtig, es ist ohne Belang, wer da neben mir steht, wenn nur alle Hoffnungen in Erfüllung gehen. Ähnlich wie die Angst eine unspezifische ist, entsteht eine ebenso unspezifische Hoffnung auf einen Heiland, einen Gott, auf irgendeine Erlösung des Ereignisses, auf einen Führer oder auf einen heiligen Stein, auf irgendeinen Kondensationspunkt, auf den man die Ängste im Bezug auf diese Notsituation richten kann. Und von dem man erwarten kann, dass diese Not auch bewältigt wird. Wird die Not durch diesen Kondensationspunkt auch bewältigt, erscheint der Gott oder spricht der Priester oder spricht die Autorität, und damit ist die Angst bewältigt, dann wird der Gruppenprozess abgebrochen und wir haben weiterhin keine Notwendigkeit, uns zu solidarisieren. Solange diese Heilserwartung erfüllt wird, ist es doch völlig nebensächlich, wer neben mir steht. Es ist kein Bedarf dafür da, darauf zu achten, wessen Gesichter ich da sehe, welche Menschen da in meiner Umgebung sind.
Schwierig wird die Situation, wenn der Kristallisationspunkt, auf den sich alle Hoffnungen richten, den Erlösungshoffnungen nicht Rechnung tragen und die Not nicht wenden kann. Dann muss der soziale Leib wieder zerfallen und seinen wärmenden Schutz verlieren. Wenn die Urangst der Verstoßung wegen des Verfalls der Autorität wieder auftritt, muss die Unsicherheit der Verstoßenen auf andere Weise beseitigt werden.
Der soziale Leib muss zerfallen, wenn er besonders vielen seine Zugehörigkeit versprochen hat. Dann wird es wichtig, sich mit anderen zusammenzutun, die anderen überhaupt wahrzunehmen und ein neues Gefühl der Zugehörigkeit zu entwickeln. Dann trägt nicht mehr irgendeine von außen ersehnte Erlöser-Autorität die Hoffnungen, sondern die Gruppe, deren besonderes Merkmal darin besteht, dass sich an den Gruppenprozessen alle Teilnehmer*innen gleich beteiligt fühlen. Diese Gruppen definieren sich in ihren Erwartungen selbst.
Erst ein Minimum an Zugehörigkeitssicherheit erlaubt es den Mitgliedern der Gruppe, ihrer Enttäuschung über die ausgebliebene Erlösung durch eine Autorität zu artikulieren. Gemeinsam lässt sich das Versagen von Autorität ertragen. Das soziale Trennungstrauma wird nochmals durchlebt, aber gemeinsam mit der Gruppe ertragen und verarbeitet.
Jede Autorität (Macht) ist von der mütterlichen abgeleitet – lebensspendend, lebenserhaltend, ernährend, schützend. Frauen sind dabei nicht in derselben Notlage wie die Männer, weil sie sich grundsätzlich immer gegen Trennungen absichern können – durch ihre eigenen Produkte, die Kinder. Männer haben nichts anderes als sich und ihre Solidarität mit anderen Männern.
Melanie Kleins Beschreibung des Anfangs aller Kommunikation oder Beziehungsaufnahme durch Projektion und Introjektion [8] lässt sich vereinfacht für das Verständnis des Lebens von Gruppen so nützen, dass man sagt: Die ganze Gruppenentwicklung ist eine Annäherung an sich selbst durch die Auseinandersetzung mit Außenseiter*innen. Alle Unterschiedlichkeiten in Gruppen sind Autoritäts- und Bedrohungspotentiale zugleich.
Denn in dem Augenblick, da Menschen ernsthaft aufeinander angewiesen sind und miteinander etwas tun müssen, werden die Unterschiede, die zwischen ihnen bestehen, bedrohlich, machen mit aufkommender Wahrnehmung von Fremdheit Angst. Gruppenentwicklungsstufen (als Angstentwicklungsstufen) sind verbunden mit dem ständigen schrittweisen Prozess von Ausschluss und Integration von Außenseiter*innen. Gruppen suchen sich für das Dilemma der jeweiligen Situation, die sie zu bewältigen haben, Exponent*innen als Außenseiter*innen, die für sie zunächst die Gefahr verkörpern und daher von der Gruppe abgelehnt werden. Gruppen lehnen also in ihnen ihre eigene Fremdheit und Angst ab. (Es ist übrigens auch nur eine spezielle Außenseiterposition, wenn von jemandem die Lösung der Not erwartet und ihm Autorität verliehen wird.)
Erst die Bearbeitung dieser Außenseiter*innen und Außenseitersituation – was oft auch mit Herrschaftsgefälle verbunden ist – ermöglicht es, die Unterschiede in die Gruppe zu integrieren, den abgespaltenen Teil seiner selbst in dem*der Außenseiter*in zu erkennen. Dann lässt sich die Verschiedenheit von Menschen zur Bewältigung von Situationen nützen.
Als relevante Unterschiede bieten sich natürlich die Geschlechterdifferenz, der Altersunterschied, Unterschiede an Schichtzugehörigkeit, Position, Einkommen usw. an, was eben jeweils die „Not“, das „Ziel“, die „Aufgabe“ einer Gruppe sein mag.
Ab welchem Augenblick werden die einzelnen Personen einer Gruppe wahrgenommen? Sie bekommen ein eigenes Gesicht, sobald Kompetenzansprüche gestellt werden können, jemand einen anderen kritisiert, ein Mitglied konkrete Hilfe braucht oder ein Feedback gibt. Bei einer wechselseitigen Abhängigkeit, der sogenannten Interdependenz, ist jeder vom andern gleichwertig abhängig. Nicht eine Person ist für alles verantwortlich, sondern jede Person für irgendetwas. Es gibt eine gemeinsame Sprache, jede Person wird einzeln wahrnehmbar; sind Konflikte und krasse Widersprüche erst einmal durchgestanden, so bereichern sie die Gruppe, anstatt sie zu bedrohen. Alle sind so gleich, dass sie wieder unterschiedlich sein können. In der beschriebenen Situation wird die Gruppe nicht durch das Individuum bedroht, sondern bereichert. In der Differenzierungsphase muss Unterschiedlichkeit unterdrückt werden, weil die Gefahr des Auseinanderbrechens besteht. Der gemeinsame Feind ist die schlechte Autorität, Gleichheitsparolen, Gleichmacherei herrscht vor, denn Unterschiede und Zweifel bedrohen die Gruppe. In der Reifephase dürfen Zweifel geäußert werden, die Meinungen einzelner werden ernst genommen. Jeder kann zeitweise hinausgehen und wieder hineinkommen, ohne den Verlust der Zugehörigkeit fürchten zu müssen. Die Gruppe kann es wagen, sich anderen Gruppen mit anderen Zielen und Wünschen auszusetzen.
Die Gruppe ist wiederum – wenn wir bei der abstrakten Formel beginnen wollen - mehr als die Summe ihrer Individuen, aber sie ist auch nicht nur die Summe der Beziehungen zwischen den Personen, sondern viel mehr die Beziehung zwischen den Beziehungen: der Gruppenprozess. Das klingt nicht nur abstrakt, sondern ist es auch – und zwar auch in Wirklichkeit für die meisten Menschen. Denn was wir im bildsamsten Alter an Formen des Zusammenlebens gelernt haben, waren meist: die Paar-Beziehung, allenfalls Dreiecks- Konstellationen und Familien Strukturen, in denen der Vater und vielleicht Geschwister zur Mutter-Kind-Dyade schrittweise dazugekommen sind. Selbst dabei denkt man doch noch immer in abwechselnd konkurrierenden oder koalierenden Paaren. Aber die Eigenständigkeit des Gruppenprozesses, der sich für vakante Gruppenfunktionen einfach die Träger*innen sucht, egal ob es denen persönlich passt oder nicht, ist uns kaum vertraut. Das ist mit der wirklichen Abstraktheit gemeint.
So etwa duldet die Gruppe innerhalb ihrer Grenzen kaum Untergruppen und hat für sie nur böse Worte wie Klüngel, Grüppchen, Clique usf. Denn die Gruppe fühlt sich in ihrer Einheit sehr rasch bedroht durch die „früheren Formen des Zusammenlebens. Sie verlangt unmittelbaren Zugriff zu jedem Individuum als Mitglied; setzt Normen und Sanktionen, denen sich ein einzelner kaum widersetzen kann (Gruppendruck), wohl aber Paare und Untergruppen. Die Gruppe reagiert in diesem Punkt sehr eifersüchtig und kennt keinen Spaß. Die gleiche Eifersucht finden wir, wenn es sich ein Mitglied einfallen lassen sollte, auch noch zu anderen Gruppen gehören zu wollen. Nicht selten steht darauf die Strafe des Ausschlusses.
Eine graphische Darstellung zeigt nur das ideale Bild, jede*n mit jedem*jeder gleich kommunizierend, bei gleichzeitiger Zerstörung diverser Untergruppierungen. In Wahrheit ist diese Gleichheit natürlich nicht gegeben, Funktionszuteilungen schaffen oft auch ein Gefälle an Einfluss und Zuwendung. Ein Naturgesetz, dass jede Gruppe eine*n Führer*in brauche oder diese*r sich früher oder später herauskristallisiere, gehört ins Reich der Fabel, die mehr über die Ideologie mancher Leute aussagt als über ihre Beobachtungsgabe. Historisch gesehen geht die Funktionszuteilung von primär in Gruppen lebenden Populationen nur so weit, dass im Ernstfall doch noch jeder jeden ersetzen kann, also noch alle alles irgendwie können (vorarbeitsteilig).
Das Paradigma für die Gruppe ist in unseren Breiten die eingeschlechtliche Pubertätsgruppe der frühen Adoleszenz. Denken Sie daran, wie sehr etwa Bubenbanden in der Pubertät zusammenstecken und alles Weibliche für dumm, kindisch und abartig halten. Wer sich dennoch für Mädchen interessiert, gilt als unmännlich, weich, feig, abtrünnig, verräterisch und hat mit dem Ausschluss zu rechnen. Und tatsächlich ist die Gruppe ja durch Paar und Familie (alte wie künftige) ebenso gefährdet wie das Paar durch die Individualität:
Paar und Familie, in denen ja Mütterlichkeit und Weiblichkeit eine zentrale Rolle spielen, sind die natürlichen Feinde der Gruppe.
Obwohl es etwas Lächerliches hat, wenn solche Pubertätsgruppen überdauern (der*die dreißigjährige Pfadfinder- oder Jungschar-Führer*in, die greisen Leiter*innen parteilicher Jugendorganisationen usf.), geben sie doch das erste Muster der Kriegs- und Arbeitswelt ab.
Das Paradigma, an das die Gruppe anschließt, ist die Pubertätsbande, der aus dem von den Frauen und Müttern dominierten Aufzuchtsverbande vertriebenen Jünglinge. Diese findet als Jagd- und Kriegerbande ihre kontinuierliche Fortsetzung.
Gruppen von Frauen finden sich in dieser Form eigentlich nicht, da sie, auf die Aufzucht des Nachwuchses spezialisiert, sich in immer neue Bezugspersonen aufgeteilt haben. Die Forderung, Männer und Frauen sollten in Gruppen gleichberechtigt zusammenarbeiten können, erscheint angesichts dieser Herkunftsgeschichte der Gruppe (in unseren Breiten) als purer Widersinn. Frauen haben in (Männer-)Gruppen überhaupt nichts zu suchen. Dieser Denkweise erscheint der Satz als glatte Tautologie.
Was geschieht, wenn ein Frau Abteilungsleiterin wird und zum ersten Male in der Abteilungsleiterbesprechung auftaucht? Sie darf Kaffee machen, Protokoll schreiben, und wenn sie etwas Gescheites sagt, ruft man(n): lauter bitte! Diese massive Aggressivität hat den Ausschluss zum Ziel. In der Erfindung geeigneter Methoden sind die Männer unerschöpflich. Einige Varianten: 1. die Frau in der Männergruppe wird zum Weibchen des Chefs (egal, ob sie das will oder nicht), denn er hat schließlich für Ordnung zu sorgen. Sie spielt da manchmal mit, weil sie auf diesem Wege Macht über viele Männer auf einen Schlag gewinnt. 2. Oder sie wird nach höchst beunruhigender Konkurrenz- und Gockelphase mit dem Sieger liiert. Paarbildung zum Zwecke des Ausschlusses. Denn schließlich hat ja sonst fast jeder draußen auch eine Frau - privatim. Also ist wieder Ruhe. 3. Oder sie macht sich zur dienenden Mami der ach so wichtigen jungen und alten Jünglinge, die ja doch immer wen brauchen, der ihnen ihre Termine ordnet und die Flecken aus der Krawatte putzt. 4. Oder sie übernimmt die männlichen Standards und übertreibt sie auch noch (oft unter Verlust ihrer Eigenständigkeit). 5. Oder ..., 6. Oder ...
Gruppen- und Organisationsformen, die ein freies Zusammenarbeiten von Männern und Frauen erlauben und für selbstverständlich halten, kennen wir in unseren Breiten kaum. Unsere Gruppen- und Organisationsformen sind vielmehr selbst ein Bestandteil der Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern zum wechselseitigen Ausschluss aus dem eigenen Gebiet.
Die rituelle Vergatterung durch Initiationsriten, aber auch später immer wiederkehrende Prüfungen, Mutproben und Leistungsnachweise festigen den Zusammenhalt der Gruppe nach außen. Und die Macht, die man ruhig Gruppendruck nennen kann, lässt sich am ehesten gegen die feindlichen und fremden Anderen mobilisieren. Das weiß jede Führungskraft, die irgendwann im Leben Menschen „motivieren“ musste.
Wie lässt sich nun erreichen, dass Gruppen, die ihrer Natur nach eigentlich gar nicht wollen, dennoch miteinander kooperieren?
Organisation
Erinnern Sie sich an die Einleitung. Dort war davon die Rede, dass dem wechselseitigen Vernichtungskampf feindlicher Stämme durch den Tausch von Menschen und Sachen ein Riegel vorgeschoben werden sollte: das Netz von Verwandtschaftsbeziehungen, die aus dem früheren Feind einen Schwager machten, mit dem man Arbeitsbündnisse zur arbeitsteiligen Unterstützung oder Handelsvereinbarungen schließen konnte. Die wechselseitig ausgetauschten Menschen (meist Frauen) garantierten als Geiseln das Wohlverhalten beider. Wir nannten dies die Geburtsstunde der Organisation.
In der Organisation geht es um übergreifende und arbeitsteilige Kooperation von deutlich voneinander abgegrenzten Gruppen im Dienst des Überlebens einer größeren Gemeinschaft. Dies forderte dem Menschen die Erfindung zahlreicher neuer Elemente im Zusammenleben ab, die zu den größten Kulturleistungen zählen, die wir kennen: sie stehen alle unter dem Obertitel Instrumente der Verträglichkeit. (Unter Verträglichkeit verstehen wir all das, was Menschengruppen in den Stand setzt, Vereinbarungen zu treffen, in dauerhafte Formen zu gießen und ihre Einhaltung zu überwachen.)
Dazu gehören Mittel der indirekten Kommunikation, Normen, Strukturen, Gesetze, Schrift, Wissenschaft, Delegationssysteme, Beratungs- und Entscheidungsmodelle, Bildung gemeinsamer Mythen, Riten und Gebräuche ...
Organisation macht aus den Spannungen, die aus der Verschiedenheit der Menschen und Menschengruppen kommen, ein permanentes und unumgängliches Lernfeld des gemeinsamen Menschseins. Wie die Gruppe von jedem Individuum einen Preis für die Zugehörigkeit verlangt, so zieht auch die Organisation den zugehörigen Gruppen einen Teil ihrer Lebensenergie ab. Der Streit um die Gemeinkosten ist so alt wie Organisation überhaupt. Denn die Frage nach der Gerechtigkeit, aus dem Futterneid der Geschwister geboren, nimmt in den Dimensionen enorm zu.
Suchen wir wieder nach einer Formel nach der schon bekannten Methode, so wird uns nicht wundern, dass sie - mit ihrem Gegenstand zusammen - noch abstrakter ausfallen wird als bei der Gruppe:
Organisation...
- ...ist nicht die Summe ihrer Individuen
- ...ist nicht die Beziehung der Individuen (wie im Paar)
- ...ist nicht die Summe der Beziehungen zwischen mehreren Individuen (wie bei Dreieck, Familie und Gruppe),
Organisation ist vielmehr das System der Beziehungen zwischen Gruppen, die selbst wieder Beziehungssysteme von Beziehungen sind.
Wer kann so etwas verstehen? Kommen da die Individuen und Persönlichkeiten überhaupt noch vor? Spielen da persönliche Gefühle überhaupt noch eine Rolle? Ist da noch Platz für Menschen? Es ist wahr, Organisationen können sich um Individuen, persönliche Gefühle, ja um die Schicksale ganzer Gruppen nur am Rande kümmern. Sicherlich würden Gruppen (und Individuen) den Preis, den sie beim Eintritt in Organisationen zahlen müssen, nicht entrichten, wenn sie auch ohne überleben könnten. Sie können aber nicht.
Die Organisation geht aber unter diesem Titel noch weiter. Sie rührt an das Allerheiligste der Gruppe: Sie verlangt nämlich, dass ständig Menschen die Gruppe neu zu betreten und wieder zu verlassen haben. Das geht jeder gefestigten Gruppe gegen den Strich. Organisation muss die Grenzen, die die Gruppen um sich gezogen haben, immer wieder öffnen und durchlässig machen (wie die Paarbeziehung die Grenzen des Individuums).
Die Gruppe ist der natürliche Feind der Organisation, und die Organisation der natürliche Feind der Gruppe.
Nur unter beträchtlichem Leidensdruck sehen Organisationen ein, dass sie auch gut funktionierende Gruppen brauchen („In Wahrheit Nester von Widerstand und egoistischen Umtrieben!“), oder Gruppen, dass sie im Rahmen der allgemeinen Verträglichkeit ihre Rechte nur von der Gesamt-Organisation garantiert erhalten können. Wer sieht schon gerne ein, dass er*sie seinen Bestand nur dadurch sichern kann, dass er*sie seine ständige Gefährdung durch den „Hauptfeind“ duldet?
Zur graphischen Darstellung: Wir zeichnen von den vielen Möglichkeiten diejenige heraus, die verschiedene Gruppierungen zeigt, die durch eine Gruppe höherer Art zusammengehalten werden, nämlich der Gruppe der Repräsentant*innen.
„Menschentausch“ und Repräsentation
Im Laufe der Geschichte haben die Menschen unendlich viele Variationen des Austausches von Menschen erfunden. Wir wenden uns im Folgenden nur mehr den bei uns gesellschaftlich und wirtschaftlich dominierenden Männer-Organisationen von Männer-Gruppen zu (was sie auch bleiben, selbst wenn dort mehrheitlich Frauen beschäftigt sein sollten), und lassen die anderen Formen etwa von Familial-Organisationen, Sippen, Stämmen etc. (ungern, aber doch)beiseite.
Subjekte des Austausches konnten Händler*innen, Repräsentant*innen, Unterhändler*innen, Abgeordnete, Abgesandte, Bot*innen, Herold*innen, usf. sein.
Alle haben gemeinsam, dass sie nicht bloß als Individuen, sondern als Vertreter*innen einer Gruppe sprechen. Repräsentieren heißt zu Deutsch vergegenwärtigen. Repräsentant*innen also haben ihre Leute, die selbst nicht anwesend sein können, während doch ihre Sache und ihre Interessen abgehandelt werden, zu vergegenwärtigen.
Stellen wir uns nun eine Verhandlung zwischen streitenden Parteien vor, die zu allem Unglück auf ein gemeinsames Auskommen angewiesen sind. Nichts als Fallen und Klippen. Nennen wir die eine Gruppe die Weißen und die andere die Schwarzen, die sich zu Verhandlungen treffen. Was ist bis dahin schon alles geschehen und entschieden?
In den Gruppen müssen irgendwie die Ziele abgesteckt und besprochen sein.
Es schwirren sicher eine Menge wahrer und unwahrer Informationen über die Absichten der Gegenseite herum. Konflikte beruhen oft darauf, dass man sich nicht mehr unterhält, also bezüglich der Interessen und Absichten der anderen auf Vermutungen und Kombinationen angewiesen ist.
Es muss entschieden sein, wer die Gruppe repräsentieren soll. Dies ist von größter Wichtigkeit. Zentralpersonen haben zwar meist großes Pouvoir, aber ansonsten wenig Spielraum und Beweglichkeit. Periphere Personen einigen sich mit den anderen zwar schnell, weil sie froh sind, endlich wichtig zu sein; aber sie können ihre Resultate „zu Hause“
kaum durchsetzen.
- Gibt es feste Repräsentationsregeln? In unseren Unternehmungen behalten sich Chef*innen sehr oft die Vertretung nach außen vor.
- Welchen Einfluss haben diese Vorgänge auf die Einfluss- und Machtverteilung innerhalb der Gruppe?
- Welche Leute von der „Gegenseite„ werden als Verhandlungspartner*innen akzeptiert, welche nicht? Was ist dadurch schon vorentschieden? Art, Dauer und Umfange des Mandats.
Diese Liste ließe sich beliebig verlängern (Ort, Zeit, Mandat..., wo wird entschieden: in den Gruppen? im Delegierten-Rat? sonst?)
Kommt es nun endlich zur Verhandlung, etwa auf neutralem Boden, so müssen beide Repräsentant*innen ihre Heim-Gruppen räumlich und emotional verlassen und bis zu einem gewissen Grad in die neue Gruppe der Repräsentation eintreten.
Zuerst werden sie versuchen, die Wünsche ihrer eigenen Gruppe so gut und eindrucksvoll wie möglich zu vertreten. Dann aber müssen sie sich nolens volens mit den anderen, fremden und womöglich feindlichen Argumenten konfrontieren lassen.
Konflikte sind oft die einzige Art, wie man jemanden zwingen kann, einem zuzuhören. „Streiten muss man, bis man etwas erfährt von Dir!" Oder denken Sie an den Sinn des endlosen Feilschens auf einem arabischen Markt. Stundenlang erzählt man sich, wer man ist, wo man war, was es alles gibt, wie wertvoll doch die Ware sei usf., und dazwischen kommt man sich schrittweise näher im Preis, bis man etwa dort endet, wo beide vorher wussten, dass sie sich treffen würden. Übrigens: Die sicherste Methode, sich von den Argumenten des*der Gegner*in nicht beeinflussen zu lassen, ist das Nicht-Zuhören, eine sehr weit verbreitete und hochentwickelte Fähigkeit!
1.) DIE GEGLÜCKTE VERHANDLUNG
Läuft eine Verhandlung gut, werden sich die Repräsentant*innen von Weiß und Schwarz so einigen, dass beide hoffen können, ihre Heim-Gruppen würden zufrieden sein.
Gelingen wird dies nur, wenn der*die „weiße“ Repräsentant*in auch die Anliegen der „Schwarzen“ verstanden und in die gemeinsame Lösung eingebaut hat, kurz: wenn er*sie sich ein wenig „einfärben“ ließ. Und umgekehrt: Nach einem Kompromiss wird auch der*die „Schwarze“ mit einigen weißen Flecken heimkommen.
Gretchenfrage: Was wird die Heim-Gruppe an dem*der eigenen Repräsentant*in und an der Lösung als erstes bemerken, wenn er*sie heimkommt? Die „Schwarzen“ werden sofort die weißen Flecken bemerken und ihn (bewusst oder unbewusst) des Verrates verdächtigen. Dasselbe bei den „Weißen“.
Ist das nun eine Panne, persönliches Misstrauen, menschliche Schwäche oder aber eine notwendige Klippe jeder Organisation?
Es ist eine notwendige Klippe: Denn der*die Repräsentant*in geht weg als Abgesandte*r der Heim- Gruppe und kommt – wenn er*sie gut ist – als Abgesandte*r und Botschafter*in der fremden Gruppe wieder. Man denke an die blühenden Phantasien, die in den Köpfen der Zurückbleibenden und Repräsentierten gedeihen. „Was wird er*sie herausholen?“ „Wird er*sie sich zu uns und unserer Arbeit bekennen?“ „Wird er*sie denen endlich einmal sagen, welche Schwierigkeiten sie uns ständig machen?“ „Wird er den großmäuligen Verkäufer*innen endlich sagen, dass wir genaue Protokolle von den Verkaufs- und Anbahnungsgesprächen brauchen (Was ja Verkäufer*innen besonders lieben)?“ Oder: „Wird er uns wieder einmal verraten, verkaufen oder gar überlaufen? ... sich von seinem*seiner Chef*in jede Drecksarbeit zuschieben lassen, die wir dann machen müssen?“ usw.
Wenn man beobachtet, wie viele Gespräche in und außerhalb der Arbeitszeit über die jeweiligen Chef*innen geführt werden, wie viele Vermutungen, Hypothesen, Ahnungen, Hoffnungen an deren Person geheftet werden, kann man sich nur wundern. Ich glaube, dass dies so zu verstehen ist, dass sich das Unberechenbare und Abstrakte der Organisation als numinoser Schein an dem*der jeweiligen Chef*in festmacht. Es sind fast religiöse Kategorien, in denen sich diese Allmachtsphantasien, besser Phantasien von der Allmacht der Organisation und ihres*ihrer Chef*in ausdrücken. Die Angst, an die anderen oder die kalte Macht der Organisation verraten zu werden, ist nur die Kehrseite.
Um diesem Verdacht des Verrats entgegenzutreten, schildern die heimkehrenden Repräsentanten die Verhandlung oft als heroische Schlacht, in der sie dem*der Gegner*in das Letzte herausgerissen hätten. Durch diese aggressive Pose wollen sie sich nach der gefährlichen Situation des Fremd-Gehens wieder als vertrauenswürdiges Mitglied der Gruppe legitimieren.
2.) DIE WENIGER GEGLÜCKTE VERHANDLUNG
Zwei Arten von Vertreter*innen sind daher unbrauchbar:
Diejenigen, die den anderen gut zuhören, deren Argumente voll übernehmen, d.h. sich voll einfärben lassen. Damit aber verraten sie ihre Heimgruppen, können sich schnell mit den Partner*innen einigen, werden aber ihre Verhandlungsresultate in der eigenen Gruppe nicht durchsetzen können.
Die anderen sind aber ebenfalls unbrauchbar, die heroisch von Interesse und Auftrag der Heim-Gruppe kein Jota abweichen und von den anderen gar nichts annehmen (also rein bleiben. Im Mittelalter nannte man die Leute, die um jeden Preis rein bei ihrem Glauben blieben, ohne mit den anderen auch nur zu reden, die Reinen, Katharoi - zu Deutsch Ketzer). Sie kommen zwar rein, aber ohne Ergebnisse heim. Sie haben nichts vom Stallgeruch der anderen angenommen, aber auch keine Resultate erzielt, die beide Gruppen gemeinsam tragen könnten.
An dem Spannungsfeld, in das jede*r Repräsentant*in gerät: gehört er*sie jetzt mehr zu seiner*ihrer Heim-Gruppe oder zur Repräsentanten-Gruppe – dort lässt sich Organisationsdynamik mit Händen greifen. Wer von uns hätte nicht schon die Enttäuschung erlebt, wenn man im besten Glauben eine gute Lösung ausgehandelt hat, und die Heim-Gruppe sagt plötzlich: „Das können wir nicht akzeptieren, da stehen wir nicht dahinter. Da musst du noch einmal hingehen. Oder wir schicken eine*n andere*n (bessere*n) Vertreter*in ...“ Dann sind wir mehrfach bloßgestellt: unfähig und nicht gewürdigt bei den eigenen, schwach und nicht durchsetzungsfähig bei den fremden Leuten.
Ein Gutteil des Organisationslebens hängt davon ab (und lässt sich daraus verstehen), wie diese Kontakte strukturiert sind, wie Entscheidungen Zustandekommen, welche Folgen sie für die Gruppen und ihre Individuen haben.
Es ist aber zu mühsam, sich die Bedingungen der Verträglichkeit jeden Tag neu aushandeln zu müssen. Daher stellen Organisationen ihre Umgangsformen auf Dauer, gießen sie in geschriebene und ungeschriebene Gesetze, stützen sie mit Strukturen ab. (Zuletzt leisten sie sich meist auch eine Ideologie. Dafür hat man ja die Wissenschaft. Die wird doch - nach allem - auch noch zu bezahlen sein. Religionen haben oft versucht, die jeweils mächtigen Strukturen als göttlich und natürlich abzusegnen und so dem Änderungswillen unzufriedener Gruppen zu entziehen.)
Aus der Dauer und Zähflüssigkeit von Strukturen ziehen Menschen und Gruppen einen enormen Entlastungsgewinn. Man muss nicht ständig um seine Rechte kämpfen, sondern kann sie als garantiert betrachten und zur Tagesordnung übergehen.
Bildlich geredet: In der Gruppe kann ich jemanden um ein Glas Wasser bitten, wenn ich Durst habe. Und der kann's mir verwehren oder geben. Auf dem Marktplatz der Organisation hingegen wird zwischen den verschiedenen Gruppen ausgestritten: Wohin und zu wem und auf wessen Kosten bauen wir eine Wasserleitung? Und ich werde lange Zeit Wasser haben (und daran nicht denken müssen), wenn ich bei diesem Handel gut vertreten war/habe, und ich werde auf lange Sicht Probleme mit meinem Wasser haben, wenn meine Interessen dort nicht gut vertreten waren. Und so mit allen wesentlichen Bedürfnissen des Menschen bloßgestellt.
Repräsentation und Hierarchie
In unseren männerrechtlichen und oft zu Hierarchien (zu Deutsch: Heilige Herrschaft) erstarrten Organisationen wird dieser Austausch von Menschen als Vertreter*innen der jeweils abwesenden Anderen systematisch betrieben-
Nehmen wir irgendeine Hierarchie als Beispiel: und betrachten wir darin das Schicksal der Führungskraft. So gehört der Hauptabteilungsleiter C, nennen wir ihn Meier, einmal zur Gruppe der Hauptabteilungsleiter*innen.
Daher hat er seinen Namen und Titel und auch seine Identität in dieser Hierarchie. Andererseits gehört er aber auch zu „seinen“ Leuten, den Abteilungsleiter*innen seiner Hauptabteilung. Und er muss mindestens zwei Seelen in seiner Brust haben. Beide Gruppen brauchen ihn, weil er beiden Gruppen angehört; aus demselben Grunde müssen sie ihm aber auch misstrauen, zu wem er denn nun eigentlich halte.
Und in Abwandlung vom obigen Verhandlungsbeispiel kann man sagen: Zwei Arten von Chef*innen sind unbrauchbar:
- Diejenigen, die sich bloß als Repräsentant*innen der jeweils höheren Gruppe gegenüber den eigenen Leuten fühlen. Nehmen wir an, jedes Mal, wenn es im Vorstand ein Donnerwetter gibt, lässt das der Herr B ungefiltert auf seine Leute niederprasseln. „Schulddelegation nach unten“ heißt das im Fachjargon, und unser C = Meier tut womöglich desgleichen. Irgendwelchen Argumenten, die aus der spezifischen Logik des jeweiligen Arbeitsgebietes kommen und von dort her gut begründet sind, werden dann schroff die höherwertigen Gesamt-Firmenziele entgegengeschmettert. Die Mitarbeiter*innen solcher Chef*innen werden auf diese Art in ihrer Loyalitätserwartung schwer erschüttert, sich verraten fühlen und irgendwann die Gefolgschaft verweigern – am besten durch Dienst nach Vorschrift oder durch die bekannte Drohung an den*die Chef*in: „Wenn Sie so weitermachen, werden wir alle Ihre Anordnungen befolgen!“
- Aber auch diejenigen Chef*innen sind unbrauchbar, die sich bei jeder Witterung schützend vor ihre Abteilung stellen und deren Eigeninteressen von vorneherein bis aufs Messer verteidigen. Solche Chef*innen sollten sich als Betriebsrät*innen bewerben.
Also ist jede*r gute Chef*in unvermeidlicher Weise ein „doppeltes Lottchen“, dem*der der Organisationswiderspruch aufgehalst und zugemutet werden kann. Er*sie muss zwei grundsätzlich widersprüchliche Kräfte gleichzeitig für und gegeneinander einsetzen: das Prinzip der Gruppe gegen die Organisation, und das Prinzip der Organisation gegen die Gruppe. Die Meisterung dieses Widerspruchs an den jeweiligen Sachfragen verdient den Namen Management. An den notwendigen Bruchstellen eines Unternehmens wird die Dynamik einer Organisation offensichtlich, und zugleich auch, wie sie gepflegt und gemeistert wird. Bürokrat*innen hingegen wollen feste Organisationsnormen vorfinden und widerspruchsfrei verwalten.
Wer jedoch Management-Funktionen wahrnimmt, pflegt diesen Widerspruch als Motor der Entwicklung, die eine Organisation plastisch und lernfähig erhält, so dass sie sich den jeweiligen Zielen anpassen oder sie sich selbst setzen kann. Sieht man nun, auf welches Kräftefeld sich jemand einlässt, der als Führungskraft Organisationsprozesse bändigen und gestalten will?
Dabei ist das Hierarchie-Beispiel noch reichlich vereinfachend. Denn das Prinzip der Zugehörigkeit zu mehreren Gruppen widersprüchlicher Zielsetzungen reicht ja viel weiter, als es das offizielle Organogramm zeigt. Denn abgesehen von Projekt-Gruppen, Matrix- Verflechtungen usf. gibt es ja in jedem Unternehmen den üppigen Wildwuchs der informellen Organisationsstrukturen (den Fußball-Club, die Ostschweizer*innnen oder Oberösterreicher*innen, die Rotarier*innen, die Jahrgangskolleg*innen vom Technicum usf. usf.), ohne den es ein totes Gerippe mit klappernden Organisationsscharnieren bliebe.
Exkurs
Ein kleiner Exkurs über freie Individualität, Denken und Herrschaft: Die Chance, sich als Individuum frei zu fühlen, ist erst in der Organisation gegeben, die die Gruppen- und Familiengrenzen gesprengt hat und mehrfache Gruppenzugehörigkeit erlaubt. Deswegen taucht Individualität und Freiheit in der Geschichte erst zu einem sehr späten Zeitpunkt auf. Der Gedanke, dass man seine Zugehörigkeitsgruppe verlassen darf und kann, und zwar auch gegen deren Willen, ohne dass man dabei vernichtet werden kann, dieser Gedanke ist neueren Datums. Das Paar, die Familie und die Gruppe sind so tolerant nicht: wer sie verlässt und verrät, müsste – ginge es nach ihnen – mit Vernichtung oder Selbstvernichtung gestraft werden. Erst die Organisation erlaubt echte Mehrfachzugehörigkeit, so dass ich gefahrlos sagen kann, wenn es mir nicht mehr passt: Ich gehe... Daher werden Individualität und Freiheit erst bei einem äußerst hohen Entwicklungsgrad der Verträglichkeit der Menschen möglich. Auch das Denken wird erst mit Organisations-Anforderungen nötig. Solange alle Betroffenen anwesend sind, lassen sich Wünsche und Verweigerungen, Zuwendung und Hass auch unmittelbar emotional-vorsprachlich zum Ausdruck bringen, wie wir das ja auch von den Tieren kennen. Sobald aber – allein schon wegen der großen Menge – Strukturen nötig werden, die sichern, dass auch die Interessen Abwesender mitbedacht werden, müssen diese abstrakt imaginiert werden, um präsent zu sein.
Deswegen ist z.B. die Mathematik als die Wissenschaft von den Verhältnissen für das Bedürfnis nach zuteilender und ausgleichender Gerechtigkeit sicher von Nutzen. Wie die Organisation mit den Beziehungen von Beziehungssystemen arbeiten muss, so arbeitet die Mathematik mit Funktionen von Funktionen, und nicht zufällig werden beide in diesen Dimensionen als sehr abstrakt empfunden. Ähnlich ließe sich über das Recht und die Sprache fortspinnen. An der Güte legitimer Repräsentation entscheidet sich aber zuletzt die Qualität eines politischen Systems. In unseren Organisationsformen spiegelt sich unser politisches Leben getreu wider. In Schule, Unternehmung, Militär, Kirche, Gemeinde – überall repräsentieren Gruppen höherer“ Ordnung die Interessen und Lebenskräfte. Und damit ist der Frage nach der Legitimation und damit nach Herrschaft nicht mehr auszukommen. Alle Formen politischer Machtverwaltung sind Schattierungen in der Beantwortung dieser Frage.
Schlussfolgerungen
In Strukturen und Prozessen denken
Organisationsstrukturen sind deshalb nötig, weil man nicht mehr alles durch direkte Kommunikation erledigen kann. Es bedarf für die Informations- und Entscheidungsfindung dauerhafter Formen, Rituale, Regeln und Strukturen, die die Arbeitsteilung und die Arbeitskooperation zwischen Menschen und Menschengruppen gewährleisten können. Arbeitsteilung und deren Zusammenfassung bedeutet, dass Menschengruppen, die nicht mehr direkt am gesamten Entscheidungs- und Willensbildungsprozess mitwirken können, trotzdem einbezogen werden müssen. Wenn eine Gruppe etwas erarbeitet, muss das in den Gesamtarbeitsprozess einbezogen werden können, ohne dass die Menschen, die das jeweils erarbeitet haben, auch wirklich immer dabei sind und es kontrollieren können. Umgekehrt müssen Gruppen und Abteilungen immer mit Gesamtzielen konfrontiert werden, deren Logik sie oft nicht verstehen.
Gerade aufgrund der Arbeitsteilung hat jede Abteilung, jede Gruppe ihre Sonderziele, und umgekehrt erscheint diesen Gruppierungen das allgemeine Ziel häufig willkürlich und unverständlich. Die Güte der Verknüpfung und Verbindung hängt davon ab, wie die Organisationsstrukturen aufgebaut sind und funktionieren.
Es zeigt sich immer wieder, wie sehr die zentrale Notwendigkeit der Organisation mit den dezentralen Interessen der Abteilungen, Gruppen, Divisionen etc. in Konflikt geraten und dennoch koordiniert werden müssen. Kleine Einheiten sind rascher lernfähig, die Frage ist, ob und wie sie insgesamt voneinander lernen. Dazu bedarf es einer besseren Koordination. Je mehr man dezentralisiert, desto vernünftigere Formen der Zentralisierung der Einzelerfolge müssen gefunden werden, sonst geht das, was die kleinen Einheiten lernen, rasch wieder verloren.
Gruppen, Teams und Hierarchie
Unsere Organisationen befinden sich in einer gesellschaftlichen und sozialgeschichtlichen Umgebung; man kann sie nicht unabhängig vom Kontext sehen. Versuche in der neueren Zeit, Organisationsformen, die dem gegenwärtigen Mündigkeitsgrad der Menschen angemessen sind, werden immer heftiger diskutiert. Welche gesellschaftspolitischen Anforderungen kommen an die Unternehmungen heran und wie können sie organisatorisch bewältigt werden? Auf die klassischen hierarchischen Strukturen kann man einerseits (noch) nicht verzichten, anderseits sind wir vor die Aufgabe gestellt, die Problematik der Koordination von Teams neben der Hierarchie und der klassischen Hierachie zu bewältigen. Mit allen drei Formen müssen wir gleichzeitig leben, es gibt kein Unternehmen, das sich auf eine einzige festlegen kann. Es geht darum, wie weit der Entwicklungs- und Reifegrad eines Unternehmens ist, in welcher Umwelt es lebt, welcher Mix daher richtig ist.
Kleine Unternehmungen stehen hier vor anderen Problemen als etwa weltweite Unternehmen, die verschiedene Kulturen unter einen Hut zu bringen haben. Aber auch in einem Unternehmen gibt es sinnvollerweise verschiedene Organisationskulturen und dementsprechende Spannungen. Denn unterschiedliche Aufgaben verlangen unterschiedliche Organisationsformen. Die Kunst liegt nun darin, die der Aufgabe angemessene Organisationskultur zu entwickeln (Technik, Verkauf, Controlling etwa sind nicht mit ein und demselben Führungsstil zu bewältigen).
Um Teams und Gruppen richtig zu führen, bedarf es gruppendynamischer Kenntnisse und Fertigkeiten. Organisationsprobleme jedoch sind nicht mit gruppendynamischen Methoden zu lösen. Man muss einen anderen Blickwinkel haben, um Organisationen zu verstehen. Aber Organisationsprozesse erfordern eine Schärfung der Sicht, die über Gruppenprozesse weit hinausgeht. Es gibt Leute, die sind in Gruppen besser und haben kein Gefühl für Organisationsstrukturen und umgekehrt. Vielleicht ist ein gewisses Defizit in gruppenmäßiger Kommunikation ein Ansporn, sich mit Organisation zu befassen.
Die meisten Vorgesetzten haben das Problem, wie sie mit dem Widerspruch von Gruppe und Organisation umgehen sollen, weil sie sowohl in Gruppen integriert sind, als auch mit der Organisation umgehen müssen. Der Widerspruch besteht zwischen dem Verhalten in Gruppen, wo man direkt miteinander umgeht, und dem Problem, wie man in Organisationen indirekt über Regeln, Arbeitsteilung, aber auch über inoffizielle Machtkonstellationen und informelle Strukturen operiert.
Unsere Betriebe und Gemeinschaften sind zu groß, als dass immer alle Betroffenen dabeisein und mitreden könnten. Organisation vergegenwärtigt die Interessen aller jener, die nicht da sind. Wir müssen in Organisationsstrukturen immer für andere mitdenken und andere für uns denken lassen. Dieser Prozess hat eine gewaltige Eigendynamik. Deren Kenntnis und Handhabung kann viel Sand im Getriebe der Sozialstruktur unserer Unternehmen beseitigen helfen.
Es gibt Leute, die denken in Köpfen und nicht in Strukturen. Wenn ein Strukturwiderspruch vorhanden ist, nützt das Auswechseln der Köpfe nichts. Die Frage: Was ist die Ursache? wird zu oft ersetzt durch die Frage: Wer ist schuld? Das Lernziel der Organisationsdynamik ist daher, das Denken und Handeln in Strukturen zu üben. Man muss erleben, dass man mit seiner ganzen Persönlichkeit gegen bestimmte Strukturen nicht ankann und dass das Handhaben dieser Strukturen etwas anderes ist, als in persönlichen Gesprächen Einzelne und Gruppen überzeugen und motivieren zu wollen.
Zwischen Menschen und in einer Gruppe gibt es unterschiedliche Beziehungen, es fließen Ströme von Zuwendung, Ablehnung, Verstehen und Unverständnis. Aber im Verhältnis zu den gebündelten Strömen einer Organisationsstruktur sind das Schwachströme. In Organisationsstrukturen fließt gebündelte Macht, Starkstrom. Da muss man etwas wissen von Isolierungen (Regeln), von Spannungen (Konflikten), von Widerständen. Man muss wissen, wie man verteilt, wie man herunterspannt, transformiert, damit in den Gruppen brauchbar ist, was die Organisation bietet. Wenn die Gruppe einen Starkstromstoß bekommt, geht das im Allgemeinen nicht gut. Die Kunst, mit dem Starkstrom der Interessen und Ziele umzugehen, heißt Führen in Organisationen. Das ist eine ganz andere Kunst, als mit Schwachstrom umzugehen. Ich glaube, dass die Starkströme, die in Organisationen fließen, gebündelte Interessen und Emotionen repräsentieren und deswegen so mächtig und empfindlich sind (deshalb müssen sie oft zunächst voneinander isoliert werden). Für das Wahrnehmen einer Managementfunktion ist beides notwendig. Insofern wird die Organisationsdynamik in den nächsten Jahren eine ebenso zentrale Stellung bekommen wie die Gruppendynamik in den 60er und 70er Jahren.
Politischer Nachsatz
Im Motto hatten wir eine Kantische Reflexion zitiert. Im Zusammenhang heißt es dort:
„Der vereinigte Wille aller ist jederzeit gut. Der Willen der einzelnen mag noch so böse sein. Denn das Böse hat darin etwas Besonderes, dass es unter allen Zusammen nicht einstimmig ist und sich so aufhält, dass es kein Resultat herausbringt als nach der Regel des Guten." [9]
Von Güte und Art der Vereinigung zu wechselseitiger Verträglichkeit hängt es also ab, ob es zu einem realen und verbindlichen guten Willen aller auch in Wirklichkeit des Zusammenlebens kommt.
Deshalb ist die Organisationsfrage heute von enormem Sprengstoff. Denn die alten Organisationsformen, die unser Denken und Wirtschaften bestimmten, haben sich verbraucht. Unsere Wirtschaft etwa produziert (per Rationalisierung) primär freie Zeit, die wir in Form von Arbeitslosigkeit zwangskonsumieren müssen. Ist heute mehr freie Zeit bei gleichbleibender Struktur von Arbeitswelt und Freizeit, Berufswelt und Familie tatsächlich das zentrale Bedürfnis? Sicher nicht. Sonst wären wir nicht allesamt in der Frage der Arbeitszeitverkürzung so unschlüssig.
Für lange Zeit unserer Geschichte war die Notbewältigung die vorrangige bis ausschließliche Aufgabe. Und dafür waren auch all die herrschaftlichen Elemente unserer Organisationsformen möglicherweise sinnvoll und wurden in Kauf genommen. Aber unsere Notbewältigungs-Maschine läuft weiter und weiter, immer schneller und effektiver. Doch inzwischen produziert sie nur neue Not, die dann per Arbeitslosigkeit und Krieg doch wieder in die alte umschlägt; denn für die Zeit danach (wenn unsere Rüstungsanstrengungen zu irgendeinem Ende geführt haben werden) kann unsere Notbewältigungs- und Wiederaufbau- Maschine unverdrossen wieder gebraucht werden.
Auch sind ängstliche Menschen leichter zu führen und zum Schweigen zu bringen und von der Notwendigkeit der alten herrschaftlichen Organisationsmuster zu überzeugen.
In Wahrheit haben wir zu viel „alte“ Zeit und zu viele „alte“ Antworten. Wenn ein Ziel erreicht ist, ist es sinnlos, in der gleichen Richtung, die inzwischen falsch geworden ist, umso schneller weiterzulaufen. Man muss sich vielmehr neue Ziele setzen (die das Erreichte keinesfalls wieder gefährden sollten.) Deshalb könnten wir die neu gewonnene Zeit gut nützen dort, wo wir keineswegs am Ziele sind: im politischen Umgang miteinander haben wir genug zu lernen, oder wenn wir neue Formen der Ehe, der Familie, der Erziehung, des Wohnens, der Entscheidungsfindung bei der Arbeit, in der Gemeinde, im Staate und zwischen den Völkern entwickeln wollen. Aber das sind heute noch keine Güter, für die wir sinnvolle Formen der Bewirtschaftung schon hätten. Stattdessen organisieren wir in vielen Sparten, die ohnehin bis an den Rand gesättigt sind, sinnlose Verdrängungswettbewerbe, die nur Phantasie, Kreativität und wertvolle Arbeitszeit vergeuden. Warum sollten wir uns die alten Wunden immer wieder schlagen, nur weil wir sie gewöhnt sind und nach den zweifelhaften Medizinen süchtig geworden sind?
Wenn wir Zeit, Geld und Phantasie in neue Formen, zu einem vereinigten Willen aller zu kommen, investieren, werden wir bessere Früchte ernten.
Aufgaben
Was kann ich hier lernen?
Bitte beantworten Sie folgende Fragen:
1.) Diese Lektion war sehr lang und dicht. Wie ist es Ihnen dabei gegangen? Hätte das aufgesplittet werden sollen oder war die Kompaktheit gut für das Verständnis?
2.) Welches sind Ihre drei wichtigsten Erkenntnisse dieser Lektion und warum?
3.) Womit sind Sie überhaupt nicht einverstanden und warum? Eventuell widerspricht etwas in dieser Lektion Ihren persönlichen Erfahrungen. Es wäre für alle spannend, dies zur Diskussion zu stellen.
4.) Wählen Sie eines der zahlreichen Probleme, die in dieser Lektion angeschnitten wurden und erläutern Sie, wie Sie persönlich damit umgegangen sind. Waren Sie erfolgreich oder hängt das bis heute in der Luft?
5.) Denken Sie an die Ausführungen zum Thema Verhandlung und Delegation. Welcher Typ sind Sie? Verhandeln Sie gerne bzw. können Sie das gut? Vielleicht erzählen Sie ja auch eine kleine Geschichte des Erfolgs oder Misserfolgs.
Verwenden Sie dazu bitte das Handout, das Sie im Online-Forum zur Lektion 2 finden. Es ist im Word-Format, damit Sie es ausfüllen können. Dann machen Sie ein PDF daraus und stellen es ins Forum. In den darauffolgenden Lektionen gehen Sie bitte ebenso vor.
Hierarchie und Gruppe
Nach Durcharbeit dieses Kapitels sollen Sie in der Lage sein:
- den Unterschied von Hierarchie und Gruppe besser zu erkennen.
- einige Vorteile der jeweiligen Organisationsform aufzählen können – aber auch deren Nachteile.
Anmerkung: Diesen Ausführungen liegt ein Artikel von Peter Heintel zugrunde, entnommen dem Buch: Organisationsentwicklung in der Praxis; Hrsg. von B. Sieders und F. Glasl.
Der Widerspruch der beiden Organisationsformen
Was uns heute als Kultur, Zivilisation und Fortschritt vorliegt, ist das Ergebnis von Organisation, von Hierarchie, von Funktionsspezialisierung und Arbeitsteilung. Der allenthalben ausgebrochene Zweifel an Fortschritt und Zivilisation, Technik und Spezialistentum hängt auch mit einer Hierarchie- und Organisationskrise zusammen. Wir sind heute vor Globalprobleme gestellt, denen gegenüber unsere spezialistisch organisierte Arbeitsteilung versagt. Hierarchien können sich angesichts dessen entweder einigen und vor komplexeren Aufgaben resignieren oder neue Organisationsformen ausprobieren. Interessanterweise greifen diese Versuche immer wieder auf Gruppen zurück. Eine weltgeschichtliche „Nostalgie“? Fast muss man den Eindruck haben, beobachtet man etwa den Ethnologie-Boom der letzten Jahre, wo Stammeskulturen – weitgehend unorganisiert, wenn man von geschlechtsspezifischer Arbeitsteilung absieht – zu neuer Anerkennung gekommen sind.
Dies überrascht nicht. Durch die ganze Geschichte lässt sich beobachten, dass gegen Hierarchien und Organisationen immer wieder das Gruppenprinzip aktiviert wurde. Die Geschichte der Revolutionen ist eine Geschichte von Gruppen; deshalb fiel es immer so schwer, aus Revolutionen wieder einen „Staat“ zu bauen: Entweder blieben die Revolutionäre vor allem emotional ihren Gruppen verbunden und kämpften dann gewissermaßen gegen sich selbst und ihre eigene neue Funktion als „Staatsdiener“, oder sie werden zu solchen und polarisieren ihre ehemaligen Anhänger.
Von Anbeginn und grundsätzlich befinden sich Hierarchie und Gruppe in einer ständigen Gegnerschaft, die manchmal latent und befriedet ist, manchmal offen ausbricht (griffige Beispiele dafür wären etwa Abteilungsegoismus gegen Gesamtunternehmen, Familie gegen Schule, Banden gegen öffentliche Ordnung, „Freunderlwirtschaft“ und Geheimbünde gegen offizielle Strukturen). Dass auch im Projektmanagement auf das Gruppenprinzip zurückgegriffen wird, ist historisch nicht zufällig. Zugleich wissen wir, dass es trotz aller romantisch-utopischen Wünsche und Vorstellungen unmöglich ist, unsere Organisationen und Hierarchien abzuschaffen.
Man kann sagen: Wo mehr als 15 Personen eine gemeinsame Aufgabe erledigen wollen oder müssen, braucht es Organisation. Da wir keine andere Organisationsform als die hierarchische kennen, läuft es stets auf ebendiese hinaus.
Wir sind also heute vor die Aufgabe gestellt, die Vorteile der Gruppe mit der Notwendigkeit der Hierarchie zu vereinen und zugleich mit den durch diese Vereinigung auftretenden Widersprüchen fertig zu werden. Ein wenig erinnert das an die Quadratur des Kreises, jedenfalls müssen – soll dieses Unterfangen nicht zu einer Überforderung führen – zusätzliche Maßnahmen ergriffen werden; man kann Gruppe und Organisation nicht einfach additiv verbinden. Um Gruppen mit Erfolg in Organisationen zu verankern, muss man über ihre Vorteile, aber auch über ihre Grenzen Bescheid wissen, vor allem muss man auch wissen, unter welchen Bedingungen Gruppen „gedeihen“ und damit arbeitsfähig sind. Umgekehrt muss man sich mit Hierarchie und Organisation besser auskennen und begreifen, wieso sie immer wieder „natürlicher Feind“ von Gruppen sind.
Menschheits- und individualgeschichtliche Bedingungen
Mehrere Millionen Jahre haben Menschen beziehungsweise ihre Vorfahren in überschaubaren Kleingruppenformationen (Stämmen, Horden) ohne viel gegenseitige Berührung gelebt. Organisationen, Staaten, „Hochkulturen“ dagegen gibt es erst seit etwa 10.000 Jahren. Menschheitsgeschichtlich stehen einander also zwei sehr unterschiedliche Zeiträume an Verhaltensprägung gegenüber.
Der Zeitraum für die Entwicklung angemessener Verhaltensweisen für das Leben in Organisationen ist relativ kurz. Obwohl wir funktionale Notwendigkeiten einsehen können und auch über Organisationswissen verfügen, dürfte unser eigentliches, vor allem emotional bestimmtes Handeln und Verhalten noch weitgehend von den Prägungen der ersten, ausschließlich gruppenbezogenen Entwicklungsphase beeinflusst sein. Jedenfalls ist zu beobachten, dass wir in Kleingruppenformationen über eine stärker ausgeprägte Orientierungs- und Entscheidungssicherheit verfügen. Für Abstraktes sind wir evolutionär nicht ausgerüstet; um uns zu orientieren, brauchen wir die sinnliche Wahrnehmung.
In Gruppen ist die Kommunikation von allen überschaubar, man agiert „Face to face“. Die Möglichkeit dazu ist an eine begrenzte Zahl von Teilnehmer*innen gebunden; wo mehr als 15 Teilnehmer*innen in einem Verband zusammen sind, kann man nicht mehr von Gruppe reden. Es ist zu beobachten, dass es spätestens ab dieser Größe zu Gruppenteilungen kommt oder ein hierarchisches System etabliert wird. In Organisationen dagegen wird indirekt, das heißt über Vermittlungsinstanzen, Zwischenträger*innen, Relaisstationen kommuniziert – eine ständige Quelle von Verunsicherung für Personen und Fehlern in der Sache, aber auch die bisher einzige Möglichkeit, eine große Menge von Menschen für ein gemeinsames Ziel zu organisieren. Hinzu kommt, dass in fast allen uns bekannten Organisationen das hierarchische System dominiert, weshalb wir die Begriffe Organisation und Hierarchie oft synonym gebrauchen können. Hierarchie verteilt die Kompetenzen derart, dass die Mehrheit der Menschen mit Organisationsaufgaben wenig zu tun bekommt; in agrarisch-feudalen Systemen kann deshalb die Kleingruppenstruktur ungefährdet fortgesetzt werden („Großfamilien“, die in Dorfgemeinschaften nebeneinander leben und erst ansatzweise Intergruppenverbindungen eingehen). Diese Situation ändert sich radikal mit der Macht der Städte und des Bürgertums sowie der „Ehe“ von Wirtschaft und Wissenschaft.
Individualgeschichtlich bietet sich ein ähnliches Bild. Unsere primäre Verhaltensbildung und Erziehung vollzieht sich wiederum in Kleingruppenformationen (Familie, Freundeskreis, Schulklasse, Sportverein etc.). Obwohl die Schule eigentlich die Aufgabe hätte, ins politisch-organisatorische Leben einzuführen, entzieht sie sich dieser Aufgabe und konkurriert mit den Eltern um familienähnliche Strukturen. Von institutioneller Erziehung ist weit und breit nichts zu sehen. Jugendliche treten in den „Ernst des Lebens“ – und das heißt in die Wirklichkeit von Organisationen – erst ein, wenn ihre primäre, emotionale Verhaltensbildung schon weitgehend abgeschlossen ist. Der individualgeschichtliche Erwerb von Bewegungs- und Handlungssicherheiten in dieser ersten Lebensetappe bewirkt nun die Tendenz, auch das spätere Leben nach den emotionalen Mustern der Kindheit zu gestalten. Viele versuchen, Kleingruppenemotionen auf Organisationen zu übertragen – vom „Landesvater“ über die „Mutter Kirche“ bis hin zur „Freunderlwirtschaft“, die meist die Jugendbande ablöst.
Emotionale und sozialstrukturelle Folgen
Organisationen und größere Sozialverbände werden als solche emotional eher abgelehnt, insbesondere dann, wenn es nicht gelingt, sie gefühlsmäßig in quasi familiäre oder kleingruppenhafte Formationen „umzuwandeln“. Dies liegt nicht nur an den menschheits- und individualgeschichtlichen Entwicklungsvoraussetzungen, sondern hat überdies objektiv-strukturelle Gründe. Kleingruppen sind, wie gesagt, der Ort überschaubarer direkter Kommunikation und Kontrolle. Man kann einander beobachten, die Botschaften des Körpers und der Sprache aufnehmen, sie interpretieren und austauschen. Positive und negative Emotionen können direkt einem Anlass und „Gegenstand“ zugeordnet werden und lassen sich daher direkter und leichter austragen. Man kennt einander, kann die anderen einschätzen und weiß, was man zu erwarten hat. Das ermöglicht Handlungssicherheit. Man hat seine klaren „Vertrauenshierarchien“. Überhaupt ist Vertrauen ein Phänomen, das historisch fast ausschließlich an Kleingruppen gebunden ist. (Deshalb müssen auch heute noch die Politiker*innen „ins Bild“, sei es über das Fernsehen oder sei es gar leibhaftig bei allen möglichen und unmöglichen Veranstaltungen; von den Werbestrategen wird dergleichen auch als „vertrauensbildende Maßnahmen“ bezeichnet.)
In der Gruppe gibt es direkte Kommunikation: grundsätzlich kann man alles miteinander bereden, auch die Normsetzung liegt „in eigener Hand“.
Organisation hingegen verkörpert:
- indirekte Kommunikation, Anonymität sowie von außen gesetzte Norm und Verbindlichkeit.
- Individuen und Gruppen tritt ein undurchsichtiger „Apparat“ gegenüber; überall lauern Macht, Gefahr, Korruption.
- Die Kontrolle wird schwieriger, die oft uneinsichtige Außensteuerung wird als schicksalhaft und willkürlich empfunden.
- Viel einander „Fremdes“ wird unter eine Organisation gezwungen und zu unfreiwilliger Nähe verpflichtet, wodurch Unsicherheit und Angst entstehen; Vertrauen stellt sich hier nur über Umwege ein und ist ständig gefährdet.
Gruppen mit einem intakten Binnenleben, einer auf Vertrauen und Kontrollmöglichkeit beruhenden „Kohäsion“, können nur existieren und überleben, wenn sie sich in gewissen Formen nach außen abschließen und schützen; jedes neue Element bringt Unruhe und Veränderung, weil seine Integration die gesamte Gruppen- oder Kommunikationsstruktur umformen muss. Gerade gut funktionierende Gruppen haben die Tendenz, „Fremde“ wegen der Gefahr, die sie für die eingespielte Balance haben, nicht hereinzulassen. Gruppe bedeutet daher definitionsgemäß Ausschluss anderer. Bei inneren Verunsicherungen wird der Zusammenhalt der Gruppe durch die Konstruktion eines*einer Außenfeind*in gerettet und gewährleistet, ein Prinzip, das in der Politik oft Anwendung fand und findet. Solange ein*e Außenfeind*in emotional verfügbar ist, kann das Binnenleben der Gruppe funktionieren, und es geht halbwegs friedlich zu; es kommt nur zu kleineren Grenzscharmützeln. In der Geschichte war es immer wieder ein probates Mittel, bei inneren Schwierigkeiten zur Aggression gegen den*die Außenfeind*in fortzuschreiten. Kriege hingen und hängen sehr oft mit unbewältigten inneren Organisationsschwierigkeiten zusammen. Zugleich sind diese Vorgänge Belege für die Möglichkeit, ein Gruppengefühl auf Klassen, Völker, Staaten oder Organisationen zu übertragen, wofür diese erstaunlich schnell empfänglich sind. Hauptpropagandakategorie ist hier die „All-Einheit“ (etwa „ein Volk, ein Reich, ein*e Führer*in), mit der Minderheiten und ganze Völker zum Außenfeind gemacht werden können. Im Grunde ist diese postulierte „All-Einheit“ eine Omnipotenzphantasie der Gruppe, in der alle Unterschiedlichkeit zwischen Individuen, Interessen, Untergruppen und Einstellungen nivelliert wird.
Organisationen können an abgeschlossenen Gruppen nicht interessiert sein; sie funktionieren nur, wenn Gruppen für sie zugänglich bleiben. Organisationen vertreten und repräsentieren eine Sache, einen Zweck, der nur durch die Zusammenarbeit mehrerer Gruppen erreichbar ist. Sie vertreten ein Gesamtinteresse, ein Ganzes, eine Leitidee, haben den Überblick, und müssen das übergeordnete Ganze gegen die einzelnen Gruppeninteressen verwirklichen und durchsetzen. Durch das übergeordnete Gemeinsame wirken Organisationen auf Gruppen permanent störend, manchmal sogar zerstörend. Vom Binnenleben der Gruppe her sind Organisationen daher emotional negativ besetzt. Nur dort, wo es der Organisation gelungen ist, ihre (meist hierarchische) Struktur voll durchschlagen zu lassen, gibt es diese Besetzung nicht, weil Gruppen als solche gar nicht mehr existieren; daher wird man dort auch kaum befriedigende Kooperation in Gruppen vorfinden. Es gibt lediglich mehr oder weniger gut funktionierende Individuen als Exekutoren der Organisation.
Die Organisation wird nicht nur als etwas Anonym-Abstraktes empfunden, aus dem Blickwinkel der Gruppen her wird sie emotional negativ besetzt. Quasi im Gegenzug trachten Organisationen, ihren Zweck, die Sache, die funktionalen Verbindlichkeiten überhaupt aus dem Gefühlsbereich auszuschließen. Man denke nur an die großen Schwierigkeiten bei der Entwicklung einer Produkt-Ethik. Die emotionalen Neutralisierungs- und Ernüchterungsversuche verstärken ihrerseits wieder die Tendenz, alle positive Emotionalität (alle Gefühle von Wärme, Vertrauen, Sicherheit und Schutz) auf die Kleingruppe (Abteilung, Schulklasse, Institut, Kommission) zu beschränken. Für Gruppen wird damit die Organisation zum permanenten Außenfeind. Den Exponent*innen der Organisation ist dies naturgemäß nicht recht. Die Manipulationstechniken, dazu angewandt, die Organisation wiederum aus dieser negativen Besetzung herauszuholen, funktionieren zu einem großen Teil nach dem bereits beschriebenen Vorgehen: die Organisation versucht sich als Gruppe zu stilisieren, stellt das Gemeinsame als Gruppen-Überidee dar, verlagert innere Widersprüche nach außen, erklärt andere Organisationen zu Feinden (die Heiden, die Konkurrenz, die Opposition, die Roten, die Konservativen), emotionalisiert familial (Mutter Kirche, Vater Staat, Konzernmutter, Tochtergesellschaften) oder macht die Firma in der Propaganda gegenüber den Mitarbeiter*innen überhaupt zur „Familie“.
Organisationen haben auf diese Weise die Tendenz, ihren einzelnen Gruppen den*die Außenfeind*in „wegzunehmen“. Sie können ihren Zweck ja nur verfolgen, wenn die einzelnen Gruppen (Abteilungen, Institute) kooperieren (Stammeskulturen, so wie sie heute zum Beispiel noch in Afrika existieren, wehren sich mit großem Erfolg gegen staatliche Organisation; den wenigsten Ländern ist es gelungen, Außenfeindvorstellungen der Stämme untereinander abzubauen). Nimmt man einer Gruppe den*die Außenfeind*in weg, ist ihre Umgebung nicht mehr so gefährlich. Sie kann sich daher öffnen, muss sich nicht mehr in sich ab- und zusammenschließen, was den Organisationsinteressen leichter zu Gruppen Zugang verschafft; umgekehrt ist aber davon die Gruppenidentität betroffen, der innere Zusammenhalt wird flüchtiger, ihr eingeschworenes Binnenleben ist gefährdet. Die Gruppe wehrt sich daher dagegen, sich dadurch zerstören zu lassen, dass ihre Außengrenzen durchlässiger gemacht werden. Findet sich nämlich kein*e unmittelbare*r Gegner*in in der „Gruppennachbarschaft“ mehr, so tritt die ganze Organisation die vakant gewordene Stelle an. Prinzipiell und von sich aus sind Organisationen an Kooperation und im weiteren Sinn an innerem Frieden interessiert. Ihre „Kriegsform“ besteht in Expansion, Eingliederung, Vereinnahmung und Unterwerfung des „Äußeren“. Ist dieser Prozess aber einmal beendet, weil keine Expansionsmöglichkeiten mehr bestehen, wird die Frage nach dem „inneren Frieden“ wichtig. Der wird nämlich nicht geschenkt. Sehr oft verfahren Organisationen dann mit den inneren Widersprüchen wie gewohnt und schaffen sich den*die Außenfeind*in aus dem eigenen Inneren, führen dann „Krieg“ gegen bestimmte Gruppen.
Unser historischer Standort
Die weiträumigste Organisationsform in der Geschichte war immer schon der Handel, weil er nur grenzüberschreitend funktionieren konnte. Für die Gruppenmentalität war die Rolle des Kaufmanns daher auch immer ambivalent besetzt. Zwar wurde man durch ihn mit Notwendigkeiten und Luxuriösem versorgt, dennoch war er im Grunde ein Halsabschneider und Spitzbube. Schon für die Griechen war Hermes der Gott der Kaufleute und Diebe. Das „internationale Judentum“ als Volk von Kaufleuten, Bankier*innen und Unternehmer*innen eignete sich seit jeher für Außenfeindprojektionen, noch dazu, wo es sich durch Abgeschlossenheit, eigenen Glauben und anderes mehr als „ideale Gruppe“ präsentierte. Mit dem Imperialismus hat das Bürgertum Internationalisierung von Wirtschaft und Handel auf die Spitze getrieben. Alles sollte eingegliedert, „einverleibt“ werden. Kulturen, die nur in alten Stammes- Gruppenstrukturen leben können, wurden vernichtet. Die ganze Neuzeit könnte so als Krieg der Sozialform Organisation gegen ihre menschheitsgeschichtlichen Vorläufer begriffen werden, eine bürgerliche Vorstellung von „Fortschritt“. Beim weltweiten Verbreiten unseres Wirtschaftssystems mit seinen begleitenden Organisationsformen handelt es sich also um einen „indirekten Krieg“; indirekt deshalb, weil er nicht mit den üblichen Waffen geführt wird (wenn auch da und dort durch sie unterstützt) und weil er letztlich von der Logik der Organisation her gesehen am Frieden interessiert sein müsste, jedenfalls an der Überwindung traditioneller Kriegsformen.
Das Bürgertum hat diese Tendenzwende sehr wohl gesehen und sie humanistisch- enthusiastisch, „idealistisch“ als Neuerung gefeiert. „Seid umschlungen, Millionen“, hieß es, man sprach vom „Weltbürger“ und vom allgemeinen, gleichen Menschen. Kant zum Beispiel hoffte in seiner Schrift „Zum ewigen Frieden“ noch auf den friedenbringenden „Geist des Handels“. Trotz aller idealistischer Abstraktion dürfte damit gegenüber früher zu Bewusstsein gekommen sein, dass erst durch Organisation konkret Friede erreicht werden kann, Friede also weniger ein durch humanistische Appelle oder moralische Forderungen erreichbarer Idealzustand ist, sondern harte Organisationsarbeit im Detail voraussetzt. In Gruppenkulturen, Stammesgesellschaften kann es bestenfalls nur inneren Frieden geben. Der Weltfriede, der Friede zwischen Organisationen kann nur durch Organisation erreicht werden.
Wir stehen in einem Widerspruch: einerseits wissen wir, dass Frieden eine Organisationsleistung ist, andererseits wissen wir auch, wie negativ Organisationen besetzt sind. Dies führt zum Beispiel dazu, dass in den Friedensbewegungen die Frage nach dem Frieden von der nach der Organisation abgekoppelt wird. Gefühlsmäßig wird Friede immer noch mit konfliktfreien, idyllischen, familiären, Sicherheit spendenden Kleingruppen- Erlebnissen identifiziert. Gerade diese Grundgefühle durften aber den gegenwärtigen Friedensbemühungen eher hinderlich sein.
Wir haben bereits begründet, warum die Bildung von Projektgruppen in Unternehmen notwendig und sinnvoll ist. Wir fanden den Hauptgrund in einer Schwäche und Krise des Hierarchiesystems: Die mehrere Jahrtausende alte gesellschaftliche Organisationsform der Menschen, die zu Hochkulturen, Zivilisationsleistungen, subtiler Arbeitsteilung, Spezialisierung geführt hat, ist – und das ist das Paradoxe – durch ihre eigene Leistungsfähigkeit an ihre Grenze gekommen; ihre Leistungen haben zu einer Komplexität (an Informationen und Strukturen) geführt, die durch die bisherige Organisationsform Hierarchie nicht mehr zu bewältigen ist. Wir können aber zugleich gerade aufgrund der Lebensformen, die wir erreicht haben, auf Hierarchien nicht verzichten. Das heißt freilich nicht, dass „Privilegienzuordnungen“ nicht immer zur Debatte stehen können. Alles Gerede von der Abschaffung der Hierarchien aber, der Einrichtung „herrschaftsfreier Kommunikation“, ist naiv sentimentalisch und bewegt sich meist auf der Ebene einer ethischen Sollensforderung, ohne die Realität unserer Organisation zu untersuchen oder überhaupt zu kennen.
Wir müssen daher versuchen, in den bestehenden Organisationen andere Organisationsformen einzurichten, die die Probleme und Defizite der Hierarchie bewältigen und ausgleichen können. In diesem Sinn brauchen wir Einrichtungen eines Krisenmanagements, die jene Krisen erfassen und austragen, die durch die Hierarchie ständig und notwendigerweise erzeugt werden. Es liegt auf der Hand, dass diese Einrichtungen – zu ihnen zählen wir auch Projektmanagement – organisatorisch und auch emotional anders ablaufen müssen als die Hierarchie selbst; wäre dieses Anders-Sein nicht gewährleistet, würden sie dieselben Fehler produzieren wie die Hierarchie. Damit ist aber bereits der Widerspruch etabliert: wir werden im Moment weltgeschichtlich gezwungen, innerhalb einer Organisation zwei völlig verschiedene und einander widersprechende Organisationsprinzipien zu vereinigen - und dies im vollen Bewusstsein des Widerspruchs. Soweit wir sehen, ist dies in der bisherigen Menschengeschichte noch nie „offiziell" gelungen. Ob es uns jetzt gelingt, ist fraglich; jedenfalls dürfte das Überleben unserer Zivilisation davon abhängen.
Aufgaben
Aufgabe: Hierarchie vs. Gruppe
Ja, auch Sie sind im Widerspruch Hierarchie vs. Gruppe quasi „gefangen“. Für diese Übung legen Sie eine kleine Tabelle an und tragen links die Gruppen ein, in denen Sie Mitglied waren, sind oder in absehbarer Zeit sein werden.
Auf der rechen Seite tragen Sie die hierarchischen Systeme ein (Schule, Ausbildungsstätten, Vereine – so ferne diese hierarchisch strukturiert sind.
Dann stellen Sie sich folgende Fragen:
- Welche der beiden Seiten überwiegt in meinem Leben – welche Liste ist länger?
- Wo fühle ich mich wohler – und weshalb könnte das so sein?
- Wohin zieht es mich in Zukunft?
- Was sind meine Stärken innerhalb von Gruppen – und meine Schwächen?
- Was sind meine Stärken innerhalb von Hierarchien – und meine Schwächen?
Auch diese Fragen lassen sich hervorragend in Gruppen diskutieren. In einem hierarchischen System macht das schon wesentlich weniger Spaß.
Gruppenfunktionen
Nach Durcharbeit dieses Kapitels sollen Sie in der Lage sein:
- die verschiedenen Funktionen, die Gruppen erfüllen können, zu definieren bzw. zu erkennen.
- eine erste Idee zu haben, ihre eigenen Funktionen in Gruppen reflektieren zu können bzw. zu wollen.
Anmerkung: Wahrscheinlich können Sie das Versprochene natürlich noch nicht, aber Sie haben eine erste Ahnung bzw. die theoretische Grundlage. Gruppendynamik erlernt man nicht durch das Aneignen von Theorie, sondern durch das Sammeln eigener Erfahrungen samt anschließender Reflexion.
Gruppen werden in unserer Gesellschaft, die durch die Organisationsform der Hierarchie dominiert wird, stets als ein wenig suspektes Gebilde angesehen, die man nicht ganz begreift, obwohl man sich in ihnen wohl fühlt. Mit anderen Worten: Gruppen können emotionale Heimat und Geborgenheit bieten – etwas, was Hierarchie nur in den seltensten Fällen leisten kann.
Gruppen sind eine uralte Organisationsform mit ebenso alten Gesetzmäßigkeiten was ihre Entstehung, Entwicklung, Dauerhaftigkeit und auch ihr Auseinanderbrechen, ihren Tod bedeutet.
Damit Gruppen funktionieren können, müssen bestimmte Funktionen wahrgenommen werden. In diesem Punkt sind Gruppen „anthropomorph“, d.h. sie funktionieren wie ein Organismus, bei dem auch bestimmte Organe funktionieren müssen, damit er überlebt.
Der Vergleich hinkt jedoch ein wenig: Gruppen können ihre Funktionen bzw. deren Ausübung auf unterschiedliche Gruppenmitglieder verteilen und diese können in diesen Funktionen auch untereinander wechseln – eine Leber hingegen wird immer die Funktion ausüben, die eine Leber ausüben muss und kann und sie wird nicht eines Tages sagen: „He, Nieren, übernehmt doch einmal für einen Monat meine Funktion und ich eure...“
Wichtig ist jedoch, dass eine gewisse Anzahl an Funktionen in der Gruppe wahrgenommen werden, damit sie nicht auseinander fällt – Anzahl und die Art hängen ganz von der Zusammensetzung der Gruppe, der Interessen ihrer Mitglieder sowie dem Ziel und der Einbindung in die Organisation ab, durch die die Gruppe gegründet, ins Leben gerufen wurde (sofern es eine solche gibt).
Die Übernahme von Funktionen kann freiwillig erfolgen oder durch verschiedene Mitglieder an ein spezielles Mitglied (oder mehrere) herangetragen werden. Dem muss nicht immer eine bewusste Entscheidung zugrunde liegen, wie übrigens in der Gruppendynamik Entscheidungen generell nicht immer getroffen werden, sondern manchmal (und zwar öfter als man denkt) schlicht und einfach „passieren“. (Um das zu zeigen, gibt es in einer Präsenzphase eine passende Übung.)
Folgende Funktionen müssen wir voneinander unterscheiden:
Zielorientierte Gruppenfunktionen
- Zielsetzung
- Methodenvorschläge
- Initiative
- Informationssuche
- Informationen geben
- Meinungssuche
- Meinungsäußerung
- Aufbauarbeit an anderen Beiträgen
- Zusammenfassen
In Arbeitsteams, die von einer zentralen Autorität ins Leben gerufen werden, sind diese Funktionen meist vordefiniert. Es gibt meist eine*n Gruppen- bzw. Teamleiter*in, der*die damit beauftragt ist, diese Funktionen auszuüben. Er*sie wird auch in seiner*ihrer Leistung von der Hierarchie danach beurteilt und muss dafür die Verantwortung übernehmen.
Diese Funktionen sind wichtig, damit die Gruppe etwas leistet, damit gearbeitet wird. Gruppen, die sich zu sehr um diese Funktion kümmern und andere wichtige Funktionen vergessen oder einfach nicht zu besetzten bereit sind, fangen sehr schnell zu streiten an. Dann geht selbstverständlich auch in der Arbeit nichts mehr weiter und die Gruppe läuft Gefahr auseinander zu brechen oder von einer Autorität auseinander gerissen zu werden.
Dem kann man entgehen, wenn folgende Funktionen ausgeübt werden:
Gruppenorientierte Funktionen
- Gruppengefühle ausdrücken
- Festlegen und hinweisen auf Gruppennormen
- aufmuntern, ermutigen
- Verständnis zeigen, zuhören
- Zurückweisungen neutralisieren
- Spannungen ausgleichen (ev. durch einen Witz lösen)
- Mitlaufen
- Gefühle der Minorität berücksichtigen
- Widerstände aufarbeiten und nicht bagatellisieren, übergehen, zurückdrängen oder niederstimmen
- Außenseiter*innen integrieren
Diese Funktionen sind ebenso wichtig wie die zielorientierten Funktionen. Wenn sie gut erfüllt werden, hat die Gruppe eine gute Chance, auch in der Arbeit was weiterzubringen.
Hier kommt leider ein Mechanismus zum Tragen, der durch die übermäßig hohe Macht der hierarchischen Organisationen negative Auswirkungen auf die Entwicklung und auch auf die Arbeitsfähigkeit von Gruppen hat: Wenn in einem Unternehmen ein Team neu gegründet wird, dann bedeutet das meistens, dass Mitarbeiter*innen aus verschiedenen Abteilungen zusammengewürfelt werden. Manchmal kennen sie sich, manchmal nicht. In jedem Fall ergibt die Zusammensetzung jedoch eine neue Gruppe, die in dieser Konstellation noch nicht zusammengearbeitet hat.
Diese Gruppe ist somit eine junge Gruppe, sie gleicht quasi einem Neugeborenen, das erst die Welt erkunden muss, bevor es sich seiner selbst bewusst wird.
Gruppen geht es ähnlich: eine junge Gruppe muss zuerst einmal zu sich selbst finden. Dazu muss sie Normen und Regeln festlegen und diese auch leben, d.h. ausprobieren, modifizieren, reflektieren und schließlich in das Repertoire der gültigen Normen aufnehmen.
Weiters müssen die Mitglieder einander kennen lernen, damit die mindestens notwendige Vertrauensbasis geschaffen ist. In Organisationen kann dieser Prozess oft erheblich abgekürzt werden, da man meist langjähriges Mitglied ein und derselben Unternehmenskultur ist und den gleichen Stallgeruch hat.
Erst wenn die Gruppe zusammengewachsen ist, ihre Normen und Regeln festgelegt hat und viele wichtige Verhaltensweisen einmal erlebt und durchlebt hat, macht es Sinn ihr eine spezielle Arbeitsaufgabe zukommen zu lassen. ERST DANN sind sie fähig und bereit zu arbeiten und werden auch erst dann gute und brauchbare Ergebnisse liefern.
Das Problem besteht nun nicht darin, dass die meisten Chef*innen in den Unternehmen ihren Mitarbeiter*innen da und dort zu wenig Zeit geben, um die Gruppe eine Entwicklung zu gönnen, sondern darin, dass sie ihnen GAR KEINE ZEIT geben (und das ist nun doch nicht gerade viel). Die Gruppen werden gezwungen von Anfang an Ergebnisse zu liefern und mindestens fähig zur Zusammenarbeit zu sein.
Welche Mitglieder sollen nun zu welchen Funktionen herangezogen werden?
Die Antwort ist einfach: diejenigen, die sich am besten dafür eigen. Das heißt aber nicht zwangsläufig, dass dies auch die gescheitesten oder fleißigsten Mitglieder sein müssen. Eine Gruppe tut gut daran zuerst einmal die Stärken und Schwächen ihrer Mitglieder auszuloten und erst dann die Funktionen zu verteilen.
Dabei stellt sich meist heraus, dass man manche Leute falsch eingeschätzt hat. Je genauer die Analyse der Stärken und Schwächen, umso weniger Geld und Zeit muss man später für eine Begradigung einer sehr kurvigen Strecke aufwenden. Am Beginn zu sparen kommt oft teurer als mühsame Vorarbeit zu leisten.
Generell würde man annehmen, dass Männer besser für die zielorientierten und Frauen besser für die gruppenorientierten Funktionen geeignet wären. Diese Ansicht musste inzwischen korrigiert werden, wenngleich gewisse Voraussetzungen auf eine Prioritätenverteilung hindeuten:
Die Frauen werden – nicht zu Unrecht – oft als Ernährerin und Fürsorgerin dargestellt. Die Männer haben sich diese Rolle als Ernährer, als einer, der die Mutterbrust reichen kann, wieder zurückgekauft, und zwar mit der Brieftasche als mehr oder weniger brauchbarem „Mutterbrustersatz“.
Neben den oben erwähnten Funktionen gibt es noch Mischformen, wie etwa analytische Funktionen (Bewertung und Kritik von Beiträgen, Prozessanalyse, Feststellen von fehlenden Gruppenfunktionen etc.). Dies sind eher den zielgerichteten Funktionen zuzuordnen, aber nicht ganz: wenn die Einigkeit der Beschlussfassung überprüft oder analysiert wird, ob gewisse Gruppenfunktionen nicht ausgeübt werden, dann hat das auch direkten Einfluss auf das Gruppengeschehen, auf die sozialen Beziehungen und wäre somit auf jeden Fall auch den gruppenorientierten Funktionen zuzurechnen.
Abwehrfunktionen
Hier handelt es sich um kollektive Abwehrmechanismen, deren Funktion es ist, die Gruppeneinheit zu wahren. Es sind dies vor allem Abwehrfunktionen wie sie von Bion und Anna Freud beschrieben wurden (Kampf, Flucht, Pairing, Sündenbock schaffen, Verneinung, Verschiebung, Rationalisierung und Projektion). Jeder dieser Abwehrfunktionen liegt ein Inhalt zugrunde, den es abzuwehren gilt.
Die Abwehrfunktionen werden nach außen, aber auch nach innen eingesetzt. Sie sind in der Gruppe nur schwer thematisierbar und wenn, dann nur in reifen Gruppen, die über ein ausreichendes Maß an Selbstreflexion verfügen.
Gruppenfremde Funktionen
Das sind Tätigkeiten der Mitglieder, die weder der Gruppenerhaltung noch der Zielerreichung dienen. Es sind Verhaltensweisen egozentrischer Art, die der Gruppe in keiner Weise weiterhelfen. Da sie jedoch für die einzelnen Mitglieder von erheblicher Bedeutung sein können, muss ihrer Ausübung eine gewisse Toleranz entgegengebracht werden. Einige davon sind Herumblödeln, Selbstdarstellung, zwanghafter Wettbewerb oder Verzögerungstaktiken.
Aufgaben
Eigene Rolle in Gruppen Welche der obigen Funktionen üben Sie in Gruppen...
1.) ...gerne aus:
...und warum?
2.) ...nicht gerne aus:
...und warum?
Einflussfaktoren in Gruppen
Nach Durcharbeit dieses Kapitels sollen Sie in der Lage sein:
- die verschiedenen Einflussfaktoren, die in Gruppen und auf Gruppen wirken, voneinander zu unterscheiden.
- ihre eigene Position zu definieren: welche dieser Faktoren kenne ich gut, welche sind mir eher neu.
Wie verhalte ich mich selbst in Gruppen und wie kann ich sie steuern? Diese Fragen stellen sich nicht nur Führungskräfte.
Folgende Faktoren beeinflussen Gruppen sowie die dort tätigen Individuen:
Gruppendruck
Die stärkste Kraft in einer Gruppe. An ihr kann man erkennen, dass Gruppen mehr sind als die Summe der Individuen. Gruppen sind eine alte, die älteste Form der Organisation, die wir aus der Geschichte der Menschen kennen. Entsprechend tief ist sie in uns verborgen, entsprechend archaisch und entsprechend stark beeinflusst sie unser Handeln und Denken – im Extremfall sind Menschen bereit, alles zu tun, was die Gruppe von ihnen verlangt, bis zur Aufopferung ihres Lebens.
Ein kleines Beispiel aus den Konformitätsstudien von Solomon Asch (1951) soll dieses Phänomen verdeutlichen:
Einer Gruppe von männlichen College-Studenten wurde in mehreren Durchgängen 2 Karten (A und B, siehe Abbildung unten) gezeigt. Die Teilnehmer der Gruppe gaben einzeln ihr Urteil darüber ab, welche der Striche auf Karte B identisch zu jenem von Karte A war.
Alle Teilnehmer einer Gruppe, mit Ausnahme einer unwissenden Versuchsperson waren schauspielernde Mitarbeiter des Versuchsleiters. In den Durchgängen gaben alle Mitarbeiter des Versuchsleiters übereinstimmend ein falsches Urteil ab. Die unwissende Versuchsperson war jeweils als letztes an der Reihe.
Ergebnis: Auffallend oft schloss sich die Versuchsperson den falschen Urteilen der anderen an, sie reagierte sozusagen gruppenkonform.
Man muss hier jedoch ergänzen, dass es Menschen gibt (wie sich auch in den Studien von Asch zeigte), die diesem Druck gegenüber resistent sind. Dies betrifft jedoch nur wenige Prozent und hängt in erster Linie von der Gruppengröße ab. Durchschnittlich widerstehen zwischen 5 und 25 Prozent.
Gegenkräfte
Es gibt jedoch einen Ausweg, sozusagen eine „Gegenströmung“, die in uns existiert: Individuen sind von Gruppen umso weniger beeinflussbar, „erpressbar“ könnte man auch sagen, je mehr Zugehörigkeiten sie außerhalb der Gruppe haben – das können Familienverbände oder andere Gruppen, in speziellen Fällen auch Organisationen sein. Menschen, die nur einer einzigen Gruppe angehören, sind komplett in deren Abhängigkeit – an Sekten kann man gut sehen, wie sich dieses Phänomen auswirkt. Eine Möglichkeit sich dem Gruppendruck zu widersetzen wäre also der Ausstieg – sofern er möglich ist.
Eine weitere Möglichkeit gegen den Gruppendruck besteht darin, innerhalb der Gruppe Allianzen zu suchen: wenn man innerhalb einer größeren Gruppe eine Kleingruppe bildet, so kann diese dem Druck der Gesamtgruppe leichter widerstehen als eine Einzelperson.
Dritte Möglichkeit: innerhalb der Gruppe den Druck reflektieren, ihn besprechbar machen, bewusst machen, dass man entsprechenden Druck empfindet und die Entscheidung dafür oder dagegen der Entscheidungs- und Handlungsfreiheit der Gruppe übergeben.
Individualisierung
Gerade in einer Zeit, in der das Individuum steigenden gesellschaftlichen Wert erfährt, nimmt es auch starken Einfluss in Gruppen. Die Unterordnung unter einen Gruppenwillen, unter die Gruppennormen fällt schwer und wird mit „individuellen Rechten“ erklärt und verteidigt. Wenn wir hier einen Blick in die Geschichte werfen, dann finden wir Individualisierung als modernes Phänomen. Noch vor wenigen Jahrtausenden war Individualität überhaupt nicht im heutigen Sinne bekannt, die Einzelperson war von ihrer Identität Mitglied einer Familie, einer Gruppe oder eines Clans. Das heutige Schimpfwort „Idiot*in“ heißt „Vereinzelte*r“ und stammt aus einer Zeit, in der das Individuum gegenüber der Gemeinschaft stark im Nachteil war – mit anderen Worten: Wer allein ist, trifft schlechte Entscheidungen, er*sie wird zum*zur Idiot*in.
Diese „schlechten Entscheidungen“ möchte ich mit zwei Beispielen darlegen:
1.) Die Trafik
An einer belebten Ecke in Gersthof (ein Grätzl des 18. Wiener Gemeindebezirks) liegt eine gut gehende Trafik. Vor einiger Zeit wurde dort eingebrochen. Das allein ist noch nichts Besonderes, aber die Umstände zeigen den Bezug zu unserem Thema. Die Trafik liegt in einem großen Gründerzeithaus, das dicke Wände hat. Die Einbrecher*innen kamen durch die Hauseingangstüre und gelangten in einen leeren Raum hinter der Trafik. Von dort stemmten sie sich mittels eines Presslufthammers durch eine Wand (mehr als einen halben Meter dick) und konnten so von hinten in die Trafik gelangen. Der Schaden war beträchtlich, als Profis nahmen sie z.B. neben den Autobahnvignetten auch die Entwertungsmaschine mit.
Der Einbruch passierte mitten in der Nacht und der Presslufthammer lief über zwei Stunden. Es muss ein unglaublicher Lärm gewesen sein, der alle Menschen locker aus dem Tiefschlaf gerissen haben muss.
Und trotzdem konnten die Einbrecher*innen seelenruhig ihr schändliches Werk vollenden. Wieso war das möglich?
Überlegen Sie selbst, was Sie tun würden, wenn Sie in so einem Haus wohnen. Man möchte annehmen, dass die Menschen sofort (vielleicht noch im Nachtgewand) auf den Gang stürmen, sich dort treffen und gemeinsam nachschauen gehen, was da passiert. Schließlich ist das ja nicht normal, so Pressluftgehämmere mitten in der Nacht.
Das geschah jedoch nicht.
Was wäre denn noch möglich? Man könnte z.B. zum Telefon greifen und die Polizei anrufen, oder vorher die Nachbar*innen, wenn man etwa Angst hätte, in der Nacht vor die Tür zu gehen.
Diesen Versuch mag es auch gegeben haben, nur standen die Menschen im Haus vor dem Problem, dass sie alle kein Festnetz mehr hatten und das Handynetz nicht funktionierte, weil die Einbrecher*innen einen Störsender aufgestellt hatten.
Also geschah nichts.
Etwas brutal ausgedrückt könnte man sagen, dass in diesem Haus nur Idioten leben. s gibt dort mit hoher Wahrscheinlichkeit keine gepflegte Nachbarschaft, sondern eine fast willkürliche Ansammlung von Menschen, die miteinander nicht einmal so viel zu tun haben, als dass sie sich zumindest in Extremsituationen zusammenschließen würden.
2.) Die Bohrmaschine
Stellen Sie sich vor, Sie wohnen in einem Haus – vielleicht sogar in dem der oben erwähnten Trafik. Sie brauchen eine Bohrmaschine – was nicht jeden Tag geschieht, aber doch immer wieder mal vorkommt.
Nun haben Sie zwei Möglichkeiten: Erstens Sie besitzen eine, zweitens Sie borgen sich eine aus. Das kann man im nächsten Baumarkt tun oder bei den Nachbar*innen. Das setzt jedoch voraus, dass zumindest einer im Haus eine Bohrmaschine hat und diese auch herborgt.
Wir sind wieder beim Thema Individuum-Gemeinschaft angelangt, denn in einer funktionierenden Gemeinschaft sind solche Prozesse nicht nur möglich, sondern organisiert. Es ist bekannt, wer was besitzt und ob er*sie es herborgt. Es setzt aber auch voraus, dass Besitz und Eigentum in der Gemeinschaft bewusste Gestaltungselemente sind, also nicht trennender, sondern vergemeinschaftender Faktor.
Der natürliche Gegner dieses Modells ist die Konsumindustrie. Sie hasst Gemeinschaften und liebt Idiot*innen, weil diese durch ihre Vereinzelung jeden Gegenstand selbst besitzen müssen und sie somit mehr verkaufen kann. Je isolierter von der Gemeinschaft, desto funktionierender und wertvoller ist der*die Konsumidiot*in. Vor den Zeiten des Internets war das nicht so, denn da brauchte die Konsumindustrie auch – in gewissem Ausmaß – die Gemeinschaften, um Werbung machen zu können.
Zugleich lebt eine gute Hausgemeinschaft – um noch bei unserem Beispiel zu bleiben – auch davon, dass es Individuen gibt, die unterschiedliche Interessen haben. Deswegen besitzt der*die eine die Bohrmaschine und der*die andere den Griller. Auch die Intelligenz von Gemeinschaften lebt von der Individualität, etwa der unterschiedlichen Bildung, der unterschiedlichen Interessen und natürlich der unterschiedlichen Erfahrungen ihrer Mitglieder.
Das Verhältnis Individuum-Gruppe muss in einer reifen Gruppe immer wieder zur Sprache kommen, reflektiert werden. Nur so kann verhindert werden, dass Individuen zu sehr von einem – oft nicht ganz klar in seinem Ursprung erkennbaren – Willen gesteuert, manipuliert werden, aber auch, dass Individuen in ihrem Drang nach Individualisierung die Gruppe gefährden.
Wie wichtig dies ist, lässt sich allein schon an der Tatsache erkennen, dass das Verhältnis „Eines“ zu „Vieles“ einen der Grundwidersprüche des menschlichen Soziallebens darstellt (neben männlich-weiblich, alt-jung und lebendig-tot).
Eine Ursache liegt in der Macht unseres Ordnungssystems, der Hierarchie. Sie hat es nur sehr ungern mit Gruppen zu tun und agiert lieber mit Individuen, die sie dann auch entsprechend fördert. Ein Mittel dazu ist das Konkurrenzprinzip, aber auch Systeme der Bestrafung, des Monitorings und selbstverständlich auch Belohnungen, Graduierungen etc.
Normen, Regeln, „Währungen“
Sie bestimmen einen Großteil der Handlungen, die in einer Gruppe passieren. Sie sind der Zusammenhalt, aber auch die Quelle mannigfaltiger Gefahren für Gruppen. Sie werden großteils unbewusst gesetzt und auch während ihrer Geltung oft nicht reflektiert, bestimmen aber trotzdem die Gruppe in hohem Maße.
Wer von einer „Währung“, die in einer Gruppe gilt, genügend einstecken hat, der bekommt Einfluss in der Gruppe.
Dazu ein Beispiel: Vor einigen Jahren gab es eine Fernsehwerbung, bei der ein Langstreckenflug gezeigt wurde. Plötzlich ein Gong und der Kapitän meldet sich mit einer Ansage: „Meine Damen und Herren, aufgrund einer technischen Störung sind wir leider gezwungen, auf den Muagadugu-Inseln zwischenzulanden. Es besteht kein Grund zur Besorgnis, wir werden den Flug voraussichtlich bald fortsetzen können. Eine kleine Information habe ich noch für Sie: Auf den Inseln gelten als Währungen Muagadugu-Muscheln.“
Die Kamera schwenkt auf einen Mann, der sich stirnrunzelnd auf die Sakkotaschen greift, dann jedoch freudenstrahlend eine Kreditkarte herauszieht.
Fazit: Wer keine Landeswährung eingesteckt hat, braucht eine andere, die dort ebenfalls gilt.
In sozialen Systemen gibt es ebenfalls „Währungen“, die in erster Linie Normen und Regeln darstellen. Es geht um das Verhalten der Individuen und der Gruppe.
Dazu noch ein kleines Gedicht von Eugen Roth:
NUR EIN VERGLEICH
Ein Mensch hat irgendwann und wo
vielleicht im Lande Nirgendwo,
vergnügt getrunken und geglaubt,
der Wein sei überall erlaubt.
Doch hat vor des Gesetzes Wucht
gerettet ihn nur rasche Flucht.
Nunmehr im Land Ixypsilon
erzählt dem Gastfreund er davon:
Ei, lächelt der, was du nicht sagst?
Hier darfst du trinken, was du magst!
Der Mensch ist bald, vom Weine trunken,
an einem Baume hingesunken.
Wie? brüllte man, welch üble Streiche?
So schändest du die heilige Eiche?
Er ward, ob des Verbrechens Schwere,
verdammt fürs Leben zur Galeere
Und kam, entflohn der harten Schule,
erschöpft ins allerletzte Thule.
Ha! Lacht man dorten, das sind Träume!
Hier kümmert sich kein Mensch um Bäume.
Der Mensch, von Freiheit so begnadet,
hat sich im nächsten Teich gebadet.
So, heißt´s, wird Gastfreundschaft mißnutzt?
Du hast den Götterteich beschmutzt!
Der Mensch, der so den Tod erlitten,
sah: andre Länder, andre Sitten.
(Eugen Roth: Von Mensch zu Mensch)
Eine Norm ist ein Verhaltenskodex, der es einer Gemeinschaft erlaubt, die Aktionen und Reaktionen der Mitglieder vorhersehbar zu machen. Wer „aus der Norm“ agiert, gefährdet die Gemeinschaft – wobei es egal ist, ob es sich hier um eine Familie, eine Gruppe oder eine Hierarchie (Unternehmen) handelt. Abweichendes Verhalten stellt zwar einerseits die Basis für mögliche und oftmals auch notwendige Veränderungen dar, wird aber vom System in erster Linie als Störung gesehen, da es
- gültige Regeln in Frage stellt („Seht, es geht auch anders und ich lebe noch.“),
- Energie kostet („Jetzt müssen wir auch das noch ausprobieren.“),
- die Einheit gefährdet („Wenn jeder macht, was er*sie will, herrscht das Chaos.“).
Es ist somit notwendig, die Normen, Regeln und Währungen, die in einer Gruppe oder einer Gesellschaft existieren, zu erkennen, um sie in Folge
- neu zu setzen (in der richtigen Zeit bzw. Gruppenphase),
- zu kritisieren,
- zu verändern,
- durchzusetzen,
- oder auch zu stabilisieren.
Auch hier ist das stärkste Instrument die (gemeinsame) Reflexion der Normen. Erst durch Bewusstmachung werden sie einer Veränderung zugänglich – es sei denn, jemand steuert sie mit gruppendynamischen Methoden, ohne dass der Rest der Gruppe es merkt. Gerade dann ist es sehr hilfreich, wenn man gelernt hat, wie „Gruppe“ funktioniert...
Zeit und Raum
Oft wird unterschätzt, welch wichtige Funktion für Gruppen der Raum hat: das Vereinslokal, der Heimvorteil im eigenen Stadion, der Platz in der Kantine – Gruppen schöpfen Identität u.a. aus dem Raum. Es ist also nicht egal, wo man Konflikte bearbeitet oder Teamentwicklung betreibt.
Selbstverständlich wird auch dieser Faktor Gruppen durch Reflexion zugänglich und bearbeitbar.
Die Herrschaft über die Zeit ist ebenfalls ein enormer Einflussfaktor in Gruppen: man kann sie für sich oder gegen sich arbeiten lassen: wenn Gruppen unter Zeitdruck gestellt werden, also schnell gemeinsame Entscheidungen treffen müssen, so werden sie für autoritäre Entscheidungen zugänglich. Dies kann man ausnützen, man kann sich aber auch dagegen wehren – sofern man es erkennt. Wer Entscheidungen hinauszögert, bis die Gruppe müde ist, kann dies zu seinem eigenen Vorteil ausnützen – oder auch abblitzen, wenn nämlich jemand anderer die Taktik durchschaut hat und darauf pocht, nicht in müdem Zustand eine so wichtige Entscheidung zu treffen...
Allianzen, Seilschaften, Kooperationen
Untergruppen – wie auch immer man sie nennen will, sie stellen einen entscheidenden Einflussfaktor in Gruppen dar. Wer es schafft, Kooperationen zu bilden und im Entscheidungsprozess auszunützen, kann Gruppen leicht steuern. Wenn ich eine Meinung vertrete und „meine Leute“ geschickt in der Gruppe platziert habe, so kann ich durch deren Zustimmung die Zustimmung der Gruppe vortäuschen – sofern es nicht jemand gibt, der dieses Spiel durchschaut.
Ein wichtiges Führungsinstrument kann darin bestehen, Allianzen, Cliquen etc. in der Gruppe sichtbar und besprechbar zu machen. Dann kann das Team vernünftig damit umgehen.
Gruppenentwicklung (Phasen)
Gruppen machen ähnlich wie Individuen bestimmte Phasen ihrer Existenz durch: sie werden geboren, erleben eine Kindheit und Jugend in Form von Abhängigkeit von Autoritäten (Chef*in, Organisation etc.) und erlangen oftmals ein gewisses Reifestadium. In diesem sind sie dann fähig, eigene Entscheidungen zu treffen und diese zu reflektieren. Sie können Konflikte sowie ihre eigene Entwicklung erkennen und besprechbar machen. Sie können ihre Normen und Regeln aktiv bearbeiten und Aufgaben mit hoher Effizienz erledigen.
Selbstverständlich gibt es auch eine Phase des Niedergangs sowie den Tod der Gruppe. All das will erkannt sein, sofern man vor hat die Gruppe zu steuern. Es ist nicht möglich, die Phasen untereinander zu tauschen, sehr wohl kann man jedoch einzelne dieser Phasen beschleunigen.
Sehen wir uns dazu den Archetyp des „Teamentwicklungsprozesses“ an.
B.W. Tuckman (zusammengefasst auf Wikipedia) beschreibt 1965 Teamentwicklung in einem Phasenmodell:
- Formierungsphase („forming“) diese ist geprägt durch Höflichkeit, vorsichtiges Abtasten, Streben nach Sicherheit, „Man“-Orientierung und das Kennenlernen. In dieser Phase ist es wichtig, dass die Führungskraft das Team führt („ansagt“). In dieser Anfangsphase konstituiert sich die Gruppe und sieht erstmalig ihre Aufgabe. Die Teamstruktur ist in dieser Phase durch hohe Unsicherheit gekennzeichnet. Alles ist neu, die Gruppenzukunft noch weitgehend unbestimmt. Die Mitglieder probieren aus, welches Verhalten in der Situation akzeptabel ist und konzentrieren sich darauf, in erster Linie eine gute Figur zu machen. Die Abhängigkeit der Gruppe von einem*einer formellen Führer*in, der*die strukturiert, initiiert und entscheidet, ist hoch. In einem gruppendynamischen Setting ist das der*die Trainer*in, in einem Unternehmen meist der*die Gruppenleiter*in. Für die Gruppe ist es wichtig, dass Teilaufgaben, Regeln, und geeignete Arbeitsmethoden klar definiert werden.
Wenn diese Phase erfolgreich ist, hat dies unter anderem folgende Auswirkungen:
Die Teammitglieder kennen sich gut, es existiert eine Vertrautheit und persönliche Nähe im Team
Für die Ziele und Aufgaben des Teams gibt es eine breite Zustimmung, sie sind im Team breit diskutiert worden und für jeden transparent
Jedem ist klar, wer zum Team gehört
Persönliche Ziele der Teammitglieder sind bekannt
Konfliktphase („storming“) ist durch unterschwellige Konflikte, Selbstdarstellung der (neuen) Teammitglieder, den Kampf um (informelle) Führung, „Ich“-Orientierung und Cliquenbildung geprägt. Die Führungskraft muss Ziele aufzeigen. Hat sich die Gruppe erst einmal etabliert, folgt eine Phase von Turbulenz und kritischem Aufbegehren. Konflikte zwischen Untergruppen brechen auf, Meinungen polarisieren sich, Konkurrenz zwischen den Mitgliedern wird deutlich, Macht- und Status-Ambitionen treten offen zutage. In der Gruppe wird um die Positionen gerungen. In dieser Phase lehnt das Team formelle Kontrolle ab und opponiert deutlich gegen die Leitung. Die Aufgabenanforderungen werden emotional abgelehnt.
Wenn diese Phase erfolgreich ist, hat dies unter anderem folgende Auswirkungen:
Persönliche Konflikte sind thematisiert
Es gibt eine „Feedback-Kultur“ im Team, die auch
persönliche, kritische Rückmeldungen „erlaubt“
Es gibt eine transparente Rollenverteilung im Team
Kompetenzen und Positionen sind verteilt und transparent
Im Team gibt es positive Erfahrungen und etablierte Vorgehensweisen, um Konflikte zu regeln
Regelphase („norming“) ist geprägt durch Entwickeln von neuen Gruppenstandards und neuen Umgangsformen, Feedback und Austausch zwischen den Teammitgliedern, sowie eine „Wir“-Orientierung. Die Führungskraft koordiniert die einzelnen Aufgaben und Personen. In dieser Phase einigt sich das Team auf seine Spielregeln und etabliert Teamnormen und eine eigene Organisation. Das Wir-Gefühl und der Zusammenhalt im Team bilden sich aus. Widerstand gegen die Führungsautorität und interpersonelle Konflikte werden abgebaut bzw. bereinigt. Das Aufgabenverhalten ist durch offenen Austausch von Meinungen und Gefühlen gekennzeichnet. Erste Kooperationen entstehen.
Wenn diese Phase erfolgreich ist, hat dies unter anderem folgende Auswirkungen:
Es gibt formulierte Regeln für die Zusammenarbeit im Team
Abläufe und Vorgehensweisen sind abgestimmt und etabliert
Jeder kennt seine Aufgaben und Rolle im Team
Arbeitsphase („performing“) ist geprägt durch Arbeitsorientierung, Flexibilität, Offenheit der Teammitglieder, Solidarität, Leistungsausrichtung und zielgerichtetes Handeln des Teams. Die Führungskraft benötigt wenig Energie, da das Team sich größtenteils selbst steuert und gibt lediglich Globalziele (Visionen) vor. Die Teamstruktur ist jetzt für die Aufgabenerfüllung vollends entwickelt. Interpersonelle Probleme sind gelöst oder weitgehend entschärft. Das Rollenverhalten im Team ist flexibel und funktional. Die Aufgabenbearbeitung erfolgt konstruktiv, Problemlösungen und die Orientierung auf die Ziele stehen im Vordergrund. Die Energie des Teams wird ganz der Aufgabe gewidmet (Haupt-Arbeitsphase).
Wenn diese Phase erfolgreich ist, hat dies unter anderem folgende Auswirkungen:
Die Führung beschränkt sich fast ausschließlich auf Moderation und die Bereitstellung guter Rahmenbedingungen für die Teamarbeit
Regelmäßige Zwischenbilanzen zur Teamarbeit finden statt
Die hohe Leistung wird auch von außen anerkannt
1970 fügt Tuckman den vier vorstehenden Phasen noch eine fünfte Phase hinzu.
Auflösungsphase („adjourning“)
Tuckmans Phasen-Modell ist natürlich eine grob vereinfachende Beschreibung. Die Darstellung suggeriert einen Automatismus, der keinesfalls mühelos ist, sondern das Ergebnis intensiver Arbeit durch die Teammitglieder. Die prägenden Einflüsse sind Führungsperson, Mitarbeiter*innen, Aufgabe und Umwelt. Manche Gruppe erreicht nie das Stadium der Arbeitsphase, bei anderen scheint es keine Konfliktphase zu geben.
Was können Sie mit diesem Modell tun?
Sie treffen auf dieses Thema entweder als Führungskraft oder als Mitglied einer Gruppe. In jedem Fall ist es hilfreich die Phasen zu kennen, um entsprechend intervenieren zu können. Als Chef*in kann dies ein wichtiges Erfolgskriterium sein, vor allem, wenn es sich um eine wichtige Gruppe handelt oder die Organisation gerade in einem Veränderungsprozess steckt und daher darauf angewiesen ist, dass die Teams gut funktionieren. Als Mitglied einer Gruppe können Sie zum richtigen Zeitpunkt auf die Gruppenphase aufmerksam machen, in der sich die Gruppe gerade befindet. Das kann der Gruppe vor allem dann helfen, wenn sie sich gerade in einer Krise befindet, nicht mehr weiter weiß oder einen Weiterentwicklungsanstoß braucht. Wer so etwas kann, wird in einer Gruppe keine unwichtige Rolle spielen.
Gruppendynamik
Die Gruppe als System, als Gebilde, lässt sich von außen, aber auch von innen betrachten. Das wichtigste Instrument in Gruppen ist die Gruppendynamik: man macht die Gruppe auf das aufmerksam, was in ihr gerade passiert und ermöglicht so eine aktive Bearbeitung der eigenen Entwicklung. Zu diesem Zweck muss eine Person (es können auch mehrere sein, die sich etwa abwechseln) die Funktion übernehmen, den Reflexionsvorgang loszubrechen und manchmal auch gegen Widerstand durchzustehen.
Die wichtigsten Verhaltensweisen sind dabei Zuhören, Fragen stellen und Feedback geben.
Somit ist auch die Fähigkeit der inneren Reflexion ein nicht unwesentlicher Einflussfaktor in Gruppen – und zwar ein erlernbarer und somit beeinflussbarer.
Aufgaben
Fassen wir die Einflussfaktoren in Gruppen noch einmal zusammen:
- Gruppendruck
- Individuum und Gemeinschaft
- Normen, Regeln, Währungen
- Zeit und Raum
- Allianzen, Seilschaften, Kooperationen
- Phasen der Gruppenentwicklung
- Gruppendynamik
Nehmen Sie sich drei dieser Punkte und erzählen Sie dazu je eine kurze Geschichte, eine Episode aus Ihrem Leben, in der Sie damit zu tun hatten – etwa als Problem, oder als Lösung für ein Problem oder sogar, weil diese Geschichte Ihrem Leben eine Wendung gegeben hat. Das kann eine Geschichte sein, wo Sie Gruppendruck erfolgreich eingesetzt oder sich erfolgreich dagegen gewehrt haben. Vielleicht ist es eine Geschichte über eine Seilschaft, durch die Sie ein Ziel erreichen konnten oder eine Phase der Gruppenentwicklung, an der Sie gescheitert sind.
Gruppenarbeit in der Praxis
Nach Durcharbeit dieses Kapitels sollen Sie in der Lage sein:
- die Voraussetzungen für das Gelingen von Gruppenarbeit zu definieren;
- die Grundprinzipien der Teamentwicklung zu verstehen;
- die Unterschiede von Gruppe und Hierarchie punkto Teamentwicklung zu kennen;
- Vor- und Nachteile der Gruppenarbeit aufzählen zu können;
Vorbemerkung: Die folgenden Ausführungen sind aus der Theorie der Gruppendynamik entnommene Idealmodelle. Selbstverständlich werden etwa nie alle Hindernisse am Weg zu einer guten Gruppenleistung gemeinsam auftreten oder auch gemeinsam beseitigt werden können.
In diesem Kapitel sollen Sie einen Überblick bekommen, wie vielfältig das Thema Gruppe/Team gesehen werden kann und welche Bedeutung es in fast allen Branchen und Berufen hat.
Die Listen und Aufzählungen sind ein Hilfsmittel für die tägliche Arbeit (sofern man mit Gruppen zu tun hat). Es geht dabei nicht darum, sich alles zu merken oder anzuwenden, sondern im Bedarfsfall ein Nachschlagewerk zu haben, in dem man sich Anregungen zur eigenen Analyse holen kann. Wenn etwa folgende Fragen auftauchen: „Was ist da bloß passiert? Wieso verhalten sich die Teammitglieder so seltsam? Wieso funktioniert die Gruppe nicht so wie vorgesehen? – dann ist es wichtig, die Palette an Möglichkeiten zur Verfügung zu haben, um mit der Analyse dem Problem auf die Spur zu kommen.
Die gute Gruppenleistung
Wir kennen bis zur heutigen Zeit nur zwei verschiedene Organisationsformen: Gruppe und Hierarchie. Beide sind einander feindlich gesinnt und es gehört zu den Anforderungen moderner Organisationsentwicklung, sowohl Gruppe wie auch hierarchische Ordnung mit- bzw. nebeneinander bestehen zu lassen. Beide können einander gut ergänzen, nie jedoch ersetzen.
Eine gute Gruppenleistung kann nur dann möglich sein, wenn die Gruppe selbst ihre Gruppendynamik erkennt, reflektiert und lernt, sich als Gruppe weiterzuentwickeln. Die hierarchische Ordnung, in die „Gruppe“ als Organisationsform (meistens) eingebettet ist, muss für den Halt der Gruppe, d.h. für ihre Existenz innerhalb der Organisation sorgen.
Voraussetzungen für das Gelingen von Gruppenarbeit/Teamarbeit:
- Erkennen eines gemeinsamen Zieles
Wer sorgt dafür, dass das Ziel definiert wird? Wer passt darauf auf, dass es nicht aus den Augen verloren wird – nämlich innerhalb der Gruppe, nicht durch den*die Chef*in?
Genügend Fachkenntnisse
Welche Fachkenntnisse werden benötigt, um das Ziel zu erreichen? Sind diese im Team vorhanden? Wen benötigt das Team noch bzw. wo kann man sich externe Hilfe holen?
Gegenseitige Hilfestellung
Sind alle bereit, einander zu helfen und haben sie auch die Möglichkeit dazu (Zeit, Energie, andere Aufgaben...)?
Offene und ehrliche Kommunikation
Was ist in der Gruppe bisher unausgesprochen geblieben? Wo könnte die notwendige Offenheit noch fehlen? Wo ist Privatsphäre zu akzeptieren?
Die Fähigkeit und Bereitschaft, einander zuzuhören
Wer tut sich damit noch schwer und wo fällt das auf?
Hohes Vertrauen zueinander
Ist das Team soweit gefestigt, dass man einander ausreichend vertraut, auch ohne, dass man eng befreundet ist? Wurde über Vertrauensbrüche in der Vergangenheit gesprochen und was ist dabei herausgekommen?
Die Fähigkeit und Bereitschaft, menschliche Konflikte zu akzeptieren und aufzuarbeiten
Wie wird in der Gruppe mit Konflikten umgegangen? Hat man einen Modus gefunden, sie anzusprechen, zu akzeptieren, zu bearbeiten und die Lösung zu kontrollieren?
Die Bereitschaft zur Selbstkontrolle und zur Selbstkritik
Kann die Gruppe gemeinsam ihre eigene Entwicklung reflektieren? Wann und wie redet man darüber, wie es der Gruppe und den einzelnen Mitgliedern geht? Gibt es hierfür fixe Orte bzw. Zeiten?
Die Rolle des*der Vorgesetzten
Ein*e Teamleiter*in aus der Organisation ist niemals Mitglied des Teams, auch wenn er*sie es gerne will und sich als solche*r positionieren will. Kann die Führungskraft seine Rollen zeitweise wechseln und wo lässt er „den*die Chef*in raushängen“ und konterkariert damit die Arbeit der Gruppe? Wird darüber gesprochen? Ist er Feedback zugänglich?
Die Organisation (in der die Gruppe existiert) als Ganzes muss diese Prinzipien hochhalten
Wo gibt es Unterstützung und wo Widerstand aus der Organisation? Welche zusätzliche Unterstützung bräuchte man noch und wo kann man sie herbekommen?
Grundprinzipien der Teamentwicklung
Die Hierarchie ist – trotz all der Probleme, die sie aufwirft – nicht ersetzbar. Sie ist das Prinzip, das uns Zivilisation und Wohlstand gebracht hat. Sie ist als Organisationsprinzip nicht auflösbar.
Heute stehen wir vor dem Problem, dass dieses System erstmals in der Geschichte in eine ernsthafte Krise gekommen ist. Vor allem seit der Finanzkrise 2008 zeigt sich immer stärker die Unfähigkeit großer Konzerne, ihre eigenen Probleme zu bewältigen. In einer „freien Marktwirtschaft“ wird laut nach Staatshilfe gerufen und oftmals besteht die einzige Reaktion der Firmen darin, Mitarbeiter*innen zu entlassen – oft in der Hoffnung, dass es dann „besser“ läuft. Was ist die Ursache dieser Probleme? Wie immer gibt es nicht eine singuläre Ursache, aber aus gruppendynamischer Sicht ist die Hierarchie an die Grenze ihrer Leistungsfähigkeit gekommen – vielleicht auch deshalb, weil sie sich zu lange nicht der Kraft funktionierender Gruppen bedient, sondern ihr Heil in immer genauer strukturierten Ober- und Unterordnungsprinzipien gesucht hat. Nicht umsonst sind Controller*innnen am Arbeitsmarkt weltweit sehr gefragt.
Wir müssen uns heute nach „Reparaturmechanismen“ umsehen, eine Tatsache dabei aber unbedingt im Auge behalten: es wird nicht möglich sein, die Hierarchie abzuschaffen.
In der folgenden Tabelle finden sich links die Probleme, die heute in hierarchischen Systemen auftauchen. Rechts die Alternativvorschläge, aus der Sicht der Gruppendynamik, also der Konkurrenz und zugleich Ergänzung des hierarchischen Organisationsprinzips.
| Einer allein hat heute nicht mehr das Wissen, um die Entscheidungen richtig treffen zu können - die Arbeitsteilung funktioniert nicht mehr.
Informationen werden nach oben nicht so weitergegeben, dass die Führungskraft die richtige Entscheidung treffen kann. Informationen werden auch von oben nicht so weitergegeben, dass die Betroffenen richtig handeln können. |
Entscheidungen im kleinen Rahmen - Gruppengröße - vermeiden das Stille-Post- Problem.
Gruppen können aus verschiedensten Fachleuten zusammengesetzt werden, brauchen allerdings eine Zeit, bis sie arbeitsfähig sind. |
|---|---|
|
Beförderungen nach dem Leistungsprinzip funktionieren nicht mehr - das Peter-Prinzip tritt in Kraft. |
Die Positionen in Gruppen werden im Gruppenentscheid festgelegt - die richtigen Fachleute erhalten die richtigen Aufgaben und auch die dafür angemessene Entlohnung. Nach oben hin gibt es eine*n Repräsentant*in, der jedoch hierarchisch nicht höher steht als der Rest der Gruppe. |
|
Entscheidungen von oben herab zu fällen ruft Widerstand hervor - noch dazu, wenn die Entscheidungen falsch oder blöd sind. |
Delegation nach unten, dorthin, wo die Expert*innen sitzen, hilft, richtige Entscheidungen zu treffen. Zudem sind die Betroffenen auch Beteiligte und geben eher ihre Zustimmung. |
|
Divide et Impera - erhält die Hierarchie zum Schein und schlägt irgendwann ins Gegenteil um. Das moderne Problem des Mobbings ist auch eines der Hierarchie. |
Informationsfluss in der Gruppe - jederzeit die Möglichkeit der Reflexion, Missverständnisse können aufgeklärt werden. Jeder kann mit jedem reden - das einzig funktionierende Prinzip gegen Mobbing. |
|
Aufgrund der hierarchischen Position gibt es normalerweise kein Feedback von oben nach unten und umgekehrt. |
In einer Gruppe gehört Feedback zu den normalen Kommunikationswerkzeugen. |
|
Widerstand gegen hierarchische Positionen oder Entscheidungen können durch Dienst nach Vorschrift problemlos geleistet werden. Sabotage kommt auf. |
Widerstand gegen den*die Chef*in ist sinnlos, da es keine*n gibt. Alle sind in den Entscheidungsprozess integriert und auch für das Ergebnis verantwortlich. |
|
Nur wenn der*die Chef*in etwas sagt, wird es gemacht. |
Eigenverantwortlichkeit in der Gruppe. |
|
Die Mitarbeiter*innen entwickeln sich nicht weiter - sie werden als Mittel zum Zweck eingesetzt. |
Die Mitarbeiter*innen müssen sich mitsamt der Gruppe weiterentwickeln. Der Prozess ist dynamisch. |
Die Folge ist letztendlich, dass alle Errungenschaften der Hierarchie nicht mehr stimmen: die Wahrheitszentralisierung, die Weisheitszentralisierung, daher auch nicht mehr die Entscheidungszentralisierung und weil blöde Entscheidungen getroffen werden, stimmt auch die Machtzentralisierung nicht mehr. Es gilt: je größer und komplizierter das System, umso gehäufter treten die oben besprochenen Probleme auf.
Hier funktioniert das klassische, hierarchische Prinzip nicht mehr und wir brauchen daher neue Modelle. Neue Modelle bedeutet, dass diejenigen, die zusammenarbeiten müssen und unterschiedliche Expertisen haben, zueinander in einem interdependenten Verhältnis stehen.
Wie sehen diese „neuen Modelle“ aus?
Wir nehmen einmal an, ein Unternehmen besteht aus verschiedenen Gruppen. Diese Gruppen müssen eine Leistung erbringen. Es gibt nur noch ganz wenige Leistungen – sowohl im Produktionsbetrieb, als auch im Dienstleistungsbetrieb – die ein*e Einzelne*r noch machen kann. Das ist heute eine Sache eines Teams, so wie auch vor Ort in der Produktion Qualität eine Sache des Teams ist.
Das sind Entscheidungen, die von mehreren getroffen werden müssen – so kann für eine komplexe Aufgabe (es gibt heute fast nur mehr komplexe Aufgaben im Bereich größerer Organisationen) die notwendige Mindestmenge an Kompetenz, Information und Wissen in die Entscheidung einfließen.
Manager*innen bzw. Führungskräfte, die alle Entscheidungen selbst treffen, sind nach einiger Zeit überfordert, verbringen den ganzen Tag damit, ebendiese Entscheidungen zu treffen bzw. darüber nachzugrübeln. Ihre Mitarbeiter*innen wiederum sind demotiviert, denn sie befolgen Anweisungen und Befehle, ihre eigene Kreativität, ihre Eigenverantwortung sind nur zu einem geringen Teil gefragt. Nach einiger Zeit – den*die eine*n trifft das stärker, den*die andere*n weniger stark – fängt sich eine Spirale zu drehen an: je weniger die Mitarbeiter*nnen entscheiden können, desto weniger sind sie dazu in der Lage. Je mehr der*die Chef*in entscheidet, desto überlasteter ist er*sie mit dieser Aufgabe und desto schlechter werden mit der Zeit seine*ihre Entscheidungen. Das wiederum demotiviert ihn*sie und seine*ihre Mitarbeiter*innen.
Wie kann man nun dieser Abwärtsspirale entkommen? Sehen wir uns ein Beispiel an, wie das Verhältnis von Mitarbeiter*innen und Chef*innen aussehen kann. Wir nehmen dafür ein Wasserglas und behaupten: wenn alle notwendigen Entscheidungen im Unternehmen (oder in der jew. Abteilung) getroffen werden, so ist das Glas zu 100 % gefüllt.
Nehmen wir jetzt einmal an – Bild 1 – dass die Mitarbeiter*innen 20% übernehmen können und die Führungskraft 80% – wahrscheinlich wird alles funktionieren. Sollte jedoch der Fall eintreten, dass der*die Chef*in – aus Zeitmangel oder Inkompetenz – nur 40 % übernehmen kann, die Mitarbeiter*innen können aber nur die schon erwähnten 20 % ausfüllen, so wird ein freier Raum bleiben, den wir „Chaos“ nennen können.
Im umgekehrten Fall – Bild 3 – können die Mitarbeiter*innen 60%, der*die Chef*in ist jedoch der Meinung, dass er*sie auch 60% aller Entscheidungen selbst treffen will. Dann entsteht nicht Chaos, sondern Konflikt.
Nun stellt sich die Frage, was man tun kann.
Gehen wir einmal davon aus, dass die Führungskraft selbst ein erfahrener Hase ist, die Mitarbeiter*innen jedoch recht jung und noch eher unerfahren. Sie können nur – das hatten wir schon – 20% der Entscheidungen treffen. Die Führungskraft muss also – bis hierher brauchen wir dafür noch keine höhere Mathematik – 80% der Entscheidungen treffen. Nun kann die Führungskraft diesen Status versuchen beizubehalten. Wenn er*sie dies von seinem*ihrem Arbeitspensum her schafft und die Mitarbeiter*innen damit zufrieden sind, kann das Konstrukt über lange Zeit stabil bleiben.
Es besteht jedoch die denkbare Möglichkeit, dass die Führungskraft dies nicht so haben will und auch die Mitarbeiter*innen hätten gerne etwas mehr Entscheidungsbefugnis und Verantwortung.
Dann ist echte Führungsarbeit gefragt: die Führungskraft kann im Laufe der Zeit – siehe Bild 4 – einzelne Mitarbeiter*innen oder auch ganze Teams „entwickeln“, indem er*sie ihnen Schritt für Schritt erweiterte Kompetenzen einräumt und ihnen somit mehr Verantwortung gibt. Gegen Beginn dieses Vorgangs wird er*sie noch öfter helfen müssen bzw. er*sie wird es aushalten müssen, dass auch da und dort Fehlentscheidungen getroffen werden. Besonders autoritäre Chef*innen haben damit ein Problem, ebenso aber jene, die einen „laissez-faire“-Stil bevorzugen. Langsam tasten sich die Mitarbeiter*innen nach oben - der*die eine schneller, der*die andere weniger schnell.
Das Problem in den meisten Hierarchien ist jedoch, dass die Mitarbeiter*innen nicht...
- dürfen (Befugnisse sind strikt oben angeordnet);
- können (sie haben es schlicht und einfach nicht gelernt und nie geübt);
- wollen (Verantwortung übernehmen, ev. auch noch ohne mehr Geld zu bekommen...)
Endziel sollte sein, dass die Führungskraft noch etwa 20% der Entscheidungen trifft, die Mitarbeiter*innen hingegen für ca. 80% verantwortlich sind. Bei Engpässen, Krisen oder im Falle einer Umstrukturierung besteht nach wie vor die Möglichkeit, dass die Führungskraft für die eine oder andere Entscheidung einspringt. Prinzipiell hat er*sie jedoch jetzt andere Aufgaben.
Dabei ist anzumerken, dass es letztendlich um die Entwicklung von Teams (Gruppen) und weniger um die Förderung einzelner Mitarbeiter*innen geht – auch wenn diese natürlich eines unter mehreren Zielen bleibt. Die Führungskraft muss jetzt vor allem gruppendynamische Fähigkeiten vor- weisen können, denn Teams unterliegen anderen Regeln und brauchen eine andere Art von Führung, als dies in Hierarchien gefordert ist. Dort ist ein Team eine Ansammlung von Individuen, die gemeinsam an einer Aufgabe bzw. an einem Projekt arbeiten und hierarchisch gesteuert werden.
Das Potenzial von gut funktionierenden Teams ist jedoch weit größer. Sie können eine erhebliche Leistungssteigerung erzielen und noch andere Vorteile aufweisen:
Die Vorteile guter Gruppenarbeit
Überall dort, wo Hierarchien ins Straucheln geraten, wo sie ineffizient werden und die Leistung bzw. der Output sinkt, darf man die Frage stellen, ob Gruppen nicht als Ergänzung, in manchen Fällen vielleicht sogar als Alternative zu überlegen sind. Sehen wir uns einmal an, welche Vorteile gute Gruppenarbeit hat. Dabei darf nicht vergessen werden, dass diese Vorteile nur dann ausgeschöpft werden können, wenn es sich um eine funktionierende Gruppe handelt:
Statistischer Vorteil des Fehlerausgleichs (Mehrere Augen sehen mehr als eines...).
Durch die verschiedenen Blickwinkel wird ein Problem klarer erkannt - hier liegt auch der Vorteil der interdisziplinären Zusammenarbeit.
In Gruppen werden bessere Methoden entwickelt, zur Lösung eines Problems zu gelangen.
Die Kreativität im Finden von Lösungsalternativen ist höher.
Verschiedene individuelle Hilfsmittel können einander ergänzen - jedes Gruppenmitglied bringt seine eigenen Erfahrungen ein.
Der*die Einzelne erhält differenziertes Feedback für seine*ihre Beiträge.
Probleme des*der Einzelnen können besser geklärt werden.
Bedürfnisse und Fähigkeiten der Beteiligten können berücksichtigt werden – nicht alle müssen alles machen.
Deshalb stimmen, wenn die Gruppe einen Entschluss treffen muss, auch mehr Personen zu...
...und setzen sich mehr für die Durchführung der beschlossenen Maßnahmen ein.
Die Entscheidung wird auch eher auf die Praxisgegebenheiten der Beteiligten abgestimmt sein...
...so dass die Umsetzung des Vereinbarten auch ökonomischer sein wird.
Die emotionale Geborgenheit in einer (funktionierenden) Gruppe sowie das gegenseitige Vertrauen motivieren und führen zu einem besseren Arbeitsergebnis.
Hindernisse am Weg zu einer guten Gruppenleistung
Gruppenarbeit funktioniert nicht immer gut. Es gibt eine ganze Menge Hindernisse, die am Weg auftauchen und bewältigt werden müssen, damit ein Team, eine Gruppe gut funktioniert. Wie in obigem Modell erläutert, braucht es bis zur reibungslosen Entwicklung einer Gruppe eine*n Expert*in, der*die diese dorthin führt. Das kann auch die Führungskraft sein, die sich dann langsam wieder zurückzieht. Vorher jedoch hat er*sie ganz klar die Aufgabe, die Gruppe auf ihre Fehler und Schwächen hinzuweisen, sie etwa in Form von Feedback der Bearbeitung durch die Gruppe zur Verfügung zu stellen.
- Persönliche Ressentiments werden nicht bearbeitet (“Ich mag den X nicht, das zeige ich der Gruppe aber nicht”);
- “Prinzipielle Ablehnung” (Intoleranz) eines Gruppenmitglieds – Vorurteile (“Mit Ausländer*innen/alten Leuten/jungen Leuten will ich nicht zusammenarbeiten”);
- Austragung persönlicher Konflikte auf der Sachebene;
- Austragung sachlicher Konflikte auf der persönlichen Ebene;
- Bildung von Untergruppen zum Zwecke der Ausgrenzung anderer (oft mit “rein sachlicher” Begründung, etwa: “in der größeren Gruppe geht nichts weiter...”);
- Paare innerhalb der Gruppe (Ehepartner*innen, Eltern) solange dieser Umstand nicht besprochen wird bzw. nicht akzeptiert werden kann;
- Beschränkung auf die “Arbeitsebene” (“wir müssen etwas weiterbringen, da können wir keine Gruppenprobleme besprechen, jeder soll sich auf die Arbeit konzentrieren...”);
Wenn die Gruppe nicht bereit ist, der Bearbeitung ihrer Beziehungsebene ausreichend Zeit zu widmen, so wird auch das Arbeitsergebnis darunter leiden. Das kostet Zeit, Nerven und somit Geld.
Wir kennen bis zur heutigen Zeit – wie schon erwähnt – nur zwei verschiedene Organisationsformen: Gruppe und Hierarchie. Beide sind einander feindlich gesinnt und es gehört zu den Anforderungen moderner Organisationsentwicklung, sowohl Gruppe wie auch hierarchische Ordnung mit- bzw. nebeneinander bestehen zu lassen. Beide können einander gut ergänzen, nie jedoch ersetzen.
Eine gute Gruppenleistung kann nur dann möglich sein, wenn die Gruppe selbst ihre Gruppendynamik erkennt, reflektiert und lernt, sich als Gruppe weiterzuentwickeln. Die hierarchische Ordnung, in die „Gruppe“ als Organisationsform (meistens) eingebettet ist, muss für den Halt der Gruppe, d.h. für ihre Existenz innerhalb der Organisation sorgen.
Gute Gruppenarbeit kann in modernen Organisationen die Mängel der hierarchischen Organisationsform bis zu einem gewissen Grad ausgleichen. Dies ist gerade in einer Zeit, in der Hierarchien unter einigen „Krankheiten“ wie überforderten Chef*innen aufgrund zu hoher Diversifizierung und Spezialisierung leiden, ein nicht zu unterschätzender Wettbewerbsvorteil.
Dieses Modell provoziert Widerstand. Sehr oft hören wir als Grund: „Das wäre alles sehr schön, bei UNS geht das aber nicht, weil...
- das Unternehmen erlaubt gar nicht, dass die Mitarbeiter*innen so viel Verantwortung (meist geht es um Budgets) übernehmen;
- die internen Strukturen lassen das nicht zu;
- Teams funktionieren bei uns ganz anders, da geht es nicht um Entscheidungen, sondern...
- Teams in dieser Form können sich gar nicht entwickeln, weil... die Führungskraft kann/darf bei uns viele Verantwortungen und Entscheidungen gar nicht abgeben!
Diesen Punkt müssen wir aufgreifen und näher betrachten: Das Problem an dieser Stelle liegt darin, dass viele Chef*innenglauben, dass sie jetzt zu nichts mehr nutze sind: die Entscheidungen treffen die Mitarbeiter*innen, die Führungskraft soll gefälligst golfen oder angeln gehen. Der Kontroll- bzw. Machtverlust ist für viele Führungskräfte nur schwer auszuhalten.
Bei genauer Betrachtung ergeben sich jedoch neue, sehr reizvolle Alternativen. Die Führungskraft kann jetzt...
- golfen und angeln gehen und geht ihren Mitarbeiter*innen nicht mehr auf die Nerven;
- wesentlich ausgeglichener sein, ihr Privatleben funktioniert wieder und alle in der Firma atmen auf. Gott sei Dank trifft sie diejenigen Entscheidungen, die sie noch zu treffen hat, jetzt viel entspannter und besser;
- sich um den Aufbau einer neuen Abteilung kümmern. Bisher war Vergrößerung nicht möglich, jetzt eröffnen sich Spielräume;
- viel besseren Kontakt zum Markt pflegen und sich um Stammkunden persönlich und mit genügend Zeit kümmern. Das verbessert die Auftragslage und sie kann von Zeit zu Zeit an die frische Luft. Das Klima ist seitdem merklich besser und die Kund*innen kennen den*die Chef*in wieder;
- viel besseren Kontakt zu anderen Abteilungen pflegen. Seitdem funktioniert die Zusammenarbeit auch viel reibungsloser, weil die beiden Chef*innen gehen jetzt zwei Mal die Woche miteinander essen und besprechen diejenigen Dinge, die noch vor kurzem zu Reibereien und Missverständnissen geführt hatten. Die Führungskraft kann so auch wichtige Informationen aus anderen Bereichen der Firma einholen und ihren Leuten zur Verfügung stellen – es gibt schließlich keinen besseren Spion als den*die eigene*n Chef*in;
- ihre Abteilung nach außen viel besser repräsentieren. Man ist jetzt wieder wer, denn die Führungskraft betreibt Lobbying und ist ganz entzückt über die vielen Möglichkeiten, die sich jetzt auftun. Ergebnisse können jetzt viel wirkungsvoller verkauft werden. Bei Angriffen von außen hat die Führungskraft genügend Zeit und Energie, um sich schützend vor ihre Leute zu stellen und erste Attacken erfolgreich abzufangen.
- die notwendigen Informationen und Veränderungen aus der großen Organisation mit Umsicht und Bedacht aufnehmen, verarbeiten und für ihre Leute so aufbereiten, dass diese damit nicht überfordert sind. Die Führungskraft ist der beste Filter für das Team, in der Kaffeemaschine befindet sich maximal der zweitbeste...
- sich um ihre eigene Weiterbildung kümmern. Das macht ihr erstens Spaß und zweitens erhöht es ihre Kompetenzen und Möglichkeiten. Vor allem der Markt der Zukunft wird verlangen, dass Führungskräfte sich weiterentwickeln.
- mehr Zeit für ihre Mitarbeiter*innen haben – endlich kann sie sich um Probleme kümmern, die sie bis vor kurzem noch nicht einmal bemerkt hat. Sie nimmt sich viel Zeit für die einzelnen Probleme und hat auch mehr Verständnis. Das Klima ist merklich besser. Im Idealfall ist die Führungskraft auch für Konfliktmanagement zu haben (Mediation) und kann im Streitfall schlichtend (aber nicht entscheidend) eingreifen. Als Chef*in, der*die jetzt den entsprechenden Überblick hat, kann sie auch Gruppenprozesse beobachten, diagnostizieren und im Anschluss daran seinen Teamleiter*innen (oder Mitarbeiter*innen generell) unterstützend unter die Arme greifen.
- neue Ideen entwickeln, um der Abteilung ein besseres Standbein im Unternehmen zu ermöglichen. Außerdem senkt das die Kosten und erhöht die Performance.
Diese Liste lässt sich – je nach Unternehmen – noch beliebig ergänzen, eines sollte auf jeden Fall klar geworden sein: es zahlt sich aus, die Mitarbeiter*innen zur Teamentwicklung zu fördern und zu motivieren: für die Führungskraft, ihre Mitarbeiter*innen und für das Unternehmen.
Alles in allem sorgen solche Führungskräfte für einen enormen Motivationsschub bei ihren Mitarbeiter*innen. Schade, wenn man sich diese Chance entgehen lässt...
Aufgaben
Die Praxis der Teamentwicklung
1.) Hatten Sie schon Erfahrungen mit Teamentwicklung? Wie ist das gelaufen, wo lagen die Schwierigkeiten und was hat es letztlich gebracht?
2.) Wie würden Sie als Führungskraft agieren? Unter welchen Umständen würden Sie ein Team aufbauen und unter welchen eher nicht?
3.) Sollten Sie es schon erlebt haben, dass Mitarbeiter*innen nicht konnten, nicht durften oder nicht wollten – was war Ihre Rolle dabei und wie ist es Ihnen dabei ergangen?
Change Management
Klingt einfach besser als „Veränderungsmanagement“ und trotzdem werden wir uns in diesem Kapitel mit Veränderung beschäftigen.
Niemand mag Veränderung, sofern der aktuelle Zustand nicht schmerzhaft oder sonst wie negativ oder gar unerträglich ist. Das gilt natürlich auch für Veränderung in Organisationen. Zugleich gehört Veränderung aber zu jedem Leben und auch zu dem von Unternehmen.
Veränderung und Wachstum
An dieser Stelle darf vor einer Falle gewarnt werden: Veränderung ist nicht gleichzusetzen mit Wachstum. Das behaupten zwar die Wachstumsfetischist*innen, für die Wachstum per se ein anzustrebendes Gut ist, dem können wir aber locker Leopold Kohr entgegen werfen, dessen Wachstumsmodell ein biologisch-organisch-natürliches war: Alles auf dieser Welt soll seinem natürlichen Wesen gemäß wachsen – nicht weniger, aber auch nicht mehr. Kohr hat dafür das Beispiel einer Giraffe gebracht: sie wird nicht zwei und auch nicht acht, sondern vier bis fünf Meter hoch.
Unendliches Wirtschaftswachstum ist daher genauso krankhaft wie ein zu geringes oder nicht vorhandenes.
Und dann gilt es noch zwischen qualitativem und quantitativem Wachstum zu unterscheiden und an dieser Stelle führt uns die Debatte weg vom Thema. Trotzdem soll dieses zugrunde liegende Problem samt den ihm innewohnenden Widersprüchen nicht unerwähnt bleiben.
Widerstand gegen Veränderung
Selten wird bei der Ankündigung einer Strukturänderung allerorts lauter Jubel hörbar. Das ist maximal dann der Fall, wenn alle unter der derzeitigen Situation leiden oder ein*e höchst unbeliebte*r Chef*in durch die Veränderung den Sessel räumen muss. In so ziemlich allen anderen Fällen wird die Ankündigung von Veränderung zuerst auf Widerstand stoßen, der sich zuerst einmal emotional äußert.
Management von Veränderung
Emotionen sind nicht immer einfach zu kontrollieren und wenn sie kollektiv – etwa in der Belegschaft einer größeren Firma – auftreten, können sie erhebliche Probleme bereiten. Damit dies nicht geschieht, muss die geplante Veränderung gesteuert und begleitet werden. Konkret gesagt: Die Kommunikation darf nicht dem Zufall überlassen werden.
Change Management ist nichts anderes als die Planung von Kommunikation, aber auch der Umgang mit den in der Veränderung auftauchenden Emotionen. Wer das vergisst, wird in den meisten Fällen scheitern, und zwar ohne zu wissen, warum.
In diesem Kapitel werden wir uns nun damit beschäftigen, was zu tun ist, damit Veränderung gut funktioniert.
Grundbegriffe
Diese zu kennen ist ein wichtiger Meilenstein im Aufbau eigener emotionaler Kompetenz. Dafür brauchen wir zuerst eine Unterscheidung:
Gefühl ist individuelles Empfinden
Emotion ist Energie, aus der Handlungsimpulse entstehen
Affekt ist der Verlust der Impulskontrolle
Egal, was auftaucht – wichtig sind fünf Grundgefühle. Sie bewirken spezifische Reaktionen. Wer sie kennt, kann sie auffangen, damit umgehen.
| Grundgefühl | Wofür es gut ist | Was es bewirkt |
|---|---|---|
| ANGST | Schutzressource | Flucht |
| AGGRESSION | Abgrenzungsressource | Kampf |
| TRAUER | Loslösungsressource | Totstellen |
| INTERESSE | Entwicklungsressource | Öffnen |
| FREUDE | Bindungsressource | Umarmen |
Diese Grundgefühle haben wir jederzeit parat. Sie tauchen vermehrt in Krisen auf, aber auch in positiven Veränderungsprozessen.
Wenn sie auftauchen, dann sind sie da und es ist nicht sinnvoll so zu tun, als gäbe es sie nicht. Im Organisationskontext bewirken sie Unruhe, die sich gerne mal überträgt, in manchen Fällen auf ein ganzes Team oder sogar auf ein gesamtes Unternehmen. Dies zu managen ist natürlich leichter, wenn man erstens weiß, was da gerade passiert und zweitens rechtzeitig eingreifen kann.
Sehen wir uns nun ein Modell an, in dem wir einen gewissen Ablauf erkennen können. Dieses Modell ist zugleich auch eine Art Grundmuster der Veränderung. Es gilt sowohl für persönliche Veränderungen des Individuums, als auch für Prozesse in Organisationen.
Die Fieberkurve
Veränderung löst Emotionen aus und diese bewirken so etwas wie ein kollektives Ansteigen der Organisationstemperatur – als hätte die Firma Fieber.
Das erste Stadium ist das Verleugnen der Veränderung, die einen Schock ausgelöst hat. Das Grundgefühl dazu ist die Angst. Danach gibt es Vorwürfe in alle möglichen Richtungen (Konkurrenz, Vorstand, andere Abteilung, Kolleg*innen etc.), das damit verbundene Grundgefühl ist der Ärger – quasi als Sonderform der Aggression. Danach folgt die Phase der Resignation („Es ist eh alles egal, ich kann eh nichts tun“), in die sich Selbstvorwürfe mischen.
Daraus entsteht die Phase der Akzeptanz („Okay, es ist so, es ist passiert, das kann ich nicht mehr ändern“), das dazu gehörende Gefühl ist die Trauer.
Damit ist die Fieberkurver aber noch nicht zu Ende, denn aus der Akzeptanz entsteht eine gewisse Neuorientierung, weil ich mit dem Alten fertig bin, sozusagen abgeschlossen habe. Es ist Platz für Neues, das Gefühl ist jetzt das Interesse, die Neugierde („Was gibt es noch? Wo sind neue Möglichkeiten?“).
Letztlich entsteht etwas Neues, eine neue Organisationsform, eine neue Struktur, ein neues Geschäftsfeld, mit dem man sich identifizieren kann, das ein interessantes Ziel darstellt. Damit verbunden sind Freude und Motivation.
Das Management dieses Prozesses
Das ist nicht ganz einfach und in vielen Fällen brauchen Manager*innen hier Unterstützung von Fachleuten, die sich damit gut auskennen. Da in der Fieberkurve jede Menge Gefühle und Emotionen vorhanden sind (Vorwürfe, daraus entstehende Konflikte etc.), gilt es diese zu erkennen, aufzugreifen und zu bearbeiten, also quasi zu „managen“.
Sehen wir uns so einen Prozess anhand einer typischen Führungsaufgabe an, nämlich das Überbringen einer schlechten Nachricht. Das steht oft am Beginn eines Veränderungsprozesses und es gibt wohl keine*n Manager*in, der*die das gerne tut.
1.) EMOTION AUSLÖSEN (indem man Klartext redet)
- hinsetzen lassen
- schlechte Nachricht sofort und knapp formuliert überbringen
- klar bleiben: das ist so! (verleugnen verhindern)
2.) EMOTION ANNEHMEN (bitte mit Empathie. Danke.)
- zuhören
- ausschimpfen, weinen lassen
- Verständnis zeigen
- nicht versachlichen (!)
- nicht persönlich nehmen (also die Reaktion, wichtig ist hier Rollendistanz)
- Zuversicht und Haltegriffe bieten
3.) EMOTION TRANSFORMIEREN (Teil des Gestaltens)
- Sinn geben, Chance zeigen
- relativieren (das Big Picture erklären, siehe weiter unten)
- versachlichen (hier passt es jetzt)
- eigene Anteile, Möglichkeiten zeigen
- an Ressourcen und Stärken erinnern
Vorsicht: Interventionen sind zeitkritisch – was in Phase 3 hilft, kann in Phase 1 zur Eskalation beitragen (statt zu beruhigen).
Diese Liste, diese Vorgehensweise ist nicht immer ganz einfach umzusetzen, in manchen Fällen hilft es, wenn man sich hier coachen lässt. Das betrifft natürlich vor allem kritische Veränderungsprozesse, wo starke Emotionen zu erwarten sind. Es ist keine Schande, solche Gespräche mit einem*einer Coach*in zu üben, sich auf die Situation einzustellen und im Geiste (oder gerne auch auf dem Papier) die einzelnen Mitarbeiter*innen durchzugehen, die es betreffen wird. Gerade hier ist Vorbereitung oft der Schlüssel zum Erfolg.
Sehr erfolgreich ist es oft, wenn man als Führungskraft die Fieberkurve gemeinsam mit den Mitarbeiter*innen aufzeichnet und auch gemeinsam analysiert. Das hängt natürlich davon ab, was ihnen zumutbar ist bzw. auf welcher Stufe der eigenen Entwicklung sie stehen – aber Vorsicht: oft werden sie unterschätzt und es ist ein Zeichen des Vertrauens, ihnen den Umgang mit solchen Modellen zuzutrauen.
Das Big Picture
Veränderungen wollen nicht nur emotional bewältigt, sondern auch verstanden werden. Das ist vor allem in großen Organisationen oft schwierig, weil die einzelnen Mitarbeiter*innen – aus unterschiedlichen Gründen – nur Teile des gesamten Unternehmens im Blickfeld haben. Sie tun sich daher meist schwer, das Ganze zu sehen. Nicht immer ist dies übrigens unbeabsichtigt – das ist aber ein anderes Thema.
Jedenfalls gibt es sehr häufig den Wunsch, das Warum zu kennen und zu verstehen, weshalb es die Veränderung gibt. Dafür ist es hilfreich, das Ganze zu skizzieren. Ein Tipp: Machen Sie dazu ein Flipchart, anhand dessen Sie den gesamten Prozess erklären. Das erleichtert das Verständnis, vor allem, wenn es in der Sprache der Mitarbeiter*innen erklärt wird.
Am Beginn steht der Grund, weshalb es überhaupt Veränderung geben muss: Die Konzernzentrale richtet sich neu aus, neue Märkte entstehen, Sparmaßnahmen – was auch immer. Hier muss klar vermittelt werden, dass es Druck von oben (oder woher auch immer) gibt und Widerstand seinen Preis hat. Es geht aber vor allem darum, Verständnis dafür zu entwickeln, dass jetzt Maßnahmen gesetzt werden müssen. Wichtig ist es, den „case for action“ zu vermitteln, aus dem verständlich wird, woher die Notwendigkeit und Dringlichkeit für Veränderung kommt.
Danach gilt es das Ziel zu erläutern: Wohin sollen wir gehen? Was soll das bringen? Durch das Aufzeigen einer attraktiven Vision kann die Gruppe die Sogwirkung spüren und sich mitziehen lassen.
Danach geht es vor allem darum, den Weg zu beschreiben, den es jetzt zu gehen gilt. Diese besteht aus Maßnahmen, die getroffen werden müssen. Sie sind besser aushaltbar, wenn man versteht, weshalb sie erfolgen müssen und können sozusagen als Haltegriffe dienen, um im Alltag zurecht zu kommen. Hier ist wichtig, dass das Management gut abgestimmt vorgeht und nicht jeder was anderes erzählt. Das erreicht man am besten durch gemeinsame Schlüsselbotschaften, die möglicherweise mehrfach erzählt werden müssen.
Veränderung ist nicht immer lustig und angenehm, aber mit der richtigen Methode kann sie gut begleitet und bewältigt werden.
Aufgaben
Wie geht es Ihnen damit?
a.) Das ist mein täglich Brot, alles easy-cheesy
b.) Ui, da ist noch Luft nach oben
Suchen Sie sich ein Veränderungsbeispiel aus Ihrer beruflichen Vergangenheit oder Gegenwart und beschreiben Sie,
a.) wo Sie zuversichtlich sind, dass es gut funktionieren wird und
b.) wo für Sie in diesem Modell echte Herausforderungen stecken.
Das Dependenzmodell
Nach Durcharbeit dieses Kapitels sollen Sie in der Lage sein:
- zu verstehen, welche Entwicklungsphasen Menschen für ihre Entwicklung brauchen
- Ihre eigene Entwicklung zu reflektieren
Das hier besprochene Denkmodell ist überhaupt das älteste sozialwissenschaftliche Modell und beschäftigt sich mit dem Problem der Abhängigkeit. Abhängigkeiten zu haben ist eines der Grundprobleme von Menschen in ihrem hierarchischen System. Abhängigkeiten sind aber notwendig, da Menschen sich sonst nicht organisieren könnten, und Abhängigkeiten sind problematisch, weil sie unsere Freiheiten einschränken, den Menschen zu einer Maschine, einem abhängigen Instrument machen.
Wir stellen nun die These auf, dass es genau nur drei Formen von Abhängigkeit gibt. Man kann diese am besten verstehen, wenn man sie entwicklungsgeschichtlich betrachtet, zunächst einmal vom Individuum her.
Die Phasen der Abhängigkeit
Der Mensch wird geboren — wir haben zu diesem Zeitpunkt den Zustand der Dependenz, der völligen Abhängigkeit. Diese Dependenz ist Bedingung des Überlebens. Es sind zwei Menschen da, aber nur einer davon trifft Entscheidungen. Das Kind wird davon betroffen — würde man die Entscheidungen für das Kind nicht treffen, hätte das Kind keine Überlebenschancen. Daher muss ein Kind einen Pullover anziehen, wenn der Mutter kalt ist.
Diese Abhängigkeit verändert sich im Laufe der Zeit. Im Laufe der kindlichen Entwicklung zwischen dem zweiten und vierten Lebensjahr gibt es irgendwann einmal die Situation, in der z.B. die Mutter sagt: „So, jetzt kommst du zum Essen“ und der Kleine sagt auf einmal: „nein“. Mütter sind in solchen Fällen dann oft erstaunt und wissen im ersten Moment nicht, wie sie darauf reagieren sollen — meistens jedoch in der Form, dass das Kind zum Essen gedrängt wird: Die Mutter weiß schließlich, wie viel Nahrung das Kind braucht, da sie ja alle Entscheidungen trifft und daher auch das notwendige Wissen hat (haben muss): „Sag doch nicht Nein, du hast ja Hunger, du musst was essen!“ und man zerrt das Kind zum Essen. Und das kann eskalieren. Manche Kinder fangen dann an zu schreien, müssen gezwungen werden, kurz und gut: Das Kind will nicht. Und wenn man das Kind nach einiger Zeit fragt: „warum nein?“, dann kann es keinen Grund nennen, sondern nur, dass es etwas nicht will, was die Mutter will. Das ist für das Kind ein ganz bestimmendes, notwendiges Erlebnis. Diese Phase wird in ihrer Wichtigkeit stark unterschätzt und von den Erwachsenen „Trotzphase“ genannt. Das ist aber das Gefühl, das die Erwachsenen dabei haben, die als Beteiligte ihre eigenen Gefühle mitbewerten. Der Sinn dieser Phase ist der, dass das Kind erstmals darauf kommt, dass es einen eigenen Willen hat. So lange das Kind immer nur das will, was auch die Mutter oder der Vater will, weiß es nicht, ob es das selber will oder nicht. Die einzige Möglichkeit draufzukommen, dass sein Wille sein Wille ist, ist, dass das Kind einmal „Nein“ sagt. Es weiß zwar nicht, was es will, sondern weiß nur, was es nicht will, nämlich das, was die Eltern von ihm wollen. Verbal kann sich dies in der Extremform äußern, indem die Kinder sagen: „Ich will Nein!“
Diese erste Identitätsfindungsphase, die so genannte Trotzphase, dauert in etwa acht Wochen und es gibt zwei Erziehungsfehler, die man in der Rolle der Eltern begehen kann: Der eine Fehler stammt aus der klassischen Erziehung, der Art unserer Eltern und Großeltern: Man lässt Trotz nicht aufkommen, benützt die eigene Stärke für Repressionsmaßnahmen, die Kinder werden auf unterschiedlichste Weise bestraft: Sie bekommen nichts zu essen, werden eingesperrt oder verprügelt – sie müssen schließlich gehorchen lernen und sich dem Willen der Erwachsenen beugen.
Wenn der Gehorsam mit so krassen Methoden erzwungen wird, so ist es möglich, manchen Menschen in diesem Alter den Willen zu brechen. Sie werden – das ist heute die allgemeine Auffassung der Entwicklungspsychologie – in ihrem Leben nie wieder einer Autorität Widerstand leisten können. Wenn sie im Berufsleben von dem*der Direktor*in richtig angepflaumt werden, dann sagen sie: “Jawohl“. Solche Menschen werden autoritäre Strukturen bevorzugen und fühlen sich nicht wohl, wenn man ihnen nicht genau sagt, was sie tun sollen. Man bezeichnet dies als „autoritäre Übertreibung“ der Erziehungssituation.
Es gibt aber auch den umgekehrten Fehler, die antiautoritäre Übertreibung: Wenn ein Kind gegen eine Regel verstößt, gegen eine Anordnung sich wehrt, lässt man es gewähren. Diese Methode ist im Endeffekt genauso falsch und gefährlich wie die erstere. Der Sinn dieses Widerstandes besteht ja darin, gegen eine Regel zu verstoßen. Dazu braucht das Kind aber ein Gesetz. Wenn man eine Gummiwand aufbaut und sagt: „Ja, hast eh recht“ – dann gelangt man mit dieser Methode auch recht bald an eine Grenze: Spätestens im Straßenverkehr muss man das Kind, wenn es sich losreißen will, festhalten und ihm seine Grenze zeigen. Die Situation der Eltern ist vergleichbar mit einer Segeltour zwischen Skylla und Charybdis: Es ist ausgeschlossen, dabei keine Fehler zu machen.
Nach einiger Zeit ist die erste Trotzphase vorbei und es kehrt wieder Ruhe ein.
In der Pubertät kommt diese Phase wieder und erreicht einen Höhepunkt. Die Söhne (bei den Töchtern ist es ähnlich) fangen an, die Lebensweise und die Entscheidungen der Eltern in jedem nur erdenklichen Punkt zu kritisieren: Ihr Beruf ist uninteressant, die Art und Weise Urlaub zu machen spießig und das Auto eine Gurke. Die Jugendlichen probieren aus, gegen welche Entscheidungen der Eltern sie revoltieren können: Man räumt das Zimmer nicht mehr auf und hilft nicht bei der Hausarbeit: Mal sehen, wie sich die „Alten“ dagegen auflehnen, wenn man nicht das tut, was sie wollen: Wenn der Vater A sagt, dann sagt der Sohn B und umgekehrt. Das ist allerdings auch eine Form von Abhängigkeit, jedoch mit umgekehrtem Vorzeichen: Wir befinden uns in der Phase der „Konterdependenz“, der „Gegenabhängigkeit“. Sie ist deswegen eine Form der Abhängigkeit, weil man ja wiederum eine Anordnung braucht, um dagegen zu sein. Nur ist es schon sehr viel differenzierter als in der Trotzphase, denn es betrifft das gesamte Leben des Vaters: Wenn er religiös, fromm, katholisch, evangelisch ist, lässt der Sohn überall das kommunistische Manifest herumliegen, weil er weiß, dass das den Vater ärgert. Wenn der Vater ein Linker ist, entdeckt er plötzlich die Bibel, geht in die Kirche usw.
In dieser Phase gibt es auch wieder zwei mögliche Fehlhaltungen. Die eine ist die autoritäre Übertreibung: Z. B. der Vater hat eine Rechtsanwaltskanzlei, der Sohn sagt: „Ich studiere aber Medizin.“ „Kommt ja gar nicht infrage, du studierst Jus”, antwortet der Vater. Der Sohn sagt, „Ich studiere aber Medizin.“ „Gut“, sagt der Vater, „dann zahl dir das Studium selber, schau, dass du ein Stipendium kriegst.“ Das kriegt er ohnehin nicht, der Vater verdient zu viel, daher sagt der Sohn: „Gut, du hast recht, dann studiere ich doch Jus.“ In dem Fall hat der Sohn die Kurve gekratzt und ist eigentlich zur Dependenz zurückgekehrt.
Wir kennen aber auch das andere Extrem. Angenommen, der Vater plant einen gemeinsamen Familienurlaub in Italien. Eines Tages beim Mittagessen sagt der junge Mann, dass er nicht mitfährt. Der Vater greift in die Tasche und gibt ihm ein paar Hunderter mit den Worten: „Gut, fahr wohin du willst.“ Der Sohn wird plötzlich still, denn er hat ja Widerstand erwartet: Der Vater wird ihn zwingen wollen und schimpfen, in jedem Fall eine Mauer gegen seine Konterdependenz aufrichten. Stattdessen hat der Vater sofort nachgegeben und der Sohn nimmt jetzt an, dass die Eltern ihn nicht mitnehmen wollten. Plötzlich will der dann doch mitfahren.
In dem Fall hat der Vater die Kurve gekratzt und der Sohn ist wieder in die Dependenz zurück gefallen. Wir haben hier eine schwierige Situation: Wenn der Sohn nachgibt, bleibt Dependenz, wenn der Vater nachgibt, bleibt auch Dependenz. Wir können daraus schließen, dass der Sinn sowohl der autoritären wie der antiautoritären Erziehung ist, dass die Kinder dependent bleiben. Beide haben genau dasselbe Ziel und auch genau denselben Effekt. Es muss also zu einem notwendigen Konflikt kommen, den man nicht vermeiden darf, wenn Identität entstehen soll.
Es gibt Menschen, die bleiben zeitlebens abhängig, etwa vom Elternhaus z.B. und es gibt Kulturen, wo das verlangt und unterstützt wird. In unserem Kulturkreis ist in gewissem Maße die Selbstständigkeit des Menschen gefragt, daher muss man durch diese Sollbruchstelle durch. D.h., nur wenn der Sohn eine Entscheidung trifft gegen den Willen seines Vaters und der Vater bleibt dabei, dass das blöd ist, und der Sohn das macht, obwohl der Vater sagt, dass das blöd ist, dann und nur dann kann der Sohn sicher sein, dass das seine eigene Entscheidung ist. Dann und nur dann ist Entwicklung zum reifen Menschen möglich.
Selbstverständlich können auch problematische Situationen entstehen, wenn Konterdependenz zu Ende geführt wird: Wenn junge Menschen deswegen heiraten, weil die Eltern dagegen sind, dann erschöpft sich die Funktion des*der Ehepartner*in recht bald nach der Hochzeit — der*die andere war in erster Linie da, um eine Entscheidung gegen die Eltern zu treffen.
Meistens gelingt die Ablösung mithilfe einer Konkurrenzautorität: Das kann ein*e Lehrer*in, ein*e Fußballtrainer*in, ein Mädchen*Junge sein, um gegen das Elternhaus zu protestieren. Etwas, worüber die Eltern sich wahnsinnig ärgern. Man vermutet, dass die meisten Ehen, die innerhalb des ersten Jahres geschieden werden, diese Konterdependenzfunktion hatten.
Autoritäten sind notwendig und werden von Menschen auch gesucht: Wenn der Vater nicht vorhanden ist, dann richtet sich die Konterdependenz gegen die Mutter oder gegen die Großmutter. Wenn man sie in der Familie nicht finden kann, dann muss der*die Lehrer*in in der Schule herhalten – wenn diese*r aufgrund einer Überzahl an konterdependenten Schüler*innen überfordert ist, so sucht man sich andere Autoritäten, die einem den „Reibebaum“ bieten können, den man braucht, um Widerstand aufzubauen; die Polizei bietet sich hier an. Manche Menschen verbleiben auch nach der Pubertät in vielen wichtigen Bereichen ihres Lebens konterdependent und gehen z. B. bis ins hohe Alter demonstrieren, egal wogegen.
Wenn nun jemand gegen den Willen der Autorität eine Entscheidung getroffen hat und auch dabeigeblieben ist, dann ist der Glaube an eine erlangte Freiheit leider eine Illusion. Der junge Mann ist jetzt z.B. verheiratet und wieder nicht frei, sondern abhängig, und zwar gegenseitig. Wir nennen dies Interdependenz oder auch „wechselseitige Abhängigkeit“, die dritte Stufe in unserem Modell. Die gibt es auch in einer Arbeitsgruppe, wenn drei, vier oder fünf Personen zusammen sind, die anderer Meinung sind, und miteinander koordiniert werden müssen. A ist von B genauso abhängig wie B von A – was es dabei nicht gibt, ist die Independenz, die Unabhängigkeit. Das ist eine Illusion in der Konterdependenz, nämlich die Vorstellung, man könnte unabhängig sein. Unabhängig sind nur zwei Menschen, die nichts miteinander zu tun haben. Sobald sie etwas miteinander zu tun haben, dann handeln sie entweder so, dass sie alles, was einer sagt, für richtig halten, dann sind sie dependent; oder alles, was einer sagt, für falsch halten, dann sind sie konterdependent.
Ebenfalls unmöglich ist der Weg von der Dependenz in die Interdependenz unter Verweigerung der Konterdependenz. Dieser Weg durch die Konterdependenz muss auf jeden Fall überall dort gegangen werden, wo es Dependenzen gibt. Dabei können zwischen zwei Menschen alle drei Phasen auch gleichzeitig auftreten: Man kann bei jedem Menschen Dimensionen aufzeichnen, in denen er dependent ist, andere, wo er konterdependent ist und wieder andere Dimensionen, wo er interdependent ist.
Das Problem wird kulturspezifisch unterschiedlich gelöst: Im Irak etwa ist die Partnerwahl ein Problem der Dependenz. Der Vater des Bräutigams und der Vater der Braut tun sich zusammen und beschließen, dass die Kinder heiraten. Diese dürfen sich vorher nicht sehen und nach Abwicklung der Trauungszeremonien — es geschieht alles unter Schleier — erst dann sieht der Sohn, welche Braut ihm der Vater „untergejubelt“ hat. Die Braut dem Bräutigam vorher zu zeigen ist verboten, das ist ein „Tabu“. Das Tabu schützt Autorität vor Konterdependenz. Es ist ganz klar, dass so mancher Jüngling, wenn der Vater ihm die Braut zeigt, sich weigert, und dann beginnt die Konterdependenz. Damit das nicht passieren kann, darf man die Frau nicht anschauen, nicht reden, nicht diskutieren, es ist indiskutabel. Das gibt es bei uns auch: „Ihnen fehlen die Informationen!“, heißt es dann. „Sie wissen ja gar nicht, welche Gesichtspunkte Sie geleitet haben.“ Wir finden hier immer die soziale Funktion des Tabus.
Das Emanzipationsmodell und der Sündenfall
Eine Autorität allein kann nur schwer relativiert werden, da Dependenz in sich kein Kriterium der Konterdependenz haben kann. Die Negation muss von außen kommen. Identität ist immer schon vorausgesetzt, damit Identität überhaupt gefunden werden kann. Hier liegt die gleiche Problematik wie bei der Erklärung der Sprache und der Erkenntnis vor. Müsste man nicht zur Erkenntnis verführt werden, dann wäre Erkenntnis immer schon vorhanden, damit sie möglich ist. Diese Dialektik der Emanzipation ist in zahlreichen Mythen immer wieder reflektiert worden. Der bekannteste ist der vom Sündenfall in der Bibel:
Gott, die Autorität schlechthin, “schuf am Anfang Himmel und Erde“ (Genesis 1,1). Damit ist Gott das Prinzip aller Abhängigkeit, da es nichts gibt, was nicht von ihm abhängig wäre. Nach dem Genesismythos schuf Gott auch noch den Menschen: „Dann pflanzte Gott der Herr einen Garten in Eden, fern im Osten und versetzte dahin den Menschen, den er gebildet hatte. Und Gott der Herr ließ aus dem Boden allerlei Bäume hervor wachsen, deren Anblick lieblich und deren Früchte wohlschmeckend waren.“
Darunter auch den Baum des Lebens in der Mitte des Gartens und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. (Genesis 2,25) Im dritten Kapitel des Genesis - Berichtes wird nun die Emanzipationsproblematik in einer allgemeinen und klassischen Form wiedergegeben:
„Die Schlange aber war listiger als alle Tiere des Feldes, welche Gott der Herr gemacht hatte. Sie sprach zu dem Weibe: hat Gott wirklich gesagt, von keinem Baume des Gartens dürft ihr essen? Das Weib entgegnete der Schlange: von den Früchten der Bäume des Gartens dürfen wir essen, nur von den Früchten des Baumes, welcher in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt, davon dürft ihr nicht essen, ja nicht einmal daran rühren dürft ihr sonst müsst ihr sterben. Da erwiderte die Schlange dem Weibe: keineswegs werdet ihr sterben. Gott weiß vielmehr, das sich an dem Tage, da ihr davon esset, eure Augen auftun werden und ihr wie Gott sein werdet, erkennend Gutes und Böses. Jetzt sah das Weib, das die Früchte des Baumes wohlschmeckend und eine Lust für die Augen und begehrenswert seien, um durch sie weise zu werden. So nahm sie von seinen Früchten und aß und gab davon auch ihrem Manne, der bei ihr war und er aß auch. Nun gingen beiden die Augen auf und sie erkannten, das sie nackt seien. Deshalb flochten sie Feigenblätter zusammen und machten sich Schürzen. Als sie aber die Stimme Gottes, des Herrn, hörten, der sich im Garten zur Zeit des Tagwindes erging, da versteckten sich Adam und sein Weib vor Gott, dem Herrn, unter den Bäumen des Gartens.
Aber Gott der Herr rief nach dem Menschen und fragte ihn: wo bist du? Der antwortete ihm: deine Stimme hörte ich im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum habe ich mich versteckt. Da sprach Gott: wer hat dir kundgetan, das du nackt bist? Hast du etwa von dem Baume gegessen, von dem zu essen ich dir verboten habe? Adam entgegnete: die Frau, die du mir beigestellt hast, die gab mir von dem Baume und so aß ich. Nun fragte Gott das Weib: warum hast du das getan? Das Weib erwiderte: die Schlange verführte mich, da habe ich gegessen. Da sprach Gott der Herr zur Schlange: weil du das getan hast, darum sollst du verflucht sein unter allem Vieh und den Tieren des Feldes. Auf deinem Bauche sollst du kriechen und Staub fressen alle Tage deines Lebens. Feindschaft setze ich zwischen dir und dem Weibe und zwischen deinem Spross und ihrem Spross. Der wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn nur an der Ferse verletzen. Zum Weibe sprach er: Zahlreich werde ich machen die Beschwerden deiner Mutterschaft, in Schmerzen sollst du Kinder haben und doch wirst du nach deinem Manne verlangen, der dich beherrschen wird. Zu Adam aber sagte er: weil du auf die Stimme deines Weibes gehört und von dem Baume gegessen hast, von dem ich dir verboten habe, du sollst nicht davon essen, so soll der Erdboden deinetwegen verflucht sein. Mit Mühsal sollst du dich von ihm nähren alle Tage deines Lebens. Dornen und Disteln soll er dir tragen und doch musst du das Kraut des Feldes essen. Im Schweiße deines Angesichtes wirst du das Brot essen bis du zur Erde zurückkehrst, von der du ja gekommen bist, denn Staub bist du und zum Staube musst du wieder zurück. Und Adam nannte seine Frau Eva, denn sie ward die Mutter aller Lebendigen. Gott, der Herr, aber machte für Adam und sein Weib Kleider aus Fellen und bekleidete sie damit. Und Gott, der Herr, sprach: Führwahr, der Mensch ist wie unsereiner geworden, so dass er erkennt, was gut und böse ist. Nun aber, damit er nicht seine Hand ausstrecke und auch vom Baum des Lebens nehme und esse und lebe ewiglich, vertrieb ihn Gott, der Herr, aus dem Garten von Eden, damit er den Boden bearbeitete, dem er entnommen war. Und als er den Menschen hinausgetrieben hatte, stellte er im Osten des Gartens von Eden die Cherubim und die Flamme des blitzenden Schwertes hin, um den Weg zum Baume des Lebens zu bewachen.“ (Genesis 3,1 - 24)
Die Negation dieses Gebotes wird in diesem Mythos radikal verstanden, denn nach dem Essen vom Baum der Erkenntnis bestätigt Gott, der vorher mit dem Tode gedroht hatte, die Prophezeiung der Schlange: der Mensch ist gottähnlich geworden, indem er erkennt, was gut und böse ist. In der Dependenz gibt es keine eigene Entscheidung des*der einzelnen. Gut und Böse sind durch die Vorschriften der Autorität bzw. des Standards geregelt. Wer keine eigenen Entscheidungen trifft, ist für fremde Entscheidungen auch nicht verantwortlich. Erst das Essen vom Baume der Erkenntnis — womit der Mensch den gesicherten Bereich der Dependenz verlässt — führt zu einer Unterscheidung von gut und böse. Dependenz kann nach dem Genesis-Mythos aber nur durch die Negation der Autorität und ihres Gebotes verlassen werden. Die Missachtung des Verbotes kam aber im Paradies nicht von den Menschen selber, sondern der Impuls zur Konterdependenz kam von außen, von der Schlange. Hier treffen wir im Mythos auf das Voraussetzungsproblem. Denn auch die Schlange — sie gilt als die Inkorporation des Teufels — ist einst von Gott abgefallen.
Luzifer, der „zweite Mensch in der Hierarchie“, hatte sich mit dem*der Chef*in überworfen und verführt nun die Geschöpfe. Auch hier müsste man natürlich die Frage stellen: Wie kam es zum Sündenfall Luzifers, des Lichtträgers? Der Sündenfall ist immer schon vorausgesetzt, damit er möglich wird, wie die Sprache immer schon vorausgesetzt ist, damit gesprochen werden kann. Erkenntnis setzt schon Erkenntnis voraus.
Ein interessanter Hinweis auf Paarbildung findet sich im Genesis-Mythos unter den Folgen des Sündenfalls. Das erste, was Adam und Eva bemerkten, ist ihre Nacktheit. Damit ist der Zusammenhang von Konterdependenz und Intimsphäre angesprochen. Die Negation der Autorität, das Verlassen der Dependenz, ist zugleich die Abschirmung einer Eigensphäre, der Versuch, eine Eigenidentität zu bekommen. Adam und Eva versteckten sich vor der Autorität Gottes im Garten. Zur Selbstbestimmung gehört die Kontrolle über die Intimsphäre, die Kommunikation in Subgruppen, z.B. in Paaren. Die Konterdependenz wird aber nicht nur zwischen den Menschen und Gott angesprochen, sondern auch zwischen den Menschen. Adam wird ja von Eva verführt, und Eva von der Schlange. Die Verführung als Dependenz verwandelt sich durch das Essen vom Baum der Erkenntnis in Konterdependenz. Die Autorität Gottes wurde für Eva durch die Schlange relativiert, für Adam durch Eva. Trotz aller Schwierigkeiten wird Eva nach dem Manne verlangen, obwohl er über sie herrschen wird. Weil Adam auf sein Weib hörte, statt auf Gott, wird der Erdboden verflucht sein und Dornen und Disteln tragen.
Was hier beschrieben wird, ist noch keine sehr freie und glückliche Form der Selbstbestimmung, sondern der erste Versuch, Dependenzen zu verlassen und durch andere zu ersetzen — sozusagen der Beginn eines langen Entwicklungsprozesses. Damit geht der Verlust des Paradieses einher, in dem in dependenter Weise alle für das Überleben wichtigen Funktionen anderen Instanzen überlassen wurde. Diese Instanzen sind etwa die Programme der Erbkoordination oder die erwachsenen Tiere, die Gruppe oder der Stamm. Der jedenfalls zu einem Teil emanzipierte Mensch beneidet mitunter in romantischer Sehnsucht nach dem Paradies die Tiere um ihre unmittelbare Dependenz.
Weitere Details finden sich in: Schwarz, Gerhard, Die „Heilige Ordnung“ der Männer – Hierarchie, Gruppendynamik und die neue Rolle der Frauen, 5. Auflage, VS-Verlag, Wiesbaden 2007
Aufgaben
Das ist nicht einfach – aber versuchen Sie es:
1.) In welchen Lebensbereichen sind Sie Ihrer Wahrnehmung nach dependent?
2.) Wo stecken Sie in der Konterdependenz?
3.) Wo haben Sie Interdependenz erreicht?
4.) Erinnern Sie sich an ein Ereignis in Ihrem Leben, wo Emanzipation eine wichtige Rolle gespielt hat. Was haben Sie daraus gelernt?
5.) Denken Sie an die Arbeit – wo bereitet Ihnen ein Aspekt des Emanzipationsmodells Schwierigkeiten?
Abschlussreflexion
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die eigentlichen Lerneffekte für mich (und wahrscheinliche auch für Sie) nicht im Durcharbeiten des Skripts oder beim Lesen eines Buches passieren, sondern in der täglichen, praktischen Arbeit, und zwar genau dann, wenn wir bereit sind, uns mit einem Thema näher zu befassen, selbst quasi auf eine kleine Expedition zu gehen. Dabei tauchen z. B. folgende Fragen auf:
- Was steckt dahinter?
- Was haben Fachleute dazu gesagt oder geschrieben?
- Wie passt das zu meinen eigenen Erfahrungen?
- Und vor allem: Wie passt das zu der Aufgabe, die ich gerade bewältigen muss?
Studierende sind Menschen, die einen Schritt weitergehen als andere, die ein Problem, eine Herausforderung, eine Aufgabenstellung nur oberflächlich betrachten, sich damit zufriedengeben und dann aber auch wollen, dass andere die guten Entscheidungen finden und treffen.
Wer sich eine Zeit lang mit einem Thema befasst, selbst nachforscht, Standpunkte vergleicht, sich eine eigene Meinung bildet und diese mit anderen konfrontiert, erschafft wertvolles Wissen, das dann in der Situation einer Herausforderung abrufbar ist. Das ist auch nichts, was man schnell wieder vergisst, weil man es sich nur für eine Prüfung angelernt hat. Sehen wir uns folgenden Widerspruch an:
- Nur wer sich mit dem Problem in ausreichender Form beschäftigt, wird zu einer guten Lösung kommen.
- Nur wer sich nicht dauernd mit dem Problem beschäftigt, sondern die Lösung sucht,
wird Erfolg haben.
Hier finden wir den Hinweis, dass letztlich nur eine Positionierung praxistauglich ist. Menschen wollen und brauchen Entscheidungen – im Idealfall solche, die auf einer soliden Basis ruhen.
Studierende sind Menschen, die sich so eine Basis erarbeiten, die vor allem gelernt haben, dies immer wieder zu tun, weil es keine singuläre Antwort auf viele Fragen und Herausforderungen gibt.
Versuchen Sie in dieser Abschlussreflexion über obigen Widerspruch nachzudenken und sich eigene Antworten zu erarbeiten, etwa mit folgenden Fragen:
- Zu welcher Seite neige ich persönlich eher? Problem oder Lösung? Und warum?
- Was sind für mich die Vor- und Nachteile dieser beiden Ansätze?
- Wohin zieht es mich eher – zur Hierarchie oder in die Gruppe? Warum ist das so, was erwarte ich mir von der einen, was ich von der anderen nicht in der notwendigen Qualität bekommen kann? Oder wäre ich selbst ein*e gute*r Vermittler*in zwischen beiden? Womit komme ich persönlich besser zurecht?
Überlegen Sie sich bitte, wie Sie diese Fragen in der für Sie richtigen Art und Weise beantworten? Welche Technik wählen Sie hier aus? Eine Tabelle? Eine Power-Point- Präsentation? Ein Spaziergang im Wald mit Notizbuch? Eine Collage?
Wenn Sie diese Frage beantworten können, dann haben Sie einen guten, weil selbständigen Weg eingeschlagen und sind diesen auch schon ein ordentliches Stück gegangen.
Es gibt daher für diese Lektion auch kein Handout mehr, keine Vorlage. Finden Sie selbst den für Sie richtigen Weg!
Anhang: Literaturverzeichnis
Bücher
Glasl, F. / Sievers, B. (Hrsg): Organisationsentwicklung in der Praxis;
Roth, Eugen: Von Mensch zu Mensch; Verlag Buch und Welt (ohne Jahresangabe)
Schwarz, Gerhard (2007): Die „Heilige Ordnung“ der Männer – Hierarchie, Gruppendynamik und die neue Rolle der Frauen; 5. überarbeitete Auflage, VS-Verlag, Wiesbaden
Literatur
Doppler, Klaus/Lauterburg, Christoph (1997): Change Management. Den Unternehmenswandel gestalten. Frankfurt / New York: Campus
Kirsch, Werner / Esser, Werner-Michael / Gabele, Eduard (1979): Das Management des geplanten Wandels von Organisationen. Stuttgart: Poeschel
Piber, Hannes (1987): Die Leiden mit dem Leitbild. In Trigon Themen 1/87, S. 10-12+
Wohlgemuth, Andrè C. (1991): Das Beratungskonzept der Organisationsentwicklung. Neue Form der Unternehmensberatung auf Grundlage des sozio-technischen Systemansatzes. Bern: Haupt.
Heimerl, P. / Loisel, O. (2005): Lernen mit Fallstudien in der Organisations- und Personal- entwicklung. Wien (Linde)
Internetquellen
International Organization for Standardization http://www.iso.org, Abruf: 4.2.2009
- ↑ vgl. Heimerl 2009, S. 180 ff
- ↑ Dieses Kapitel baut auf einem Skriptum von Bernhard Pesendorfer auf. Weitere Ausführungen dazu in: Schwarz G. (Hg.), Gruppendynamik - Geschichte und Zukunft (Festschrift für Traugott Lindner). WUV-Univ.Verlag, Wien 1993, S.196-230. Die erste Fassung von 1983 fand Verwendung in den Unterlagen des: IBM-Management-Symposiums, Wien 1983, S.39-50. Inzwischen wurde dieser Artikel in vielen Seminarunterlagen an Universitäten und Management-Programmen verwendet. Oft sind die entsprechenden Thesen diskutiert worden: A) im Philosophenkreis mit Uwe Arnold, Gerhard Schwarz, B) im Kreise der ÖGGO (Österreichischen Gesellschaft für Gruppendynamik und Organisationsberatung) mit Ewald Krainz und Rudi Wimmer (R. Wimmer, 1993, Zur Eigendynamik komplexer Organisationen. Sind Unternehmen mit hoher Eigenkomplexität noch steuerbar?; in G: Fatzer (Hrsg.), Organisationsentwicklung für die Zukunft - ein Handbuch -, Köln, S. 255-308.), C) im Kreise der E.I.T. mit Trygve Johnstad und Gunnar Hjelholt. Auch mit Traugott Lindner.
- ↑ R.Fox, Bedingungen der sexuellen Evolution. In: Ariès, Bejin, Foucault u.a. Die Masken des Begehrens und die Metamorphosen der Sinnlichkeit.1982.dt.1984
- ↑ D.Claessens, Das Konkrete und das Abstrakte. 1980
- ↑ C.Lévi-Strauss, De elementaren Strukturen der Verwandtschaft. 1947.19662.dt.1981. G.Devereux, Ethnopsychoanalyse. 1972.dt.1984
- ↑ vgl.R.Fox l.c. R.Ranke-Graves, Griechische Mythologie. 1955,dt.1960. H.Göttner-Abendrot, Die Göttin und ihr Heros.1980. R.Fester, M.König, D.Jonas, A.Jonas, Weib und Macht.1979
- ↑ Die folgenden Thesen fußen im Wesentlichen auf Gedankengängen von Uwe Arnold, die wir gemeinsam in diversen Lehrveranstaltungen an der Klagenfurter Universität über Jahre diskutiert und immer wieder variiert und geprüft haben.
- ↑ in diesem Punkte verdanke ich viel Ramon Meseguer und José Bleger's Überlegungen zur Operativen Gruppe. Dazu: A.Bauleo, Ideologie, Familie und Gruppe.1982.dt.1988
- ↑ Immanuel Kant, Reflexion 7687 aus dem handschriftlichen Nachlass, Akademie-Ausgabe XIX, 483