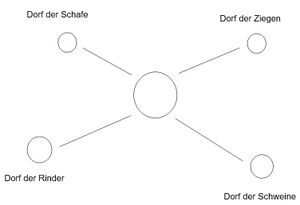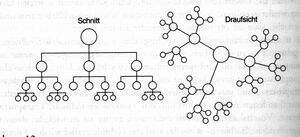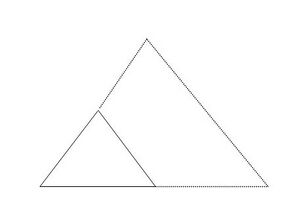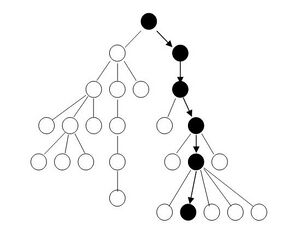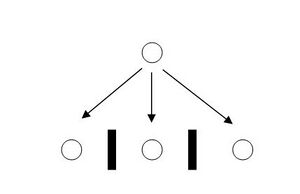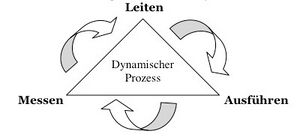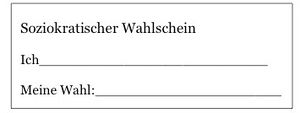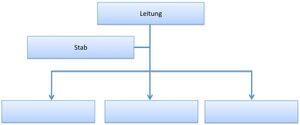Management und Organisation - Gesamt
Dr. Guido Schwarz, Jahrgang 1966, Dr. phil. an der Uni Wien 1997
Philosoph und Gruppendynamiker. Als selbständiger Unternehmensberater in Wien tätig. Autor zahlreicher Fachbücher.
Spezialgebiete: Qualitative Motivforschung, Organisationsentwicklung, Konfliktmanagement und Teamentwicklung, Coaching und Training sowie die Betriebsübergabe von Familienunternehmen.
Einleitung
Management und Organisation – das klingt toll! Wer möchte nicht gerne „Manager*in“ sein? Die werden gut bezahlt, sind gesellschaftlich hoch angesehen, laufen in feschen Anzügen herum – ein Traum, quasi.
Manager sind meist Männer, aber auch Managerinnen leiden an Burn-Out, sind manchmal Workaholics mit kaputten Familien und noch kaputterem Kreislauf, werden hin und wieder von der Polizei verhaftet und wegen fahrlässiger Krida, Betrug, Korruption etc. angeklagt.
Manager*innen sind oft erfolgreich, retten eine Firma vor dem Konkurs oder reiten sie genau dort hinein. Dann sind sie weniger erfolgreich, verdienen aber manchmal umso besser. Sie gelten als „tough“, „smart“ und tauchen gerne auf Titelseiten von Wirtschaftsmagazinen auf.
Wir müssen ein buntes Bild zeichnen, wenn wir „Manager*innen“ beschreiben wollen. Aber was tun die eigentlich? Sie sind meist Angestellte einer Firma, Führungskräfte, stehen in der Hierarchie „ganz oben“ auf einer „Managementebene“ und kämpfen darum, in den „Vorstand“ oder, wenn sie schon graue Haare haben, in den „Aufsichtsrat“ zu kommen.
Manager*innen haben oft studiert, meistens Jus oder Betriebswirtschaft, oder sie haben sich ohne Studium „hochgearbeitet“. Scheinbar kann man das anstreben, Manager*in zu werden.
Sie treffen scheinbar wichtige Entscheidungen und haben Verantwortung. Dafür werden sie bezahlt. Sie können zur Rechenschaft gezogen werden, wenn sie „Missmanagement“ betreiben.
In der Praxis zeigt sich, dass das alles scheinbar nicht so einfach ist. Was also sollen wir tun, wenn wir „Management und Organisation“ lernen wollen? Diese Lehrveranstaltung kann keine Managementausbildung ersetzen – ganz abgesehen davon, dass es davon jede Menge gibt und sie bei weitem nicht alle gleich sind.
Es soll einen Einblick in die Komplexität der Aufgabe bieten. Dabei werden wir ausschnittsweise tief in die Materie eindringen und uns Managementtheorien ansehen. Wir werden aber auch handfeste, praxisorientierte Fragen stellen und beantworten.
Wer dieses Studienheft durcharbeitet, wird vor allem die Grenzen von Management und Organisation kennen lernen. Jede Firma ist anders, jedes Unternehmen stellt eigenen Anforderungen und trotzdem gibt es Gemeinsamkeiten. Es ist ähnlich wie beim Flaschentauchen: Wie das geht kann man in ca. einem Tag lernen. Was aber zu tun ist, wenn etwas nicht funktioniert, dafür braucht man einen ganzen Tauchkurs und danach noch eine Menge Praxis.
Das Studienheft kann somit keinen Anspruch auf Vollständigkeit stellen. Es ist ein Blick durchs Schlüsselloch plus dem Versuch, einige Anleitungen für das praktische Handeln zu bieten: Wie gehe ich mit eigenen Grenzen um? Worauf muss ich in schwierigen Situationen achten und welche typischen gibt es, mit denen ich mit ziemlicher Sicherheit konfrontiert werde?
Management ist leicht, wenn alles flüssig läuft. Weniger leicht ist es, wenn es Probleme gibt. Dann ist ein wenig Hilfe sehr angenehm. Diese Lehrveranstaltung soll dazu dienen, Ihnen ein paar Tipps und Tricks mit auf den Weg zu geben.
Das didaktische Konzept
Gemeinsam sind wir gescheiter – das ist das Motto nicht nur dieser Lehrveranstaltung. Wäre dem nicht so, dann würde der bilaterale Kontakt Lehrer-Schüler schon in der Schule mehr als ausreichend sein. Lernen ist jedoch eine Form des Miteinanders, des Austauschs, der gegenseitigen Hilfe, der verstärkenden Motivation – kurz: Student*in sein heißt nicht nur Bücher wälzen und lernen. Es bedeutet einen Weg gemeinsam zu gehen.
Daher verlangt diese Lehrveranstaltung auch nach einem Miteinander. Es gibt nur wenige Präsenzphasen, dazwischen studieren alle mehr oder weniger allein. Der Ausgleich ist das gemeinsame Forum, die Internet-Plattform, auf der Austausch möglich ist. Aus didaktischer Sicht ist das eher eine notdürftige Hilfsmaßnahme, aber das bedeutet nur, dass wir sie so gut nützen werden wie möglich – schließlich haben wir keine andere.
In anderen Studien werden ganze Semester oder mehr für das Thema Management und Organisation verwendet (und gebraucht), wir müssen mit einer einzigen Lehrveranstaltung auskommen. Daher könnte man etwas spitzfindig sagen: Wir verwalten den Mangel und bemühen uns, das möglichst effizient zu tun. Es ist eine Gratwanderung zwischen Appetizer und Eingehen aufs Detail.
Das Ziel besteht darin, ein Bewusstsein für die Vielschichtigkeit des Themas zu schaffen, aber auch Lust auf mehr zu machen. Wirtschaftsinformatik ist nicht zwangsläufig Management, kann damit aber durchaus zu tun haben. Absolvent*innen dieser Fern-FH sind bereits vielfach Führungskräfte oder werden dies sein. Spätestens dann geht es auch um genau die Themen, die wir in dieser Lehrveranstaltung anschneiden, durchdiskutieren und bearbeiten.
Wie die Student*innen am einfachsten durch die Lehrveranstaltung kommen:
Ich halte nicht viel von der klassischen Prüfungsform. Ich gehe davon aus, dass ich es mit erwachsenen Menschen zu tun habe, die einen gewissen Grad von Eigenverantwortung besitzen. Ich bin auch der Meinung, dass „Management und Organisation“ sich nicht als klassisches Prüfungsfach wie etwa Mathematik oder Statistik eignet, sondern dass es hier darum geht, menschliches Verhalten in seiner Komplexität zu verstehen.
Das Ziel kann somit auch nur ein besseres Verständnis von Kommunikation sein. Daher ist dieses Studienheft als Denk-Ansporn zu lesen und durch zu arbeiten.
Ja, es handelt sich um Arbeit, weil Sie, verehrte Student*innen, das hier Geschriebene mit Ihren eigenen Ansichten und Meinungen vergleichen müssen. Damit noch nicht genug, Sie müssen auch eigene Schlüsse daraus ziehen, die Gedanken weiter verfolgen, verändern, variieren, Sie müssen das bisher Ungedachte denken, das ist meist weit anstrengender als etwas im klassischen Sinn zu lernen, in sich hinein zu stopfen, kurz wieder raus zu rülpsen und dann hinter sich zu lassen.
Lernen bedeutet somit Eigencheck: Was geht das mich an? Was habe ich damit zu tun? Sie lernen sich im Idealfall selbst besser kennen, indem Sie ihre eigenen Erlebnisse, Erfahrungen und die daraus entstandenen Meinungen mit den hier vorgebrachten Ideen und Theorien vergleichen. Und dann müssen Sie sich noch eine neue, eigene Meinung bilden, die meist eine Mischung aus beidem ist. Leider entstehen hier Widersprüche, die Sie bearbeiten müssen. Das ist auch eine der wichtigsten Tätigkeiten eines*einer Manager*in, so viel sei hier schon verraten.
Sie müssen die Melange dann selbst als solche erkennen („reflektieren“) und in kompakter Form wiedergeben. Das ist sozusagen die Prüfung, das ist die zu erledigende Aufgabe. Sie müssen sich das Leben nicht schwer machen. Wie viel Zeit und Energie Sie hinein stecken, kann ich nicht überprüfen, wiewohl ich immer einen guten Einblick erhalte, wenn ich die verschiedenen Lösungen der einzelnen Lektionen miteinander vergleiche bzw. die einzelnen Student*innen miteinander vergleiche.
Sie können das übrigens auch tun und dann feststellen, wo Sie stehen.
Qualität schlägt Quantität. Es geht mir nicht um die Menge des Reflektierten, sondern um dessen Art und Weise.
Die „Prüfung“
In vergangenen Lehrveranstaltungen haben Student*innen zum Rechner gegriffen und sich anhand der Anforderungen im didaktischen Konzept ausgerechnet, wie viel (oder besser wie wenig) sie tun müssen, um durchzukommen. Das ist eine seltsame Form der Ökonomie, denn ich darf das kurz mit dem Erlangen eines Pilotenscheins vergleichen. Sie lernen in drei Phasen das Fliegen. In der ersten Phase das Starten, in der zweiten das Fliegen und in der dritten das Landen. Wenn Sie sich nun ausrechnen, dass Sie mit zwei Drittel eigentlich den Pilotenschein positiv bestehen können, dann ist es kein Problem, den dritten Teil einfach auszulassen. Zwei Drittel reichen für ein Genügend und das ist schließlich genügend. Stellt sich nur die Frage, was machen Sie bei der ersten Landung?
Daher gibt es für diese Lehrveranstaltung keine Prozente, die Sie erlangen müssen, um zu bestehen. Wie im Management geht es darum, sich der vorhandenen Situation zu stellen, und diese sieht folgendermaßen aus:
1.) Präsenzveranstaltungen
Die erste dient dem guten Start in die Lehrveranstaltung. Wer dabei ist, ist sozusagen dabei. Wer nicht dabei ist, sollte dies nachholen und sich auch aktiv darum kümmern, sprich: zu einem*einer Kolleg*in gehen und sich entsprechend informieren. Die zweite Präsenzveranstaltung und – optional, das ändert sich je nach Semester – die dritte haben Anwesenheitspflicht, denn sie sind ein Kernstück der Lehrveranstaltung. Wer hier nicht dabei sein kann, muss entsprechende Mehrarbeit auf sich nehmen. Wie diese aussieht, ist im jeweiligen Fall mit dem Lehrveranstaltungsleiter zu klären, aber auch mit den Mitstudent*innen, denn diese müssen ebenfalls dafür „büßen“. Das ist wie im Management, wenn einer nicht kann, müssen andere einspringen.
2.) Die Lektionen dieses Studienhefts Sie sind so aufgebaut, dass Sie mitdenken müssen, um die Aufgaben zu lösen. Es geht nicht darum, das Gelesene noch einmal wieder zu käuen, wie das sonst so gerne verlangt wird. Es geht darum, die eigene Lebenswelt mit dem Gelesenen zu konfrontieren und daraus Schlüsse zu ziehen. Ich kann Ihnen nichts lehren, Sie müssen selbst etwas lernen. Übrigens: Sie wissen schon alles. Es kann allerdings vorkommen, dass Sie noch nicht wissen, dass Sie es wissen. Da kann ich dann ein wenig mithelfen, so dass Sie das in Ihnen Verborgene herauslocken. Das macht übrigens manchmal durchaus Spaß. Die Ergebnisse stellen Sie bitte als PDF-Dokumente ins Forum zur jeweiligen Lektion.
3.) Der Zeitplan
Das Studienheft sollte vor der letzten Präsenzphase fertig durchgearbeitet sein. Es ist für alle Beteiligten mühsam, wenn dies nicht geschieht. Also reservieren Sie sich rechtzeitig Zeit. Sie können sich die Arbeit frei einteilen: Manche arbeiten das gesamte Studienheft samt Aufgaben und Lösungen in einem Wochenende durch, andere verdauen es häppchenweise. Machen Sie das, wie es Ihnen am besten passt. Sie wissen selbst am besten, was für Sie gut ist.
Und jetzt viel Spaß beim Arbeiten!
„Organisation“ – was ist das?
Kreisky meinte bei einer öffentlichen Diskussion zu seinem Gesprächspartner „Lernen Sie Geschichte!“
Ganz abgesehen davon, dass er als Elder Statesman sich gewisse Äußerungen leisten konnte, stecken da ein paar tiefer gehende Ideen dahinter:
1.) Es deutet auf den akademischen Gedanken hin – und die Absolvent*innen dieser Lehrveranstaltungen wollen schließlich einen akademischen Titel. Daher sollten sie auch akademisch agieren bzw. denken.
Was bedeutet eigentlich „akademisch“? Hier braucht es einen kleinen Ausflug in die Philosophie, genauer ins alte Griechenland, so etwa vor 2.500 Jahren.
Der griechische Philosoph Platon kaufte im Jahr 388 v.Chr. einen Garten am Fuße der Akropolis in Athen, der nach dem griechischen Helden Akademos benannt war. Dort pflegte er mit seinen Freunden und Kollegen herumzugehen und zu philosophieren (weil man beim Gehen rechte und linke Gehirnhälfte ausgleichen kann – daraus entstand später die „peripatetische Schule“ von Aristoteles, dem Schüler Platons). Nach einiger Zeit tauchte das Problem auf, dass man allen neu hinzukommenden Schülern immer zuerst all das erklären musste, was man gemeinsam schon ausführlich diskutiert hatte – sonst konnten sie nicht mitreden, weil ihnen das Vorwissen fehlte.
Daher entschloss sich Platon, die wichtigsten Gedanken aufzuschreiben. Die künftigen Mitglieder der Akademie mussten diese Schriften zuerst lesen und durften erst dann mitreden. Wer sich das Wissen angeeignet hatte, bekam den Status des „Akademakoi“ (Akademikers) und war von nun an vollwertiges Mitglied der Akademie.
Die Akademie bestand insgesamt 800 Jahre lang. Ob das die Fern-FH auch schafft? Egal, es geht darum, was wir von den alten Griechen lernen können, das uns heute weiter hilft. Einen Punkt gäbe es durchaus: Lernen wir Geschichte! Versuchen wir uns das Wertvolle aus dem zu holen, was andere bereits gedacht und entwickelt haben.
2.) Die zweite Idee besteht darin, uns die Geschichte von „Organisation“ näher anzusehen, also zu lernen, warum und wie sie entstanden ist, sich entwickelt hat. Das würde als spannenden Nebeneffekt die Erkenntnis über Möglichkeiten und Grenzen von Organisation bringen, uns sozusagen einen Rahmen liefern, innerhalb dessen wir planen, agieren... managen können. Wäre das nicht wertvoll? Platon würde leise applaudieren und sich ein Achterl Rotwein gönnen. Es ist eigentlich nicht schwer: Die Menschen haben bisher nur zwei sich grundlegend voneinander unterscheidende Organisationsformen erfunden: Hierarchie und Gruppe. Was uns heute als Kultur, Zivilisation und Fortschritt vorliegt, ist das Ergebnis von Organisation, von Hierarchie, von Funktionsspezialisierung und Arbeitsteilung. Der allenthalben ausgebrochene Zweifel an Fortschritt und Zivilisation, Technik und Spezialistentum hängt auch mit einer Hierarchie- und Organisationskrise zusammen. Wir sind heute vor Globalprobleme gestellt, denen gegenüber unsere spezialistisch organisierte Arbeitsteilung versagt. Hierarchien können sich angesichts dessen entweder einigen und vor komplexeren Aufgaben resignieren oder neue Organisationsformen ausprobieren. Interessanterweise greifen diese Versuche immer wieder auf Gruppen zurück. Eine weltgeschichtliche „Nostalgie“? Fast muss man den Eindruck haben, beobachtet man etwa den Ethnologie-Boom der letzten Jahre, wo Stammeskulturen – weitgehend unorganisiert, wenn man von geschlechtsspezifischer Arbeitsteilung absieht – zu neuer Anerkennung gekommen sind.
Dies überrascht nicht. Durch die ganze Geschichte lässt sich beobachten, dass gegen Hierarchien und Organisationen immer wieder das Gruppenprinzip aktiviert wurde. Die Geschichte der Revolutionen ist eine Geschichte von Gruppen; deshalb fiel es immer so schwer, aus Revolutionen wieder einen „Staat“ zu bauen: Entweder blieben die Revolutionäre vor allem emotional ihren Gruppen verbunden und kämpften dann gewissermaßen gegen sich selbst und ihre eigene neue Funktion als „Staatsdiener“, oder sie werden zu solchen und polarisieren ihre ehemaligen Anhänger.
Von Anbeginn und grundsätzlich befinden sich Hierarchie und Gruppe in einer ständigen Gegnerschaft, die manchmal latent und befriedet ist, manchmal offen ausbricht (griffige Beispiele dafür wären etwa Abteilungsegoismus gegen Gesamtunternehmen, Familie gegen Schule, Banden gegen öffentliche Ordnung, „Freunderlwirtschaft“ und Geheimbünde gegen offizielle Strukturen). Dass auch im Projektmanagement auf das Gruppenprinzip zurückgegriffen wird, ist historisch nicht zufällig. Zugleich wissen wir, dass es trotz aller romantisch-utopischen Wünsche und Vorstellungen unmöglich ist, unsere Organisationen und Hierarchien abzuschaffen. Man kann sagen: Wo mehr als 15 Personen eine gemeinsame Aufgabe erledigen wollen oder müssen, braucht es Organisation. Da wir keine andere Organisationsform als die hierarchische kennen, läuft es stets auf ebendiese hinaus. Es wurde versucht, Unterformen bzw. Sonderformen (Stab-Linien-Organisation, Matrix-Organisation) zu erfinden, diese haben sich auch teilweise bewährt, die Grundprinzipien bleiben jedoch stets die gleichen
Wir sind also heute vor die Aufgabe gestellt, die Vorteile der Gruppe mit der Notwendigkeit der Hierarchie zu vereinen und zugleich mit den durch diese Vereinigung auftretenden Widersprüchen fertig zu werden. Ein wenig erinnert das an die Quadratur des Kreises, jedenfalls müssen – soll dieses Unterfangen nicht zu einer Überforderung führen – zusätzliche Maßnahmen ergriffen werden; man kann Gruppe und Organisation nicht einfach additiv verbinden. Um Gruppen mit Erfolg in Organisationen zu verankern, muss man über ihre Vorteile, aber auch über ihre Grenzen Bescheid wissen, vor allem muss man auch wissen, unter welchen Bedingungen Gruppen „gedeihen“ und damit arbeitsfähig sind. Umgekehrt muss man sich mit Hierarchie bzw. Organisation besser auskennen und begreifen, wieso sie immer wieder „natürlicher Feind“ von Gruppen ist.
Menschheits- und individualgeschichtliche Bedingungen
Mehrere Millionen Jahre haben Menschen bzw. ihre Vorfahren in überschaubaren Kleingruppenformationen (Stämmen, Horden) ohne viel gegenseitige Berührung gelebt. Organisationen, Staaten, „Hochkulturen“ dagegen gibt es erst seit etwa 10.000 Jahren. Menschheitsgeschichtlich stehen einander also zwei sehr unterschiedliche Zeiträume an Verhaltensprägung gegenüber.
Der Zeitraum für die Entwicklung angemessener Verhaltensweisen für das Leben in Organisationen ist relativ kurz. Obwohl wir funktionale Notwendigkeiten einsehen können und auch über Organisationswissen verfügen, dürfte unser eigentliches, vor allem emotional bestimmtes Handeln und Verhalten noch weitgehend von den Prägungen der ersten, ausschließlich gruppenbezogenen Entwicklungsphase beeinflusst sein. Jedenfalls ist zu beobachten, dass wir in Kleingruppenformationen über eine stärker ausgeprägte Orientierungs- und Entscheidungssicherheit verfügen. Für Abstraktes sind wir evolutionär nicht ausgerüstet; um uns zu orientieren, brauchen wir die sinnliche Wahrnehmung. In Gruppen ist die Kommunikation von allen überschaubar, man agiert „Face to face“. Die Möglichkeit dazu ist an eine begrenzte Zahl von Teilnehmer*innen gebunden; wo mehr als 15 Teilnehmer*innen in einem Verband zusammen sind, kann man nicht mehr von Gruppe reden. Es ist zu beobachten, dass es spätestens ab dieser Größe zu Gruppenteilungen kommt oder ein hierarchisches System etabliert wird. In Organisationen dagegen wird indirekt, das heißt über Vermittlungsinstanzen, Zwischenträger, Relaisstationen kommuniziert – eine ständige Quelle von Verunsicherung für Personen und Fehlern in der Sache, aber auch die bisher einzige Möglichkeit, eine große Menge von Menschen für ein gemeinsames Ziel zu organisieren.
Hinzu kommt, dass in fast allen uns bekannten Organisationen das hierarchische System dominiert, weshalb wir die Begriffe Organisation und Hierarchie oft synonym gebrauchen können. Hierarchie verteilt die Kompetenzen derart, dass die Mehrheit der Menschen mit Organisationsaufgaben wenig zu tun bekommt; in agrarisch-feudalen Systemen kann deshalb die Kleingruppenstruktur ungefährdet fortgesetzt werden („Großfamilien“, die in Dorfgemeinschaften nebeneinander leben und erst ansatzweise Intergruppenverbindungen eingehen). Diese Situation ändert sich radikal mit der Macht der Städte und des Bürgertums sowie der „Ehe“ von Wirtschaft und Wissenschaft.
Individualgeschichtlich bietet sich ein ähnliches Bild. Unsere primäre Verhaltensbildung und Erziehung vollzieht sich wiederum in Kleingruppenformationen (Familie, Freundeskreis, Schulklasse, Sportverein etc.). Obwohl die Schule eigentlich die Aufgabe hätte, ins politisch-organisatorische Leben einzuführen, entzieht sie sich dieser Aufgabe und konkurriert mit den Eltern um familienähnliche Strukturen. Von institutioneller Erziehung ist weit und breit nichts zu sehen. Jugendliche treten in den „Ernst des Lebens“– und das heißt in die Wirklichkeit von Organisationen – erst ein, wenn ihre primäre, emotionale Verhaltensbildung schon weitgehend abgeschlossen ist. Der individualgeschichtliche Erwerb von Bewegungs- und Handlungssicherheiten in dieser ersten Lebensetappe bewirkt nun die Tendenz, auch das spätere Leben nach den emotionalen Mustern der Kindheit zu gestalten. Viele versuchen, Kleingruppenemotionen auf Organisationen zu übertragen – vom „Landesvater“ über die „Mutter Kirche“ bis hin zur „Freunderlwirtschaft“, die meist die Jugendbande ablöst. In einer anderen Lehrveranstaltung („Change Management“) wird noch näher auf die Gruppe eingegangen, diesmal steht die Hierarchie im Vordergrund.
Aufgabe 1
Bevor wir jedoch in die Hierarchie hinein blicken, eine kleine Reflexion über Gruppe: Setzen Sie sich in Ruhe hin und tauchen Sie in Gedanken in Ihre Vergangenheit ein: Welche Gruppen gab es in Ihrem Leben
...in der Kindheit,
...in der Ausbildungsphase,
...in den ersten Berufsjahren?
Welche Rolle spielten Sie in diesen Gruppen? Waren Sie eher ein Randmitglied, eher Rädelsführer und wie ist es Ihnen dabei ergangen?
Wie und warum haben sich diese Gruppen wieder aufgelöst? Und wenn es sie heute noch gibt: Was hat sie so stabil gemacht?
Laden Sie sich das Formular aus dem Forum herunter – es ist im Word-Format.
Schreiben Sie Ihre Überlegungen nieder (in dieses Formular), wandeln Sie es dann in ein PDF um und stellen Sie dieses ins Forum. Vielleicht ist es ja auch spannend, Ihre Lösung mit denen der anderen zu vergleichen...
Wie entstand eigentlich „Hierarchie“?
Unsere Vorfahren haben jahrmillionenlang in den warmen Zonen der Erde gelebt. Es ist eines der großen Rätsel, wieso wir nicht immer noch dort sind. Es ist nicht klar, was die Menschen bewogen hat, diese schönen, warmen Gegenden um den Äquator herum zu verlassen und in den kalten Norden zu ziehen, wo sie dann erst einmal den Eiszeiten entgegengingen und diese durchzustehen hatten.
Die warmen Zonen sind dadurch gekennzeichnet, dass alles rund um die Uhr wächst. Man kann in der Fauna gleichzeitig reife Früchte und Blüten sehen. Wenn man einen großen Mangobaum hat, fallen jeden Tag vier bis fünf Kilo herunter und man kann nicht mehr verhungern. Es ist daher z.B. ungeheuer schwer, den Menschen in Afrika Vorratswirtschaft beizubringen oder längerfristig zu planen, weil sie das nie gebraucht haben.
Mit der Zeit zogen die Menschen aus in den Norden und mussten Vorratswirtschaft betreiben. Es stellte sich hier zum ersten Mal die Frage: wie lassen sich Tiere, Fleisch, bevorraten? Die Antwort: am besten lebend erhalten. Dadurch war aber die Mobilität der Menschen sehr stark eingeschränkt und man ist heute der Meinung, dass der Ackerbau und die ersten Feldfrüchte z.B. Rüben für die Schweine waren.
Man musste zu diesem Zweck an einem bestimmten Ort bleiben und es entstand etwas ganz Neues und Interessantes, nämlich Überschuss. Ein Überschuss, der getauscht werden konnte. Bei Jägern und Sammlern entstand ja nie ein Überschuss, aber Viehzüchter und Ackerbauern, die Vorratswirtschaft betreiben, hatten Überschüsse, die sie tauschen und verkaufen konnten. Dieser Tausch hat nun einen zentralen Ort. Das ist 1958 von dem Urgeschichtler Dr. Walter Christaller entdeckt worden, der mit einem Piloten mit flog und sich beklagte, dass er in den Wüsten, wo man graben sollte, nichts fand. Der Pilot meinte, da müsse er nur ihn fragen, weil man von oben noch immer die alten Verkehrswege sehen könne. Es stellte sich heraus, dass an bestimmten Stellen mehrere Flüsse zusammen kommen oder Täler münden. Wien ist z. B. so ein zentraler Ort: man hat die Donau Ost-West, die Bernsteinstraße Nord-Süd. Dort haben sich die Menschen immer schon getroffen, es entstanden an solchen zentralen Orten Marktflecken und verschiedene Dörfer. In jedem der Dörfer war man auf etwas anderes spezialisiert, obwohl es generell einen hohen Grad der Generalisierung gab. Bauern konnten sich selbst ihre Kleidung erzeugen und ihre Werkzeuge herstellen. Und doch zeichneten sich Unterschiede ab, denn nicht überall wuchs alles gleich gut und nicht überall gab es für jede Art von Vieh die idealen Bedingungen, ganz abgesehen davon, dass spezielle Ressourcen (man denke nur an das Salz in Hallstadt, das Bernstein an den Küsten etc.) sowieso nicht überall in gleichem Ausmaß vorhanden waren.
Mit der Zeit wuchs die Spezialisierung und somit auch der Trend, etwas zu tauschen.
Dort haben die Menschen etwas erfunden, was es bis dahin nie gegeben hat und wofür für uns auch kein Verhaltensmuster aus Jahrtausenden Stammesgeschichte bekannt ist: wir nennen es indirekte oder anonyme Kommunikation.
Wie entstand die indirekte Kommunikation zwischen den einzelnen Stämmen?
Die Menschen haben hier miteinander getauscht: Schweine, Schafe, Hunde, und zwar ohne sich dabei alle zu treffen. Sie hatten sozusagen miteinander zu tun gehabt, ohne sich direkt zu treffen. Dafür war es notwendig, den Horizont über das Stammesdenken hinaus zu entwickeln: Feind ist nicht nur der, der dem anderen Stamm angehört und Freund nicht nur der, der dem eigenen Stamm angehört. Hier musste unterschieden werden: Freunde können auch Handelspartner sein, die man überhaupt nicht kennt.
Um den reibungslosen Ablauf dieses Handels zu gewährleisten, entstanden dann Repräsentationssysteme: Akkumulationen von Macht und Verwaltung.
Das hat verschiedene Gründe, einer davon ist, dass es allgemein ein Problem von Organisationen ist, wie Entscheidungen zustande kommen, wenn man nicht in einer Gruppe zusammensitzt und diskutiert.
Die Repräsentationssysteme entstanden, als diese Bereich immer größer und größer wurden - es gab blühenden Handel, der Boden war auch sehr fruchtbar, die Zentren waren relativ weit verstreut, in Mesopotamien, am gelben Fluss, in Indien und auch in Europa.
Im Laufe dieser Entwicklung ist jedoch einiges passiert. Wenn wir heute an diesen Stellen graben, stellen wir fest, dass da eine dicke Kulturschichte ist, und darunter ist wieder eine andere Kulturschichte, dann kommt Sand, dann wieder eine Kulturschichte. Am Euphrat, bei einer Ausgrabung, fand man z.B. 22 Schichten. Die Kulturen sind aus vorerst unerklärlichen Gründen zugrunde gegangen: 300 Jahre waren besiedelt, 200 Jahre nicht, 400 Jahre besiedelt, 150 Jahre nicht. In Indien, Mexiko, Europa, etc.
Hier stellt sich die Frage: warum sind nun diese Kulturen entstanden und wieder zugrunde gegangen? Dazu muss noch erwähnt werden, dass diese Schichten nichts miteinander zu tun haben und es eines der großen Rätsel war, dass man in der tieferen Schichte oftmals eine höhere Kultur gefunden hat als in der oberen.
Es gibt dafür aber eine einleuchtende Erklärung: nicht alle Stämme werden gleichzeitig sesshaft, sondern „draußen“ gibt es noch Jäger, die sehr bald merkten, dass es einfach praktisch ist, die Dörfer zu überfallen, und zwar am besten nach der Ernte. Aufgrund der besseren Kampfkraft nahm man den Ackerbauern alles weg, brachte sie um, konnte eine Weile ganz gut davon leben und zog dann weiter zum nächsten Dorf.
Irgendwann einmal brach dieses Gebiet zusammen: die Bauern konnten sich ja nicht mehr verteidigen, denn die hatten längst die Schwerter zu Pflugscharen umgeschmiedet. Diese Gebiete sind durch tausende kleiner Überfälle immer wieder zugrunde gegangen, und wir wissen erst von denjenigen, die schon eine gewisse Größe erreicht hatten, denn vorher fielen sie im weiten Mesopotamien nicht auf.
Warum wurden Hierarchien entwickelt?
Am längsten haben sich die kleinen Ackerbaukulturen in den Flussoasen am Nil erhalten. Dort hatten sie ursprünglich auch keine Stadtmauern und diese ersten Kulturen waren mutterrechtliche Kulturen. Dort haben die Frauen dominiert, weil bei Ackerbau und Viehzucht die „Erzeugung“ von Kindern wichtig war als Aufrechterhaltung der Produktionskraft, während die Kinder bei den Jägern Kostenfaktoren sind: sie werden erst mit 15 oder 16 Jahren produktiv und dann wiederum nur die Männer.
Gegen Übervölkerung sind Jäger sehr sensibel, weil sie nicht so viele Menschen ernähren können: bei den Ackerbauern und Viehzüchter können schon kleine Kinder mit vier, fünf Jahren auf Tiere aufpassen und mehr Tiere hüten, als sie selber essen können. Diese ersten Kulturen waren also mutterrechtlicher Art und von Frauen dominiert und konnten sich auch noch nicht gut verteidigen. Sie wurden groß durch Handel und Austausch und entwickelten eine sehr starke Kultur, allerdings selten eine Schrift.
Dieses Gesellschaftsspiel - groß werden und wieder zugrunde gehen - ist einige Jahrtausende gespielt worden - bis die Menschen Hierarchien entwickelt haben. Dies ist möglicherweise die größte Erfindung in der menschlichen Geschichte. Alle anderen Erfindungen sind erst in Folge entstanden.
Wie sahen diese Hierarchien aus?
Wenn man die idealtypische Form einer Hierarchie graphisch darstellen möchte, so sieht dies folgendermaßen aus:
Diese Form wurde symbolisch manifest: die Pyramiden waren ursprünglich Stufenpyramiden, auf die man die Tiere treiben und Vorräte speichern konnte. Sie waren auf Sichtweite gebaut: bei einer war Militär stationiert und wenn Jäger angriffen, konnte diese wichtige Information mit Rauchzeichen weitergegeben werden.
Damit dieses System funktionierte, mussten allerdings einige Prinzipien eingeführt werden.
Diese Prinzipien sind auch heute noch bekannt:
1.) Das wichtigste Prinzip: die Entscheidungen sind bisher beim Tausch der Viehzüchter lokal getroffen worden, jetzt muss die Entscheidung zentral getroffen werden, d.h. wir haben hier eine
Entscheidungszentralisierung.
Wenn die Jäger an verschiedenen Stellen angreifen, muss entschieden werden, was aufgegeben oder verteidigt wird.
2.) Damit aber die richtigen Entscheidungen getroffen werden können, müssen die Informationen an einem Ort zusammenkommen. Die Menschen, bei denen dies geschah, nannte man „Priester“. Der eine Priester weiß, was da los ist und dort los ist, und der andere Priester weiß wiederum, was woanders los ist, und der einzige, der alles weiß, ist der „Pharao“.
Pharao heißt wörtlich übersetzt Herr der Geheimnisse“.
Wir haben also zweitens eine
Wahrheits- oder Informationszentralisierung.
3.) Drittens stellt sich immer dort, wo Menschen miteinander Geschäfte abwickeln, die Frage: wer streitet mit wem immer am meisten, wo gibt es die meisten Konflikte? Zwischen Nachbarn. Und hier in diesem System gibt es erstmals die Möglichkeit, dass Nachbarn miteinander kooperieren, auch wenn sie miteinander streiten: nämlich über eine dritte Person oder über ein Zentrum.
D.h., wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte. Dieses System hat erstmals die Möglichkeit, Kooperationen herbeizuführen, ohne dass man tatsächlich miteinander konkurrieren muss. Man konnte jetzt auch Konkurrent sein, ohne einander dabei umzubringen.
Zu diesem Zweck hat das Zentrum die
Weisheitszentralisierung
Der weise König Salomon ist hier ein historisches Vorbild.
4.) Der vierte Punkt ist der wichtigste: wenn man sich die machtökonomischen Verhältnisse ansieht, so waren die ursprünglich Besitzenden die Bauern und die Dörfer, kurz gesagt: die Produzenten. Hier stellt sich die entscheidende Frage: wovon lebten die im Zentrum? Die Antwort lautet: vom Handel. Sie haben dem einen ein bisschen weniger gegeben als es wert war, vom anderen ein bisschen mehr genommen, als es wert war, und von der Differenz lebten sie. Bei den alten Griechen lässt sich das in ihren Göttern entdecken: Hermes war gleichzeitig der Gott der Kaufleute und der Diebe. Damit lebten sie nicht schlecht, aber große Sprünge waren nicht möglich. Neue Probleme traten auf: man musste Soldaten haben, man musste eine Armee aufstellen, dazu brauchte man eine Rüstungsindustrie sowie eine Infrastruktur Man musste die Rauchzeichen verstehen können, man musste eine Schrift erfinden und wenn man Bauern, Krieger und Priester hat, so braucht man Beamte, die das koordinieren. Und all die hier aufgezählten, die Krieger, die Priester, die Beamten, die produzieren nichts, die essen nur: sie stellen den so genannten nichtproduktiven Teil des Systems dar. Dieser Pharao hat nun chronisch zu wenig, denn was er abschöpfte, war nicht proportional zur Entwicklungsgeschwindigkeit des Systems. Und diese Entwicklungsgeschwindigkeit des Systems war über 10 bis 15-tausend Jahre zu langsam. Da waren die Jäger schneller und die Kultur ging zugrunde.
Irgendwann hatte der Pharao nun zu wenige Kühe für seine Beamten, Krieger und Priester und forderte von den Bauern mehr. Sobald diese sich aber weigerten, ihm mehr zu geben, hatte er nur eine Möglichkeit, das System aufrechtzuerhalten: er schickte seine Soldaten, um von den Bauern mehr herauszuholen.
Und dann war es nur ein kurzer Lernprozess in der Geschichte, dass der Pharao begriff: wenn er es sich aussuchen konnte, wie viel er ihnen wegnehmen konnte, so nahm er sich alles bis auf das Existenzminimum. Im Gegenteil, wenn die Bauern das Saatgut aufaßen, so musste der zentrale Tempel sogar mit Saatgut aushelfen, sonst gab es nächstes Jahr keinen Tribut mehr.
Es gab da also Zentren mit am Minimum lebenden Bauern, die jedoch überlebt haben. Brutaler formuliert: diejenigen, die mit zentraler Gewalt Militär auch gegen ihre eigenen Leute einsetzten, hatten in der Geschichte größere Überlebenschancen als diejenigen, die den Bauern freie Wahl über die Höhe ihres Tributs ließen.
Es musste also ein System gefunden werden, in dem Menschen Entscheidungen treffen über andere, d.h. wir haben hier eine Machtzentralisierung.
Das bedeutet, Entscheidungen treffen über andere, ohne deren Zustimmung einzuholen. Dieses System wurde dann von Hamurabi „Umradash“ genannt. Das heißt auf deutsch: heilige Ordnung. Und auf griechisch: „Hierarchie“. „Hieros“ heißt heilig und „Arché“ heißt Ordnung, auch Prinzip, Anfang oder Macht. Hamurabi zeichnete das auf und nahm als Symbol die Pyramide. Die Pagoden sind übrigens Reste dieser Pyramiden, das Zentrum ist oben in der Spitze. Jetzt sieht man, wieso diese Pyramide Symbol für dieses Modell wurde, das man beliebig groß zeichnen kann:
Das Prinzip „Herrschaft“ heißt, dass die Menschen eingeteilt werden in Obertanen und Untertanen. Das war eine große Wende in der Geschichte. Die Männer sind damit an die Macht gekommen - die mutterrechtlichen Kulturen waren nicht in der Lage, sich zu verteidigen. Wir finden nur dort Reste von mutterrechtlichen Kulturen, wo keine Verteidigungsnotwendigkeit bestand, z.B. in Kreta hatten die Paläste, abgesehen davon, dass es zum Teil Totenpaläste waren, keine Mauern. In Troja aber gab es zyklopische Mauern, sie hatten Militär und mit dem Militär übernahmen die Männer die Macht und gleichzeitig gab es die Unterteilung in Obertanen und Untertanen. Und diese Einteilung der Menschen in Obertanen und Untertanen war sozusagen der Preis, der für das Überleben des Systems gezahlt wurde.
Solange das System auf Freiwilligkeit beruhte, funktionierte es nicht lang genug. Erst als es im Zwang durchgeführt wurde, funktionierte es. Besonders wichtig war das im alten Ägypten, von dort ist es auch schriftlich überliefert, da hatte man ein sehr komplexes System für die Zeit, in der die Nilschwemme kam; erstens musste man ja wissen, wann sie kam, dann mussten ganz genaue Richtlinien ausgegeben werden, wer wann wo welche Schleuse geöffnet hat, damit das Wasser richtig umgeleitet werden konnte. Da hatte es überhaupt keine Sinn, zu diskutieren, hier musste ein starkes, straffes System geschaffen werden, mit militärischer Verteidigung und mit glasklarer Organisation, die nach dem Prinzip vorgeht: Informationen im Zentrum, alle Macht im Zentrum, alle Entscheidungen im Zentrum, alle Konflikte nach oben delegiert, d.h. streiten gibt es nicht mehr: wenn zwei streiten, dann dürfen sie eigentlich nicht mehr streiten, sondern ihr Chef soll entscheiden.
Dieses System ist also unter dem Namen Hierarchie in die Geschichte eingegangen und hat sich jetzt ca. fünf- bis zehntausend Jahre bewährt. Der genaue Zeitpunkt der Erfindung ist nicht bekannt, wir wissen nur, dass es das schon vor fünftausend Jahren in Ägypten gegeben hat. Diese vier Prinzipien und dieses System gibt es bis heute in allen uns bekannten „zivilisierten Gesellschaften“: in Wirtschaftsunternehmen, beim Militär, an den Universitäten und in jeder Form der Verwaltung. Es ist egal, welche Organisation man betrachtet, überall findet man die Symbole der Hierarchie: die Kirche ist ein gutes Beispiel: seine Heiligkeit der Papst hat eine große Krone, dann haben wir die Landesfürsten, die haben eine Zacke weniger in der Krone, in Folge gibt es den Adel - hier die Kardinäle, die Excellenzen, die Bischöfe, dann den Mittelbau, das geht vom Generalvikar zum Hilfskaplan und ganz unten in jedem System die Sklaven, das sind in der katholischen Kirche die Laien, „laos“, das Volk.
Man kann auch die Universität nehmen: da gibt es Rektor*in, Magnifizenz, Spektabilität, die Dekane der Fakultäten, dann kommen die Ordinarien, dann ist der Adel zu Ende, dann geht es los mit den Privatdozent*innen, dann die wissenschaftlichen Hilfsassistent*innen, die Rolle der Sklaven haben dort die Student*innen.
Man kann das gleiche natürlich auch in einem Wirtschaftsunternehmen beobachten: der*die Vorstandsvorsitzende, Generaldirektor*in, Vorstandsdirektor*innen, dann kommen die Bereichsleiter*innen, dann hört der Adel auf, dann geht es von dem*der einfachen Abteilungsleiter*in zum*zur einfachen Arbeiter*in, der*die hat den Sklavenstatus in der Wirtschaft. In diesem System haben Sie auch die Superpositionsrituale, d.h. je höher sie hinaufkommen, desto gescheiter werden die Leute, desto mächtiger werden die Leute und umso wichtigere Entscheidungen treffen sie. Oben gibt es Allmacht, also Allwissenheit, Allmächtigkeit, Allgegenwart. Je weiter runter man kommt, desto blöder werden die Leute, desto weniger wissen Sie und unten ist Impotenz. Wer unten sitzt, der weiß nichts, der kann nichts, je weiter man hinaufkommt, desto mehr kriegt man bezahlt, weil desto wichtigere Tätigkeiten führt man aus, desto größer ist das Büro, desto grüner sind die Zimmerpflanzen und desto hübscher ist der*die Sekretär*in. Man findet hier sehr strenge Reglementierungen. Das ist das Prinzip der heiligen Ordnung, der Hierarchie.
Wann gibt es Schwierigkeiten?
Heute stehen wir vor dem Problem, dass dieses System erstmals in der Geschichte in eine Krise gekommen ist. Wir müssen uns heute nach Alternativen umsehen, eine Tatsache dabei aber unbedingt im Auge behalten: es wird nicht möglich sein, die Hierarchie abzuschaffen. Die Versuche, alle Menschen über alle Probleme entscheiden zu lassen, funktionieren nicht. Hierarchie ist nämlich gleichzeitig ein System der Arbeitsteilung. Arbeitsteilung gab es zwischen denen, die Kühe und denen die Schafe erzeugt haben, und Bananen und Datteln, und Arbeitsteilung gab es auch zwischen denen, die produziert haben und denen, die zentralistisch koordiniert haben. Es gibt zwei Formen von Arbeitsteilung, nämlich vertikal und horizontal. Diese beiden Formen von Arbeitsteilung müssen erhalten bleiben. Den Unterschied zwischen peripheren und zentralen Positionen und den Unterschied zwischen peripheren Positionen untereinander kann man nicht überwinden.
Die zweite Frage, die wir stellen müssen, ist, ob dieses Obertanen- und Untertanen-Verhältnis heute noch ist. D.h., ob es tatsächlich notwendig ist, Entscheidungen zu treffen, ohne die Meinung der Betroffenen einzuholen. Man hat beobachtet, dass sich heute in manchen Punkten die hierarchischen Prinzipien umkehren, dass sie einfach nicht mehr stimmen: wenn Sie ein*e EDV-Spezialist*in einstellen, dann kann es sein, dass der*die mehr von Computern versteht als sein*e Chef*in. Jetzt haben wir folgendes Problem: wenn die beiden sich streiten, dann hat der eine von der Sache her recht, der andere vom System her.
Konflikte zwischen Obertan*innen und Untertan*innen sind in dem System jedoch streng geregelt: wenn der*die Chef*in mit einem*einer Mitarbeiter*in streitet, haben grundsätzlich die Obertanen*innen recht, sie haben mehr Macht, haben mehr Weisheit, sie müssen die Entscheidungen treffen. Damit seine*ihre Entscheidungen nach unten auch durchgeführt werden, wird ein Verhältnis der Abhängigkeit installiert, da man sonst zentral getroffene Entscheidungen nicht durchführen kann.
Was passiert bei sehr großen Unternehmen (=Systemen)?
Es kann folgendes Problem auftreten: wenn das System halbwegs komplex ist und es passiert etwas, dann erzählt es der eine dem, aber nicht dem anderen und der erzählt das dem und nicht einem dritten, usw. Jetzt hat der Oberste nur einen gewissen Prozentsatz an Informationen z.B. für eine Ankaufsentscheidung oder eine Neustrukturierung. Wenn er jetzt eine Gegenmaßnahme ergreift, dann sickert die auf demselben Weg hinunter und kein Mensch dort unten erkennt mehr, dass das eine Gegenmaßnahme ist.
Die folgende Graphik zeigt so einen Fall:
Noch andere Punkte können hinzukommen: nicht nur die Fachexpertise, die z.B. bei allen verkaufsintensiven Organisationen sehr stark an der Peripherie ist, der Kundenkontakt, aber auch technisches Fachwissen sind oft nicht mehr zentralisierbar.
Wir erleben heute, dass diese Wahrheitszentralisierung überhaupt nicht möglich ist. So erzählt ein Berater aus seiner Erinnerung:
Ein Beispiel ist die Geschichte von Siemens, als sie einen zentralen Computer für die Bundespost machen wollten. Der Vorstand setzte eine Gruppe ein, die das bearbeiten sollte. Einer der Ingenieure sagte, ein zentraler Computer sei ein Blödsinn, man mache das heute mit Mikroprozessoren, dezentral vernetzt. Die sind zunächst einmal rausgeschmissen worden, weil der Abteilungsleiter sich nicht getraut hat, seinem Chef zu sagen, dass der Vorstand eine blöde Entscheidung getroffen hat. „Euer Problem ist, zu arbeiten und nicht, den Vorstand zu kritisieren.“ Nach einer Weile kamen sie aber darauf, dass es mit dem zentralen Computer nicht funktioniert, dann ist es in einer zweiten Welle zum Bereichsleiter gekommen, dort wurde es auch abgeblockt, weil der sich auch nicht traute, dem Vorstand zu sagen, dass sie blöd sind. In der dritten Welle, da waren schon fünfhundert Millionen verbraten, kam es auf Vorstandsebene. Und da ist es interessant, wie die reagierten. Dort saßen natürlich keine Fachleute, die hatten keine Ahnung, was Mikroprozessoren sind. Irgendeiner hatte mal vor vierzig Jahren Elektronik studiert, ist natürlich längst Politiker geworden, die sagten, wir haben jetzt schon fünfhundert Millionen Mark hineingesteckt, die wären alle verloren, wenn wir das jetzt abbrechen: „also weitermachen.“ Außerdem sagte noch der zuständige Verkaufsleiter, sie müssten auf jeden Fall weitermachen, weil da wäre noch mehr daran angeschlossen, nicht nur die Bundesrepublik, sondern 16 Länder wollten den zentralen Telefoncomputer kaufen, sobald er fertig ist, und die würde man alle verlieren. Daraufhin wurde weitergemacht, es ging aber nicht, weil es wirklich eine Fehlentscheidung war. Zum Schluss standen an die sechs Milliarden unterm Strich. Dann hat man natürlich den Vorstand entfernt, aber das nützt ja nichts, das Geld ist trotzdem im Eimer. Das Beispiel zeigt, dass es in großen Organisationen häufig das Problem gibt, dass sich im Mittelbereich Expertise ansammelt, die nicht mehr zentralisierbar ist und die oft durch die vielen Barrieren nicht mehr in die Entscheidungen bei den zentralen Funktionären mit einfließen kann. Ganz oben hat man nicht mehr die Möglichkeit, die richtigen Entscheidungen zu treffen, es sei denn, per Losentscheid oder durch eventuelle Zufallsinformationen Ein weiteres Problem kommt noch dazu, sobald das System eine bestimmte Komplexität erreicht hat: im klassischen System, weil ja der*die Chef*in immer gescheiter sein muss als seine*ihre Mitarbeiter*innen, und dessen*deren Chef*in noch gescheiter, gibt es Beförderungen nach dem Leistungsprinzip. Auch dieses Prinzip gerät ins Wanken, wenn folgendes passiert:
Wenn man den besten Feinmechaniker zum Werkmeister einer Abteilung macht, dann muss er jetzt Arbeit einteilen, Streit schlichten, Raumpfleger einteilen, was er noch nie in seinem Leben getan hat. Lauter Sachen, die er nie gelernt hat und auch nicht kann. Und jetzt sagen alle, das ist ein miserabler Werkmeister. Er wäre gut, um Differentiale zusammenzusetzen, aber das darf er ja jetzt nicht mehr tun. Ein weiteres Beispiel: der beste Lehrer in der Schule wird Direktor. Jetzt hat er nicht mehr mit Schülern zu tun, sondern mit Lehrern. Und jetzt muss er mal probieren, Lehrer so zu behandeln, wie die Schüler. Entweder ist er ein guter Direktor, dann kommt er ins Ministerium, jetzt hat er weder mir Schülern noch mit Lehrern zu tun, sondern mit Akten. Wieder eine andere Aufgabe. Ist er gut, avanciert er, ist er blöd, bleibt er den Rest seines Lebens in diesem Job. Wenn er dann ein gewisses Maß erreicht hat, er ist z.B. Ministerialrat und zu blöd für den Job, dann ist nichts mehr zu machen. Wenn etwas passiert und er weg muss von dem Job, dann kann er natürlich nur mehr nach oben fallen, er wird Sektionschef. Das Beispiel zeigt, dass heute das Arrangement nach dem Leistungsprinzip in Hierarchien oft nicht mehr funktioniert. Noch eine weitere Schwierigkeit kommt dazu, die den Kommunikationsfluss und die Atmosphäre im System negativ beeinflussen kann: der*die Chef*in spricht mit den einzelnen Untergebenen gerne allein, im „Kammerl“ sozusagen. Da alle Entscheidungen und alles Wissen bei ihm zusammenlaufen, kann er sich aussuchen, wem er was erzählt.
Das ist ein nicht unerheblicher Machtfaktor, der sich graphisch so darstellen lässt:
Dadurch, dass der*die Chef seine Untertanen voneinander abschirmt, schafft er*sie Barrieren, die er*sie zur besseren Vergatterung aller ihm*ihr Untergebenen verwenden kann. Er*sie streut er die Saat des Misstrauens, so dass sich die Untertan*innen nicht gegen ihn verbünden - was ihnen sonst ja leicht fallen würde, da sie sich auf einer Hierarchieebene befinden und so direkt mit einander zu tun haben Dieses wohlgehütete Maß an Misstrauen zwischen den Untertan*innen gibt es in den meisten Hierarchien, es ist für den*die Chef*in sehr wichtig, weil dann die Kommunikation immer über ihn*sie geht, dadurch wird er*sie wichtig.
Bei den Untertan*innen kann das dazu führen, dass sie dem*der Oberen immer nur das erzählen, was er*sie gerade hören will, denn das verschafft ihnen eine gute Position im Wettkampf, dem*der Chef*in zu gefallen.
Solche Mitarbeiter*innen reden untereinander nur über das Wetter und spezialisieren sich alle darauf, dem*der Chef*in zu sagen, was er*sie gerne hört.
Das ist natürlich dann kontraproduktiv, wenn der*die Chef*in auf gute und ausreichende Information über das angewiesen ist, was unter ihm*ihr vorgeht, also meistens. Das folgende Beispiel soll dieses Problem verdeutlichen:
Im deutschen Bundesumweltamt sollte eine so genannte „Schadstoffschnellauskunft“ eingerichtet werden. Da hatte einer die gute Idee, dass es ungefähr tausend Schadstoffe - gefährliche Stoffe in großen Mengen - gibt. Da war es bisher so, dass durch den Einsatz der Feuerwehr oft ein großer Schaden entstanden ist, weil, die nicht wussten, um welchen Stoff es sich handelte: Sie löschten mit Wasser, wenn Sand besser gewesen wäre und umgekehrt. Die Idee war: machen wir einen Computer in jedem Polizeiauto oder jeder Feuerwehrstelle, dort geben wir die Daten ein, - es ist gelb, stinkt usw., Telefonnummer und dann gibt der Chemiker Auskunft - kurz und gut: Schadstoffschnellauskunft am Bundesumweltamt Berlin. Das wäre eine wunderbare Idee gewesen, wenn es funktioniert hätte. Der Bundesminister ordnete an, dass dies installiert werden sollte, aber der Computer funktionierte nicht, da die Programme zu kompliziert waren. Dies wurde dem Führungsgremium mitgeteilt, welches aber beschloss, das nicht weiterzugeben und meinte, es müsse trotzdem gebaut werden. Und sie gaben nach oben weiter, das Projekt würde funktionieren. Daraufhin erklärte der Minister bei der EG: wir können das. Daraufhin führte auch die EG das überall ein. Und jetzt erst kam man darauf: es geht nicht.
Ein klassischer Fall, wo die Hierarchie nicht wusste, was los ist. Niemand traute sich, die Wahrheit zu sagen. Es geht heute viel Zeit und Geld verloren, weil die Hierarchien nicht mehr funktionieren. In diesem Fall war es wiederum auch das Problem des mangelnden Feed-back. Feed-back gibt es in der Hierarchie nur von dem*der Obertan*in zum*zur Untertan*in, der*die sagt dem*der einen alles, was er*sie sich denkt, aber nicht zurück, was aber viel wichtiger wäre. Dieses Feed-back gibt es in Hierarchien nicht, bzw. nur sehr eingeschränkt oder unter hohem Risiko. Die Folge ist letztendlich die, dass alle Errungenschaften der Hierarchie nicht mehr stimmen: die Wahrheitszentralisierung, die Weisheitszentralisierung, daher auch nicht mehr die Entscheidungszentralisierung und weil blöde Entscheidungen getroffen werden, stimmt auch die Machtzentralisierung nicht mehr.
Man sagt nicht bei einer Entscheidung, sie wäre ein Blödsinn, sondern merkt das erst im Zuge der Durchführung. Da kann dem*der einzelnen auf seinem Posten nichts mehr passieren, denn er*sie hat ja Dienst nach Vorschrift ausgeführt.
Das ist ein gefährliches Phänomen in modernen Hierarchien. Das führt zu einem weiteren Problem: Es ist heute in den Hierarchien ein großes Maß an Widerstandspotential bei den Untertanen vorhanden, da sich die Probleme auf das Individuum auswirken: man lässt den*die Chef*in einfahren, man lässt einen ganzen Bereich einfahren, gibt falsche Informationen und die oben wissen überhaupt nicht mehr, was unten los ist. Und wenn sie doch einmal etwas entscheiden, wird es sabotiert. Es geht hier wahnsinnig viel Geld verloren, weil es in der Hierarchie versickert. Dies gilt genauso für die Deutsche Bank wie auch für das sowjetische Staatssystem oder die kleine Gemeindeverwaltung.
Es gilt hier aber: je größer und komplizierter das System, umso gehäufter treten die oben besprochenen Probleme auf.
Was kann man gegen die Probleme tun?
Es kann nicht das Ziel sein, die Hierarchie abzuschaffen, sondern Methoden und Strategien zu entwickeln, sie über Verbesserungen und Infragestellen wieder arbeitsfähig zu machen.
Ein dahingehender Ansatz wurde in der Gruppendynamik entwickelt: Das ist der Versuch, im kleinen Kreis dieses Herrschaftsprinzip außer Kraft zu setzen. Herrschaft heißt, dass die Menschen eigentlich nicht als Menschen genommen werden, sondern als Mittel, was sie natürlich auch sind. Man kann nicht wirtschaften, wenn man die Menschen nicht als Mittel einsetzt. Dies geschieht in Hierarchien jedoch ohne deren Zustimmung.
Wir können an dieser Stelle die Formel aufstellen:
Die Sozialstruktur funktioniert umso besser, je höher der Zustimmungsgrad der Mitglieder ist. Wenn es gelingt, die Leute dazu zu bringen, dass sie die Arbeit gern machen, dass sie sie freiwillig machen, dass sie Informationen hergeben, so nennt man das Motivation“. Informationen hergeben ist eine Sache des Vertrauens. Das erste Zeichen des Misstrauens ist der Entzug von Informationen. Wenn der*die Unternehmer*in sagt: bei uns sind das Problem die Informationen, keine*r sagt dem*der anderen etwas - dann weiß man, dort gibt es Misstrauen und keine Anerkennung.
Zustimmung oder Vertrauen gibt es jedoch nur im Zustand der Interdependenz. Wenn man konterdependent ist, zweifelt man, ob der*die Chef*in überhaupt Recht hat. Dependenz ist auch kein Vertrauen, sie ist sozusagen blinde Abhängigkeit, wobei hier das große Problem ist: Dependenz hat einen Sinn bei Kindern - ein hierarchisches System besteht darin, dass erwachsene Menschen zu Kindern gemacht werden. Das Muster zwischen Chef*in und Mitarbeiter*innen ist das zwischen Eltern und Kindern. Denn nur dort ist es ja richtig, dass der Vater alles weiß und entscheidet und das Kind alles tun muss.
Im Betrieb ist es nicht im Sinn des Systems, dass der*die Kreditfachmann*frau einer Bank sich von der Geschäftsleitung sagen lassen muss, was er*sie zu tun hat, denn der versteht ja viel mehr von der Sache.
Hier funktioniert das klassische, hierarchische Prinzip nicht mehr und wir brauchen daher neue Modelle. Neue Modelle bedeutet, dass diejenigen, die zusammenarbeiten müssen und unterschiedliche Expertisen haben, zueinander in einem interdependenten Verhältnis stehen.
Wie sieht die moderne Hierarchie der Zukunft aus?
Wir nehmen einmal an, ein Unternehmen besteht aus verschiedenen Gruppen. Diese Gruppen müssen eine Leistung erbringen. Es gibt nur noch ganz wenige Leistungen - sowohl im Produktionsbetrieb, als auch im Dienstleistungsbetrieb - die ein*e Einzelne*r noch machen kann.
Das ist heute eine Sache eines Teams, so wie auch vor Ort in der Produktion Qualität eine Sache des Teams ist.
Das sind Entscheidungen, die von mehreren getroffen werden müssen - so kann für eine komplexe Aufgabe (es gibt heute fast nur mehr komplexe Aufgaben im Bereich größerer Organisationen) die notwendige Mindestmenge an Kompetenz, Information und Wissen in die Entscheidung einfließen.
Die Teams herzustellen, ist jetzt Aufgabe des*der Vorgesetzten. Die neue Führungskraft des nächsten Jahrhunderts wird nicht mehr eine sein, die alles weiß und Entscheidungen trifft, das geht gar nicht mehr, sondern eine, die über die Instrumente verfügt, die notwendig sind, um in Gruppen so zu intervenieren, dass die Gruppen ihre Arbeit tun können.
Der „Hauptjob“ für eine*n Vorgesetzten wird sein, Gruppendynamik zu betreiben, also Gruppenprozesse richtig zu diagnostizieren und richtig zu steuern, und nicht mehr richtige Entscheidungen zu treffen. Das geht gar nicht mehr, weil heute Entscheidungen so stark vernetzt sind.
Wenn man heute ein*e gute*r Motorenspezialist*in oder ein*e gute*r Thermodynamiker*in ist, so befähigt das überhaupt nicht mehr, eine Abteilung zu führen, weil da sind noch Personalfragen, Finanzfragen, Repräsentationspflichten u.s.w. Hier müssen vor Ort Gruppen gebildet werden und diese Gruppen müssen reif sein, d.h. ein interdependentes Verhältnis haben.
Ein Gruppe funktionsfähig zu machen, ist keine leichte Aufgabe und erfordert außerdem noch eine Menge Zeit: die Gruppe muss zueinander finden, Abhängigkeiten, Sympathien und Widerstände bearbeiten, bevor sie arbeitsfähig wird.
Diese Gruppen entsenden jetzt bestimmte Repräsentanten in Führungsgremien. Hier sind die Gruppen vertreten. Und hier gilt dann genau dasselbe: Der Personalbereich eines größeren Unternehmens ist z.B. so ein Führungsgremium, in dem die Interessen der Gruppen vertreten werden.
In jedem Fall ist es so, dass die Zeit, die eine Gruppe braucht, um sich einzuarbeiten und gruppeninterne Prozesse und Mechanismen zu entwickeln, die ihr eine Erfolg versprechende Arbeitsbasis verschaffen, nie verlorene Zeit ist. Die Potenz, die in einer gut funktionierenden Gruppe vorhanden ist, ist genau diejenige, die die Hierarchie verloren hat.
Hier gibt es jetzt einen anderen Nachteil: Gruppen können ein Eigenleben entwickeln und versuchen, sich dann von Hierarchien nichts mehr dreinreden lassen. Um das zu verhindern, müssen entsprechende Mittel entwickelt werden. Eine Möglichkeit besteht darin, die einzelnen Führungsgremien in einem Führungskreis zu koordinieren. Dort muss es ein ausgewogenes Verhältnis zwischen denen geben, die zentral den Willen der Peripherie repräsentieren: die müssen ihre Interessen dort wieder finden, das Gefühl haben, dort sind die Leute, die das, was ich will, repräsentieren: als Motorbauer*in, als Verkäufer*in, als Qualitätssicherer*in, als Kreditmann*frau. Umgekehrt müssen die an der Peripherie das, was zentral beschlossen wird, auch durchführen.
Ein spannendes Modell finden Sie in der nächsten Lektion: die Soziokratie.
Was bleibt zu tun?
Die Hierarchie, so könnte man es heute formulieren, leidet unter Verstopfung. Es geht nur von oben nach unten - oft nicht einmal mehr das - es geht aber nicht von unten nach oben. Hier müsste es in den neuen Systemen einen Austausch der Willensbildung von unten und oben oder zwischen zentral und peripher geben.
Hier muss man entflechten: man wird andere Prinzipien der Arbeitsteilung und auch der Leistungsmessung und -zuweisung finden müssen, es wird auch der Run auf die zentralen Positionen wegfallen, weil die nicht mehr so erstrebenswert sind. Die Mittel, um in neuen Systemen, in denen Gruppen ihren Platz haben, arbeiten zu können, sind Analyse von Prozessen, also Diagnose sowie Intervention. Diese Prozesse und Analysen müssen, damit sie erfolgreich sein können, im System selbst stattfinden, d.h. sie dürfen nicht von außen angesetzt werden und müssen außerdem ständig weiterentwickelt werden. Man kann nicht unabhängig von den Betroffenen eine Diagnose stellen. Es ist dieses Wissen über Gruppenprozesse auch nicht mehr zentralisierbar, man kann die Methoden der Hierarchie hier nicht mehr anwenden. Es ist nicht mehr so, dass der*die Oberste am besten versteht, was in der Gruppe los ist, sondern am besten verstehen das die Betroffenen selber und mit denen muss man das bearbeiten.
Das heißt, man muss Erkenntnisse rückkoppeln und dann gemeinsam entscheiden.
Details zu diesem Themenkreis finden Sie in:
Gerhard Schwarz, „Die Heilige Ordnung der Männer“, VS-Verlag, 5. Auflage Dieses Papier wurde anhand einer Mitschrift eines Vortrages über Hierarchie und Organisation von Univ.Doz. Dr. Gerhard Schwarz anlässlich eines Gruppendynamikkurses in Rhode, Deutschland, erstellt.
Aufgabe 2
Suchen Sie aus Ihrer Umgebung zwei Unternehmen – ein streng nach klassischer Hierarchie funktionierendes und eines, in dem Gruppenstrukturen eine größere Rolle spielen. Vergleichen Sie die beiden und erarbeiten Sie folgende Punkte:
1.) Welche der erwähnten Schwächen erkennen Sie in den beiden Unternehmen?
2.) Welche Erfahrungen haben Sie schon gemacht – wann und wie haben diese Schwächen schon in Ihrem Berufsleben eine Rolle gespielt?
3.) Nach welchen Prinzipien hat „Aufstieg“ in Ihrem Leben bisher funktioniert und wie ist es Ihnen damit ergangen?
4.) Bei welcher Gelegenheit und warum waren Sie schon auf Hierarchie wütend?
5.) ...und wann haben Sie die Hierarchie und ihre Gesetzmäßigkeiten für sich nützen, ausnützen können?
Soziokratie als Beispiel für Zukunftsorganisation
Es gibt eine Menge Sonderformen der Organisation, die letztlich alle auf dem vor ca. 10.000 Jahren (in der heutigen Form, Vorformen gab es schon viel früher) erfundenen Modell der Hierarchie beruhen. Wir werden sie in der Lektion 5 noch durcharbeiten, wenngleich in stark komprimierter Form.
Die Soziokratie soll ein Beispiel für eine Organisationsform sein, die es noch nicht wirklich gibt. Selbstverständlich gibt es sie doch, sie wird in einer gewissen Anzahl an Unternehmen bereits praktiziert und zwar mit – dort – großem Erfolg.
Sie hat sich aber noch nicht in der Wirtschaft durchgesetzt, sondern wird bisher vor allem im Schulbereich, in kleineren Firmen und manchen Non-Profit-Organisationen verwendet. Den Grund dafür sehen wir uns später an. Nun zum Modell. Als ersten Schritt nähern wir uns über eine Fallstudie an:
Raus aus dem Durcheinander
Aus dem englischsprachigen Newsletter 02/2008, übersetzt von Isabell Dierkes, redigiert von Christian Rüther
Fabrique in Delf/Holland, ist ein multidisziplinäres Designunternehmen für neue Medien, Markenentwicklung, Grafik- und Industriedesign. Es wurde 1992 gegründet, beschäftigt ungefähr 90 Mitarbeiter und arbeitet seit 2004 mit der Soziokratie. Es hat schon zahlreiche Preise für seine Entwürfe und Arbeiten gewonnen.
Kunden von Fabrique sind die Konsumgüterindustrie, Unterhaltungsunternehmen, Kultur- und Dienstleistungsunternehmen, die Regierung und Organisationen im Erziehungsbereich.
Zu Beginn der Arbeit mit der Soziokratie wurden bei Fabrique die Produktionsprozesse analysiert und umstrukturiert. Das führte zu einer besseren Aufgabenverteilung und einer neuen Organisationsstruktur. Die Arbeit wird jetzt effektiver und mit höherer Qualität ausgeführt.
Paul Stork, einer der drei Geschäftsführer von Fabrique, erklärt:
„Das Unternehmen setzte sich früher aus relativ kleinen Teams zusammen. Es gab acht Mitarbeiter je Team, die sich einen Raum miteinander teilten. Ein Team bestand aus Designern, Programmierern und Projektleitern. Der Teamleiter, eine mitarbeitende Führungskraft, bestimmte die Vorgaben. Er oder sie war für das Arbeitsklima und die Entwicklung innerhalb der Mannschaft verantwortlich. Diese Arbeit, einschließlich Leistungsüberprüfungen, kam bei den Teamleitern zu ihrer normalen Projektarbeit hinzu.“
Die Teamleiter hatten keine Verantwortung für die finanziellen oder qualitativen Aspekte der Arbeit. Diese Verantwortung wurde an die beiden Abteilungsleiter delegiert, die alle Teams überwachten. In der Hierarchie standen diese Abteilungsleiter zwischen den Teamleitern und den Direktoren. Die Direktoren jedoch, Stork unter ihnen, waren auch damit beschäftigt, die Inhalte von Projekten zu definieren und die Kundenbeziehungen aufrecht zu erhalten.
Mama-und-Papa-Verhalten
Diese Struktur war in einiger Hinsicht ungünstig. Es war unklar, wer den Produktionsprozess überwachte oder wer für was verantwortlich war. Daher gab es viel „Mama-und-Papa-Verhalten“, wie Stork es nennt. „Wenn ein Abteilungsleiter etwas untersagte, wandten sich die Leute an den nächsten, um die Zustimmung zu bekommen. Es war auch schwierig, in Richtung Qualität zu steuern. Die Direktoren waren hauptsächlich an der inhaltlichen Qualität orientiert, während sich die Projektleiter mehr auf die Qualität der Abläufe konzentrierten.“ Außerdem ging die Führung auf verschiedenen Ebenen in verschiedene Richtungen. Ein Teammitglied konnte zum Beispiel mit dem Segen von einem Direktor einem Projekt zusätzliche Zeit widmen, um den Kunden besser zufrieden zu stellen, während aus der Sicht des Abteilungsleiters in der Rückschau diese Entscheidung in finanzieller Hinsicht schlecht war.
Bessere Abstimmung
Jeder wusste um das Verbesserungspotenzial in der Arbeitsorganisation und es gab wiederholt Vereinbarungen dazu. Aber niemand war für die Umsetzung der Vereinbarungen verantwortlich, da es keine Klarheit über die Befugnisse gab, die zu bestimmten Aufgaben gehörten. So führten die Vereinbarungen nur zu unausgereiften Lösungen. Die Lösung des Soziokratischen Zentrums war, die Organisationsstruktur zu ändern. Die Gebiete der Abteilungen wurden eindeutig definiert und ihre verschiedenen Funktionen wurden miteinander abgestimmt. Die Veränderungen verbesserten die Koordination zwischen Führung und Umsetzung und zwischen Produktion und Verkauf. Die Arbeitsabläufe in den Abteilungen wurden anhand des Kreisprozesses von Leiten, Ausführen und Messen neu formuliert und klar einzelnen Funktionen zugeordnet. Jede Abteilung gewann zudem die Entscheidungshoheit über ihre Belange und damit stieg die Selbstverantwortung.
Die Verwirrung entwirrt
Wie sieht die Organisation von Fabrique im Augenblick aus? Paul Stork sagt, dass es derzeit drei Abteilungen gibt:
„Diese arbeiten wie zuvor medienübergreifend: Sie arbeiten in beiden Bereichen, den Printmedien und dem Internet. Jede hat ihre eigenen Kunden und trägt ihre eigene Verantwortung für Verkauf und Qualität. Zwei der drei Abteilungen - gleichzeitig die größten beiden - haben inzwischen einen Leiter, der vollzeit führt und nicht mehr im operativen Geschäft tätig ist. Die dritte Abteilung ist dafür noch zu klein, aber sie wird vielleicht in der Zukunft ihren eigenen Abteilungsleiter erhalten. Zurzeit ist der Leiter ein „mitarbeitender Abteilungsleiter“.“
Die Verwirrungen der Führungsebenen, die das Unternehmen durchzogen, wurden ziemlich gut entwirrt. Die Abteilungsleiterin ist verantwortlich für Arbeitsklima, Qualität, Entwicklung und Finanzen. Sie weist auch die Projektleiter*innen an, die für den alltäglichen Fortschritt der Arbeit zuständig sind. Die Abteilungen definieren auch ihre eigenen Grundsätze, unter dem Vorbehalt, dass sie diese mit den anderen Abteilungen abstimmen, damit sie nicht gegen die allgemeinen Ziele von Fabrique stehen.
„Alles ist jetzt viel besser steuerbar“, meint Stork. „Kein Mama-und-Papa-Verhalten und das Geschäft hat auch an Dynamik gewonnen“. Er nennt ein Beispiel: „Wir haben einen neuen Plan zur Steigerung der Rentabilität von Projekten gestartet. Seine Umsetzung begann erst langsam. Aber nun, da wir unsere organisatorischen Änderungen durchgeführt haben, können wir die Projektverantwortlichen besser identifizieren und sie arbeiten motivierter. Die Dinge gehen viel schneller, und die Gewinne steigen.“
Die neue Rolle der Direktor*innen
Als Direktor ist Stork jetzt weniger in Angelegenheiten der Umsetzung eingebunden. Er muss sich keine Sorgen um Fristen für Projekte oder um die Planung von Weiterbildungen oder Versammlungen mehr machen, weil das in der Verantwortung der jeweiligen Führungskräfte liegt. Marketing ist jetzt seine erste Aufgabe. Er lacht: „Wenn ich manchmal in meine alte Gewohnheit zurückfalle, mich in Projekte einzumischen, sind die Abteilungs- und Projektleiter bevollmächtigt, mich darauf hinzuweisen, weil es jetzt klar ist, wer für was verantwortlich ist.“
Damit erhalten diese eine Korrekturfunktion und können die Direktoren*innen an ihre Funktionsgrenzen erinnern. Doch damit nicht genug, zukünftig könnten Aufgaben, die jetzt von den Direktoren und von Beratern wahrgenommen werden, ebenfalls an die Abteilungen delegiert werden. Stork:
„Die Mitarbeiter in den Abteilungen möchten nicht dasitzen und auf Aufträge warten, sondern ihr eigenes Marketing machen. Sie möchten nicht auf Futter warten, wie ein Nest junger Vögel, die mit ihren weit geöffneten hungrigen Schnäbeln auf einen Wurm warten.“ Sobald das eingeführt sein wird, werden die Abteilungen Organismen geworden sein, mit der Fähigkeit, ihr eigenes Fortbestehen zu sichern. Dann werden sie drei wichtige Funktionen in ihren eigenen Händen haben: Sicherstellen, dass sie Input bekommen (Werbung/Akquise), dass sie etwas produzieren (Transformation) und dass ihre Produkte ausgeliefert werden (Output).
Wird sich Stork dann auf seinen Lorbeeren ausruhen können? Nein, er wird sich aufgrund seiner Projekterfahrung und Leitungsfunktion mit mehreren Themen beschäftigen: dem Nachdenken über die Zukunft des Unternehmens, der Gestaltung und Ausformung von Kooperation mit externen Partnern sowie der Kundenpflege und Einführung von Neuerungen.
Was ist nun „Soziokratie“?
Es ist an der Zeit, die Rahmenbedingungen zu definieren: Soziokratie ist ein Ansatz, der ein Unternehmen in folgenden Aspekten bereichern könnte:
- Entscheidungen werden von allen Beteiligten getragen. Das erhöht die Motivation/Selbstdisziplin auch bei der Umsetzung mitzuwirken und kann die brachliegenden Produktivitätspotenziale entfalten. Krankenstand und „innere“ Kündigungen nehmen ab, die Identifikation mit dem Unternehmen steigt. Die Mitarbeiter*innen gehen gerne zur Arbeit und fühlen sich am Arbeitsplatz wohl.
- Die Qualitäten/Kompetenzen/das Knowhow der Mitarbeiter*innen fließen in die Entscheidungsfindung mit ein – Nachhaltigkeit und Qualität der Entscheidungen steigen.
- Der Wandel wird als Teil der natürlichen Entwicklung akzeptiert, das Unternehmen und die Mitarbeiter*innen gestalten aktiv Veränderungen im Unternehmen. Change Prozesse werden als Chance gesehen, gefördert und unterstützt.
Die Soziokratie ist ein System von Managementinstrumenten, wodurch Organisation effektiv und effizient „produziert“ werden kann. Die Methode basiert auf dem Prinzip der Gleichwertigkeit und auf wissenschaftlichen Erkenntnissen über das Steuern dynamischer Prozesse (Kybernetik).
Die Soziokratie wurde von Prof. Dr. Gerard Endenburg seit den 1960er Jahren auf der Grundlage der Ideen und Erfahrungen des niederländischen Sozialreformers Kees Boeke entwickelt und in sein eigenes Unternehmen (Endenburg Elektrotechniek) implementiert. In den siebziger Jahren entstand die Stiftung Sociocratisch Centrum Rotterdam mit dem Ziel, die gewonnenen Erkenntnisse weiterzugeben.
Die soziokratische Organisation
Die Soziokratie kann jeder bestehenden Organisation oder Struktur hinzugefügt werden, wenn ein gemeinsames Ziel besteht.
Die Soziokratie basiert auf vier grundlegenden Prinzipien:
1) Der Konsent regiert die Beschlussfassung, dabei meint Konsent hier: Es gibt keine schwerwiegenden und begründeten Einwände gegen einen Beschluss. Schwerwiegend meint die persönliche Einschätzung, ob diese Entscheidung dem gemeinsamen Ziel dient, d.h. innerhalb eines Toleranzbereiches zur Zielerreichung liegt. Begründet meint, ob ich Argumente liefern kann, die gegen einen möglichen Vorschlag sprechen. Es gibt hier kein Vetorecht, nur den Austausch und das Aushandeln auf der Basis von nachvollziehbaren Argumenten (das Argument regiert).
2) Die Arbeit wird in Kreisen und Kreisprozessen organisiert. Ein Kreis ist eine Gruppe von Menschen, die regelmäßig zusammenkommen und ein gemeinsames Ziel erreichen wollen. Im Unternehmen können das einzelne Teams, Bereiche, Abteilungen oder das Top-Management sein. Als Kreisprozess wird der dynamische Prozess von Leiten – Durchführen – Messen bezeichnet und hier so etwas wie ein Regelkreislauf oder kybernetischer Kreis.
3) Es gibt eine doppelte Verknüpfung von Kreisen, d.h. es gibt zwischen einem oberen und unteren Kreis zwei Verbindungsglieder. Zum einen den*die Chef*in, der*die von oben gewählt wird und zum anderen eine*n Vertreter*in, der von dem jeweiligen Kreis gewählt wird. Ziel ist es, die beiden Funktionen Leiten (Chef) und Messen (Vertreter) voneinander zu trennen.
Die Bereichskreise (Unternehmensbereich wie Marketing, Produktion, Distribution…) sind weiter aufgegliedert in die verschiedenen Abteilungskreise, die wiederum weiter aufgeteilt sind. Diese Kreisorganisation besteht neben der linearen Struktur. In diesen Kreisen werden die „politischen“ Entscheidungen getroffen, d.h. Grundsatzentscheidungen, die auf das gemeinsame Ziel ausgerichtet sind. Das Tagesgeschäft und die Ausführung dieser Entscheidungen funktioniert in den traditionellen Stablinien.
4) Die Wahl von Personen und Funktionen findet in offener Aussprache und im Konsent statt: Jedes Mitglied wählt eine Person mit Hilfe eines Wahlscheins.
- Der*die Wahlleiter*in liest die Zettel vor und bittet jeweils um Begründung für die Wahl.
- Der*die Wahlleiter*in fragt, ob jemand seine Meinung geändert hat.
- Der*die Wahlleiter*in macht aufgrund der Rückmeldungen einen Wahlvorschlag.
- Die TN geben ihre Zustimmung oder ihre Bedenken und begründen sie nachher.
- Der*die Wahlleiter*in integriert die Bedenken in einen neuen Vorschlag.
Prinzipien für die Soziokratische Organisation
- Meinungen können jederzeit geändert werden, auch Beschlüsse können bei einer späteren Versammlung wieder auf die Tagesordnung gesetzt werden, wenn es neue wesentliche Informationen gibt = dynamische Steuerung. Die Steuerung ist flexibel, pragmatisch. Wenn sich etwas an den Bedingungen/Ergebnissen ändert, kann sofort darauf reagiert werden.
- Es geht nicht um perfekte, sondern optimal machbare Lösungen auf der Basis der derzeitigen Kenntnisse und Ressourcen.
- Es gibt eine konstruktive Fehlerkultur. Fehler sind einfach Messungen, die ein Verlassen des Zielkorridors anzeigen. Sie dienen als Rückmeldung, um wieder auf die Spur zu kommen.
- Es gibt ein hohes Maß an Transparenz = alle für eine Entscheidung notwendigen Informationen müssen vorliegen, d.h. dass alle Beteiligten ein Recht auf den Zugang zu den für die Entscheidung notwendigen Informationen haben.
- Es gibt eine politische Ebene der Kreisversammlungen, in der die wesentlichen Rahmenbedingungen beschlossen werden, und eine ausführende Ebene, meistens in Linienform mit klassischer Aufteilung Chef*in und Teammitglieder, die das Tagesgeschäft erledigen und ausführen.
- Die Soziokratie als Organisationsform ist leer, d.h. sie kann für jede Organisation angewendet bzw. übernommen werden. Sie fördert Gleichberechtigung, ein kooperatives Miteinander, Eigenmotivation, Selbstverantwortung, Zusammenhalt und Ehrlichkeit. Insofern passt sie oder fördert sie ein kooperatives Miteinander. Herrschaftshierarchien werden verändert zu funktionalen Hierarchien.
- Es gibt eine Kultur des Sowohl-als-auch statt des Entweder-oder. Es geht sowohl um wirtschaftlichen Erfolg als auch Menschlichkeit, es geht um Konsententscheidungen im Kreis und Ausführung in funktionalen Hierarchien. (Scheinbare) Widersprüche werden aufgelöst.
Die soziokratische Moderation der Kreisversammlung
Die soziokratische Methode gibt eine klare Struktur und konkrete Hilfen, wie in Kreissitzungen Konsent-Entscheidungen herbeigeführt werden können.
Dabei fallen besonders folgende Elemente auf:
1) Die Unterteilung in verschiedene Runden: Bildformende Runden (Sammlung aller relevanten Informationen zu einem Thema), Meinungsbildende Runden (jede*r sagt seine*ihre Meinung zu dem Thema) und Konsentrunden (Beschlussfassung und Suche nach einem Beschluss ohne schwerwiegenden Einwand)
2) Das klare Ablaufschema für eine Kreissitzung: Einstiegsrunde
- Moderator*in erinnert an das gemeinsame Ziel der Organisation/Versammlung
- Befindlichkeitsrunde: Wie geht’s mir jetzt? Was brauche ich, um präsent zu sein?
- Bitten/Änderungswünsche zur jetzigen Tagesordnung
Administrativer Teil (was wird gebraucht, damit das Treffen effektiv ablaufen kann):
- Ankündigungen, die das Treffen beeinflussen könnten
- Länge des Meetings
- Bestätigung des Protokolls des letzten Meetings
- Datum, Ort des nächsten Meetings
- Beschluss der gemeinsamen Tagesordnung für dieses Meeting
inhaltlicher Teil mit den einzelnen Themen
Thema 1 (nach folgendem Ablaufschema)
Bildformende Phase: Präsentation des Themas/des Vorschlages und Sammeln aller Informationen, die für die Meinungsformung notwendig sind. Meinungsformende Phase: Alle Teilnehmer*innen haben die Gelegenheit, ihre Meinung zu dem Thema zu äußern (hintereinander). Danach wird es meistens noch eine zweite Meinungsrunde geben. Dabei werden mögliche Lösungsvorschläge oder Kriterien für eine Lösung gesammelt. Entscheidungsfindende Phase: Der*die Moderator*in formuliert einen Vorschlag auf Basis der Kriterien aus der Meinungsformenden Runde, liest ihn vor und stellt ihn zur Abstimmung. Jede*r Teilnehmer*in gibt seinen Konsent oder nennt einen schwerwiegenden Einwand. Gemeinsam wird das Argument hinter dem Einwand in einen neuen Vorschlag eingearbeitet und wieder zur Abstimmung gegeben, bis alle einverstanden sind.
Thema 2
Abschlussrunde
- Befindlichkeitsrunde: Wie geht’s mir jetzt?
- Rückmeldung zur Effektivität des Meetings – Messen, inwieweit Bedürfnisse erfüllt wurden
- Themen/TOP für das nächste Meeting
3) Das Reden nacheinander im Kreis, Blitzlichtrunden statt offene Diskussion. In der Regel geht es z.B. bei der Meinungsformenden Phase ein- oder zweimal im Kreis und jede*r Teilnehmer*in kann sagen, was zu dem Thema auf dem Herzen liegt. So wird jede*r gehört und jeder kann auch die dazukommenden Gedanken äußern und weitere Kriterien ergänzen. Diese Form der Erhebung verhindert unfruchtbare Diskussionen, die sich im Kreis drehen, sowie Polarisierungen zwischen einzelnen Vielrednern.
4) Die besondere Verantwortung des*der Moderator*in: Er*sie ist als Mitglied der Gruppe in einer Doppelrolle – einerseits Moderator*die, andererseits „normales“ Gruppenmitglied. Als Moderator*in hat er*sie die Aufgabe aus der Vielzahl der Rückmeldungen einen Vorschlag zu finden, der möglichst von allen Beteiligten getragen werden kann. Als Gruppenmitglied kann er*sie versucht sein, seine*ihre eigenen Argumente oder Vorschläge besonders zu gewichten. Der*die Moderator*in braucht eine besondere Präsenz und Lösungsorientierung. Zur Präsenz gehören unbedingte Akzeptanz der Teilnehmer*innen, die innere Klarheit, an welchem Punkt der Versammlung sich die Gruppe befindet, sowie eine Balance zwischen Führen und Laufenlassen. Zur Lösungsorientierung gehört die Geduld und Ruhe, wenn der Entscheidungsprozess etwas dauert, sowie die Fähigkeit, jeden Einwand als hilfreich zu begrüßen und die Argumente dahinter zu hören und einen konstruktiven Vorschlag für den Kreis zu finden.
Prinzipien der Soziokratischen Moderation
- Das Argument zählt – rationeller Zugang und Fokus auf „gute“ Absichten. Emotionen haben auch ihren Platz. Sie werden als Anzeiger für bestimmte Argumente gesehen, die noch nicht genug gewürdigt sind. Allerdings zählen diese Emotionen nur, wenn die Verbindung zu den Argumenten gefunden werden kann.
- Es wird eine Form von „Macht mit“ statt „Macht über“ gefördert: Alle Beteiligten haben die gleichen Möglichkeiten der Mitsprache und jedes Argument zählt. Dabei gibt es keine Abstufung nach Position oder Dauer der Betriebszugehörigkeit o.Ä. (Gleichwertigkeit – Gleichberechtigung der Mitarbeiter*innen – Primat des Arguments).
- Einwände werden als noch nicht gehörte Argumente gesehen und begrüßt. Die Kunst des*der Moderator*in besteht darin, die Einwände so umzuwandeln, dass sie konstruktiv genutzt werden können.
- Der*die Moderator*in ist nicht allein verantwortlich für das Gelingen der Kreisversammlung. Sie gehört allen Kreismitgliedern und der*die Moderator*in kann jederzeit die TN fragen, wie es weitergehen soll bzw. welche Ideen zum Prozess im Raum sind.
Grenzen und Herausforderungen
- Funktioniert nur, wenn das Top-Management sich für die Einführung einsetzt.
- Ist ein Lernweg, dauert und braucht Zeit, einerseits für das Unternehmen als Gesamtorganismus, andererseits für die beteiligten Personen.
- Die Unternehmenskultur und die Soziokratie müssen zusammenpassen bzw. eine Bereitschaft zum Wandel da sein.
- Ist Pionierarbeit, weil der Ansatz im deutschsprachigen Raum kaum bekannt ist und international erst in wenigen Unternehmen ganz implementiert wurde.
Ablauf für die Implementierung der Soziokratie in einer Organisation
- Information über Soziokratie: Schnupperworkshop, -seminar, externe*r Expert*in moderiert eine Teamsitzung mit der Soziokratischen Methode
- Top-Management möchte die Soziokratie einführen, Entscheidung für die Soziokratie
- Projektgruppe organisiert die Einführung, ggf. erst in einer bestimmten Abteilung
- Schulung der Mitarbeiter*innen in Soziokratie
- Während der Lernphase moderiert ein*e soziokratische*r Expert*in die ersten sechs Kreissitzungen. Danach moderiert ein*e aus der Gruppe gewählte*r Moderator*in. Der*die externe Expert*in unterstützt.
- Messen der Ergebnisse und Abstimmen des weiteren Vorgehens mit der Projektgruppe/ dem Management.
Literaturtipps
- Buck, John/ Villines, Sharon: We the people. A guide to sociocratic principles, 2007
- Endenburg/ Buck: Die kreativen Kräfte der Selbstorganisation, 2005
- Endenburg, Gerard: Sociocracy. As social design, 1998
- Endenburg, Gerard: Sociocracy. The organisation of decision-making “no Objection” as the principle of sociocracy, 1998
Aufgabe 3
1.) Eine schnelle Reflexion: Wie geht es Ihnen mit diesem Modell? Spinnerei oder DAS Konzept der Zukunft? Möglichst spontan antworten, in ein paar Worten!
2.) Denken Sie an die Organisation, in der Sie gerade arbeiten oder die letzte, in der Sie gearbeitet haben. Beantworten Sie bitte die folgenden Fragen:
• Hätte das Konzept der Soziokratie dort eine Chance? Warum bzw. wie?
• Welche Hindernisse würden auftauchen?
Management-Strategien
In dieser Lektion lernen Sie Management-Fehler kennen und werden sich mit ihnen auseinandersetzen.
Auf den ersten Blick wirkt eine humoristische Verpackung gerne als ob es sich um nichts Ernstes handeln würde.
Doch manchmal brauchen Menschen den Humor, um Unerträgliches erträglicher zu machen.
Die folgenden Management-Strategien gibt es wirklich. Sie haben lustige Namen, verursachen in Organisationen jedoch eine Menge Ärger, Gleichgültigkeit, Kündigungen etc. Genau genommen handelt es sich nicht um Strategien, sondern um Fehler. Sie entstehen, wenn Manager*innen nicht gut ausgebildet sind oder einfach nur unfähig. Das wirkt sich massiv aus, vor allem auf die Mitarbeiter*innen, die meist vor der Aufgabe stehen, diese Fehler irgendwie auszubügeln, zu kaschieren oder einfach die Folgen zu schlucken. Oftmals entsteht dadurch erheblicher Leidensdruck, der sich massiv auf Arbeitsleistung und Firmenerfolg auswirkt.
Gute Manager*innen sind rar und gesucht. Sie haben das notwendige Verständnis für die Wichtigkeit der Selbstreflexion und
Aufgabe 4
Diesmal befindet sich die Aufgabe gleich am Anfang der Lektion, denn sie IST sozusagen die Lektion.
Lesen Sie sich die folgenden Management-Strategien durch und beantworten Sie die Fragen in den rechten Tabellenspalten. Sie finden diese Tabelle online im Forum.
Wenn Sie diese Übung ernsthaft angehen, werden Sie erkennen, wie komplex Managementfehler sind und wie sie sich in der Praxis auswirken. Sie können diese Aufgabe auch für die eigene Selbstreflexion verwenden – viele von Ihnen sind schon in einer Führungsposition und können sich vielleicht mit dem einen oder anderen Punkt identifizieren.
Am Ende des Semesters werden wir die gesammelten Lösungen allen Teilnehmer*innen zur Verfügung stellen und im Sinne unseres didaktischen Konzepts erstens eine gewisse Vollständigkeit und zweitens für alle neue Erkenntnisse erhalten.
Spalte 1: Der Name des Management-Fehlers. Sagt schon einiges aus.
Spalte 2: Erklärung des Management-Fehlers
Spalte 3: In dieser Spalte bearbeiten Sie das Thema und beantworten bitte folgende Fragen, sofern sie beantwortbar sind:
- Wo bin ich selbst mit diesem Management-Fehler schon in Berührung gekommen?
- Wie hat sich das auf mich ausgewirkt, wie ist es mir dabei ergangen?
- Wie hat sich das auf die Firma, das Arbeitsklima ausgewirkt?
- Habe ich diesen Fehler selbst schon begangen und was ist dann passiert?
Spalte 4: Wie konnte das Problem gelöst werden? Mögliche Antworten:
- Gar nicht – alle leiden immer noch.
- Durch Kündigung der Mitarbeiter*innen.
- Durch Kündigung des*der Manager*in.
- Durch Auflehnung der Mitarbeiter*innen.
- Durch den*die Chef*in darüber.
- Sonstiges:
| Management-Fehler | was soviel bedeutet wie | Selbst erlebt | Lösungen |
| Management by Känguruh | Mit leerem Beutel große Sprünge machen |
|
|
| Management by Crocodile | Bis zum Hals im Dreck stecken - aber das Maul groß aufreißen! |
|
|
| Management by Champignon | Mitarbeiter im Dunkeln lassen, von Zeit zu Zeit mit Mist bestreuen und wenn sich Köpfe zeigen - sofort absäbeln! |
|
|
| Management by Chromosom | Führungsqualifikation ausschließlich durch Vererbung |
|
|
| Management by Harakiri | Souveräne und dauernde Missachtung aller Gegebenheiten |
|
|
| Management by Helikopter | Über allem schweben, von Zeit zu Zeit auf den Boden kommen, viel Staub aufwirbeln und dann wieder ab in die Wolken! |
|
|
| Management by Jeans | An allen wichtigen Stellen sitzen Nieten! |
|
|
| Management by Margerite | Entscheidungsfindung nach dem System: ich soll, ich soll nicht... |
|
|
| Management by Partisan | Selbst die engsten Mitarbeiter falsch informieren, damit die eigenen Ziele nicht erkennbar werden. |
|
|
| Management by Ping-Pong: | Jeden Vorgang solange hin- und herleiten, bis er sich von selbst erledigt hat. |
|
|
| Management by Herodes: | Intensiv nach dem geeignetsten Nachfolger suchen und dann feuern. |
|
|
| Management by Surprise: | Erst handeln, dann von den Folgen überraschen lassen. |
|
|
| Management by Robinson: | Warten auf Freitag! |
|
|
| Management by Darwin: | Mitarbeiter gegeneinander aufstacheln, Sieger befördern, Verlierer abschieben. |
|
|
| Management by Nilpferd: | Maul aufreißen und danach untertauchen. |
| |
| Management by Saussage: | Allen ist Alles wurscht, aber jeder gibt seinen Senf dazu. |
| |
| Management by Kette: | Loch an Loch - aber es hält! |
|
|
| Management by Opportunity: | Schnell zupacken, wenn die Mieze schwach wird. |
| |
| Management by Staubsauger: | Der Chef surrt den ganzen Tag herum und kümmert sich um jeden Dreck. |
| |
| Management by Bicycle: | Nach oben buckeln, nach unten treten. |
|
|
| Management by DIN A4: | Flipcharts, Time-Planers etc. everywhere. |
| |
| Management by Nena: | Irgendwie, irgendwo, irgendwann... |
| |
| Management by Terror: | Ziele setzen, Mittel verweigern! |
|
|
| Management by Titanic: | Perfekt geplant und abgesoffen... |
|
|
| Management by Hai (MobyDicking): | Auftauchen, Schrecken verbreiten, Abtauchen. |
|
Und nun folgt noch eine Zusatzaufgabe: Wenn Sie mit dieser Aufzählung noch nicht zufrieden sind, dann ergänzen Sie bitte die Sammlung um eigene Formen:
| Management-Fehler | was soviel bedeutet wie | Selbst erlebt | Lösungen |
| Management by ... |
|
|
|
| Management by ... |
|
|
|
Der gerechte Chef
In dieser Lektion lernen Sie die unterschiedlichen Formen der Gerechtigkeit. Kennen Sie schon? Natürlich kennen Sie das schon. Sie wissen nur ev. noch nicht woher und in welcher Form Sie das kennen. Und welche Rolle es in Organisationen spielt – eine große nämlich, denn es beeinflusst jede Menge Management-Entscheidungen und hat einen starken Impact auf die Unternehmenskultur.
Menschen, die Führungsarbeit leisten, werden täglich vor Probleme gestellt. Eine Anforderung besteht darin, ein*e „gerechte*r Chef*in “zu sein. Kein*e Mitarbeiter*in will „ungerecht“ behandelt werden. Worin liegt nun das Geheimnis der „Gerechtigkeit“ - und: wie zum Teufel hat Salomon das geschafft?
Sehen wir uns als Beispiel die Geschichte vom „Verlorenen Sohn“ aus der Bibel an - hier nur in stark verkürzter Fassung.
„Ein Vater hatte zwei Söhne. Der erstgeborene war ein fleißiger Jüngling, der dem Vater am Feld brav zur Hand ging. Der jüngere war ein Taugenichts, der sich am liebsten mit Freunden herumtrieb und sich im Hause nahm, was er brauchte. Eines Tages ging der jüngere Sohn von zu Hause fort. Er nahm sich Geld mit, Kleidung und Essen, während der ältere Sohn daheim blieb und dem Vater weiterhin eine große Hilfe war.
Viele Jahre vergingen, der Vater und die Mutter waren inzwischen alte Leute, da klopfte es eines Abends an der Tür und der jüngere Sohn trat ein. Er war heruntergekommen und hatte offensichtlich schon lange nichts gegessen. Nachdem ihn die Familie willkommen geheißen hatte, verlangte der jüngere Sohn nach seinem Erbe. Vater und Mutter berieten sich und gaben schließlich dem jüngeren Sohn all das Geld, das sich im Laufe der Jahre reichlich angesammelt hatte - nicht zu letzt durch die Mithilfe des älteren Sohnes. Dieser war ob der Verteilung des Erbes erzürnt.“
Wie die Geschichte ausgeht, ist in der Bibel zu lesen - hier interessiert uns die Frage nach der Gerechtigkeit. Warum hat der jüngere Sohn, der nie mithalf und keinerlei Leistung vollbracht hatte, das gesamte Erbe bekommen? Warum war es nicht zwischen den Söhnen aufgeteilt worden? Es war ja schließlich nicht die Schuld der Familie, dass der jüngere Sohn in der Fremde alles verprasst hatte.
Wer stimmt mit ein, wenn wir schreien: DAS IST UNGERECHT!?
Sehen wir uns zur Beantwortung der Frage nach der Gerechtigkeit einmal an, was die Söhne auszeichnet: Der ältere ist fleißig, er erbringt regelmäßig LEISTUNG für die Familie. Der jüngere Sohn ist faul und sticht dadurch heraus, dass er an die Familie mit BEDÜRFNISSEN herantritt. Es gibt nun mehrere Formen der Gerechtigkeit, die auch in modernen Unternehmen unterschieden werden müssen:
1. DIE LEISTUNGSGERECHTIGKEIT
Sie ist die vorherrschende, „gefragte“ Form in Hierarchien. Die Belohnungen - meistens Geld, aber auch, sehr modern, „Incentives“ – werden an den*diejenigen vergeben, der*die die beste Leistung gebracht hat: am meisten verkauft, die motiviertesten Mitarbeiter*innen, die schnellste Projektorganisation usw. Diese Form der Gerechtigkeit eignet sich gut, um das Konkurrenzprinzip zu fördern. Das „Gegeneinander“ wird geschürt, denn nur der*diejenige, der*die besser ist als der*die andere (oder auch als eine fiktive Vorgabe) erhält die Belohnung. Die Leistungsgerechtigkeit ist ein männliches, väterliches Prinzip.
2. DIE BEDÜRFNISGERECHTIGKEIT
Eine Mutter gibt demjenigen ihrer Kinder am meisten zu essen, das den größten Hunger hat - ein vor allem unter Menschen zu beobachtendes Phänomen, das vor allem dann seine Gültigkeit hat, wenn genug Ressourcen vorhanden sind, um alle Kinder ernähren zu können. Die Mutterbrust bekommt derjenige gereicht, der ihrer bedarf - nicht der*diejenige, der*die am meisten „leistet“.
Dieses Prinzip ist in Hierarchien nur selten zu finden, in Gruppen häufiger, da dort alle Mitglieder ein wertvoller Bestandteil der Gruppe sind, um deren Erhalt man sich gemeinsam kümmern muss.
Die Bedürfnisgerechtigkeit ist ein weibliches, mütterliches Prinzip.
Wenn es nur Leistungs- und Bedürfnisgerechtigkeit gäbe, so hätte die moderne Form des menschlichen Zusammenlebens nur wenige Chancen zu bestehen. Unter Menschen, die nur nach dem Prinzip der Leistungsgerechtigkeit leben, lautet das Motto: „es ist gerecht, wenn der Stärkere alles bekommt“ - der Schwächere muss dem Stärkeren weichen, bekommt gar nichts und stirbt.
Diese Form der „Gerechtigkeit“ wird mittels Gewalt durchgesetzt und zeichnet sich durch einige Nachteile aus, die die Menschen dazu veranlasst haben, ein weiteres Prinzip der Gerechtigkeit einzuführen:
a. Der*die Schwächere hat oft Informationen, Können oder Wissen, das für das Überleben der anderen (Gruppenmitglieder) wichtig ist.
b. Eine Weiterentwicklung der Konfliktlösungsmöglichkeiten ist nur dann möglich, wenn die Gewalt in „geordnete Bahnen“ geleitet wird.
c. Wenn genug Ressourcen vorhanden sind, macht es wenig Sinn, wenn der*die Stärkere alles besitzt.
Die Menschen entwickelten das Konfliktlösungsmodell der Hierarchie, die „Delegation“. Diese ist jedoch nur durchzusetzen, wenn man die Menschen zwingen kann, all ihre Konflikte an die höhere Instanz zu delegieren. Dazu wurde das „Gewaltmonopol“ erfunden - Polizei, Gerichte und Gefängnisse sind moderne Manifestationen dieses Prinzips.
Wenn der*die Richter*in entscheidet, dann haben wir hier die dritte Form der Gerechtigkeit:
3. DIE GESETZESGERECHTIGKEIT
Das Gesetz entscheidet, wer wann was bekommt.
Dies ist ebenfalls ein männliches, hierarchisches Prinzip. Meist gibt es in einer Firma klare Regelungen, die ebenso klar missachtet werden. Offiziell bekommen alle den gleichen Bonus, aber der Ferdinand darf nächstes Jahr die besseren Dienstreisen machen. Offiziell, laut Qualifikation und Erfahrung müsste die Dagmar die nächste Projektleiterin sein, de facto wird es die Doris.
Gesetz bedeutet in diesem Fall firmeninterne Regelung, manchmal aber auch tatsächlich gesetzliche Regelung, etwa wenn der Staat eine gewisse Quote vorgibt oder Kollektivverträge einzuhalten sind.
In Organisationen ist es notwendig, alle drei Gerechtigkeiten im System irgendwo verankert zu haben, um bei gegebenem Anlass darauf zurückgreifen zu können.
Ein*e gute*r Chef*in muss die Balance zwischen diesen drei Formen der Gerechtigkeit wahren können – und die Ausübung aller drei Formen beherrschen. Das ist die Kunst des Managements in Organisationen.
Aufgabe 5
Auch hier geht es wieder darum, Ihre Erinnerung zu strapazieren.
1. Beschreiben Sie eine Begebenheit aus ihrem beruflichen Alltag, wo der*diejenige am meisten bekommen hat, der*die der*die Beste war:
2. Beschreiben Sie eine Begebenheit, wo der*diejenige am meisten bekommen hat, der*die am meisten brauchte:
3. Beschreiben Sie eine Begebenheit, wo derjenige Recht bekommen hat, der sich nach den Vorschriften verhalten hat:
4. Wo würden Sie sich selbst einschätzen? Welche der drei Formen bevorzugen Sie und warum? Welche hat sich eventuell in Ihrer eigenen beruflichen Laufbahn bewährt? Bringen Sie bitte Argumente dafür und dann – das ist der schwierigere Teil der Aufgabe – suchen Sie bitte Argumente, die gegen Ihre Argumente sprechen.
Wofür das gut ist? Für die eigene Fähigkeit, die individuellen Grenzen zu erkennen. Gerade im Bereich der Suche nach Gerechtigkeit gibt es oft kein richtig und falsch, sondern es ist notwendig, zwei Seiten gegeneinander abzuwägen, und dann eine Entscheidung zu treffen.
Das ist Management und daher nicht immer leicht. Deshalb bekommen Manager*innen auch oft mehr bezahlt als andere Menschen, weil sie vor Entscheidungen gestellt werden, die eben nicht eindimensional zu treffen sind. Vielfach sind dann auch die Auswirkungen zu managen und die Auswirkungen der Auswirkungen.
Männer und Frauen in Organisationen
Was hat das mit „Management und Organisation“ zu tun? Die Beantwortung dieser Frage ist eigentlich recht einfach, nur sprechen wir hier von einer Dimension, die uns erst in Zukunft klar sein wird. Da Sie, verehrte Student*innen, auch für die Zukunft und nicht für die Vergangenheit studieren, dürfen wir uns erlauben, gemeinsam in diese Zukunft zu blicken. Natürlich besteht die Gefahr, dass wir uns irren, aber die besteht im Management auch dauernd, und trotzdem muss es irgendwie funktionieren.
Bisher haben wir uns nur kurz mit der Sprache beschäftigt, jetzt soll es einen Schritt tiefer gehen.
In dem Wort „Gender-Gerechtigkeit“ oder „Emanzipation“ steckt meist ein Unterton, der all dem eine Wertung gibt. Und zwar eine negative. Übrigens vergeben diese Wertung meistens Männer. Sehen Sie sich die Liste der Student*innen genau dieser Lehrveranstaltung an. Wie viele Männer, wie viele Frauen? Vielleicht kann ja dieses Lektion helfen, die eigene Position zu reflektieren.
Nicht nur in Forschung und Lehre sind Frauen seltener vertreten, wenngleich sich das auch gerade ändert, sondern vor allem im Management. Das verdanken wir 10.000 Jahren Patriarchat und es stellt sich die Frage, ob das die nächsten 10.000 Jahre auch noch so sein wird.
Ich möchte Sie nicht mit den Theorien langweilen, die in der Philosophie und den Sozialwissenschaften gerade kursieren (für Interessierte: Rückkehr des Archetyps der Großen Mutter von C.G. Jung, Stichwort Kreislauf anstelle von Exponentialentwicklung, Wiederfindung der Verbindung mit der Erde, anstelle des Modells „Macht euch die Erde untertan“ etc.), aber es wird sich einiges tun in nächster Zeit, möglicherweise durch die nächste große Weltwirtschaftskrise ausgelöst, möglicherweise auch nicht.
Fazit: Vielleicht brauchen wir die Frauen dann recht dringend. Es gibt übrigens bereits Länder, wo dies der Fall ist: Ruanda hat sich nach dem schrecklichen Bürgerkrieg 1994 erst entsprechend erholt, als die Frauen dort im Management der Firmen das Ruder übernommen haben. Nirgendwo auf der Welt gibt es so viele von Frauen geführte Firmen wie dort, nämlich im Verhältnis zu von Männern geführten Firmen.
Der Staatschef Kagame ist allerdings noch ein Mann, eine Art moderner Diktator mit demokratischem Gehabe. Aber es kann nicht alles auf einmal verändert werden, und es wird sicher spannend, was sich in den nächsten Jahren dort tut.
In Ruanda sitzen aber bereits jetzt mehr Frauen als Männer im Parlament und andere Länder beginnen nachzuziehen. Wir brauchen für das Gender-Thema aber gar nicht bis nach Ostafrika blicken, alles Wesentliche sehen wir auch bei uns. Immerhin bekam Österreich 2019 seine erste Kanzlerin, wenn auch nur als Interimskraft.
Der österreichische Dirigent und Komponist Gustav Mahler (1860 – 1911) soll einmal gesagt haben „Wenn die Welt einmal untergehen sollte, ziehe ich nach Wien, denn dort passiert alles fünfzig Jahre später.“
Schlau, wie die Wiener*innen sind, verkaufen sie das als typisch österreichische Gemütlichkeit.
Zum Einstieg ein kleiner Vergleich [1] :
Mit zweierlei Maß
Ein Familienfoto auf SEINEM Schreibtisch: Ein solider, treusorgender Mann.
Ein Familienfoto auf IHREM Schreibtisch: Ihre Familie kommt vor dem Beruf.
SEIN Schreibtisch ist überladen: Er ist sehr belastbar und fleißig.
IHR Schreibtisch ist überladen: Sie ist unordentlich und zerfahren.
ER spricht mit Kollegen: Er wälzt geschäftliche Probleme.
SIE spricht mit Kollegen: Sie tratscht.
ER ist nicht an seinem Schreibtisch: Er wird in einer Konferenz sein.
SIE ist nicht an ihrem Schreibtisch: Sie ist wohl auf der Toilette.
ER ist nicht im Büro: Er trifft sich mit Kunden.
SIE ist nicht im Büro: Sie wird beim Einkaufen sein.
ER ist mit dem Chef zum Essen: Er macht Karriere.
SIE ist mit dem Chef zum Essen: Die haben was miteinander.
Der Chef hat IHN kritisiert: Er wird sich zusammennehmen.
Der Chef hat SIE kritisiert: Das wird ihr zugesetzt haben.
IHM ist Unrecht geschehen: Ist er wütend geworden?
IHR ist Unrecht geschehen: Hat sie geweint? ER heiratet: Das gibt ihm mehr Beständigkeit.
SIE heiratet: Dann kommt ein Kind, und sie geht.
Bei IHM gibt es Nachwuchs: Grund für eine Lohnerhöhung.
Bei IHR gibt es Nachwuchs: Sie fällt aus - die Firma zahlt.
ER geht auf Geschäftsreise: Das ist gut für seine Laufbahn.
SIE geht auf Geschäftsreise: Was sagt ihr Mann dazu?
ER kündigt und verbessert sich: Er weiß eine Chance zu nutzen.
SIE kündigt und verbessert sich: Frauen sind unzuverlässig.
Was sagt die Wissenschaft, was sagt die Organisationsforschung? Nun, sie sagt, dass Frauen die besseren Manager sind (sollte Mann da nicht schon „Managerin“ sagen?). So einfach ist das, aber warum? Die Antwort auf diese Frage lautet in etwa: Frauen haben die besseren Mittel und Wege um in modernen Organisationen das Management zu übernehmen. Damit ist gemeint, dass sich Organisationen im Wandel befinden, etwa in folgenden Punkten:
Frauen denken mehr in Kreisläufen und langen Zyklen, Männer tendieren zu exponentiellem Denken und fördern daher auch diese Entwicklung. Das ist aber gerade ein Bereich, in dem die meisten Organisationen scheitern, weil sie nur die nächsten Quartalszahlen ansehen und alles auf kurzfristige Profitmaximierung ausrichten.
Frauen denken und managen nicht nur nach dem Leistungsprinzip, sondern auch nach dem Bedürfnisprinzip (siehe Lektion weiter oben). Das erste hätten wir jetzt bereits bis zum Erbrechen ausgereizt, es wäre Zeit für das zweitere.
Frauen können besser kooperativ sein, was nicht heißt, dass sie das Konkurrenzprinzip nicht kennen, aber sie stellen es nicht so in den Vordergrund wie die meisten Männer/Manager.
Frauen schätzen Kritik und wünschen sich Feedback. Sie sind auch viel eher als Männer dazu bereit, ihr Verhalten zu korrigieren.
Sie können im Gegenzug Kritik auch besser, also weniger verletzend äußern.
Frauen sind teamorientierter und denken weniger in Hierarchien als Männer. Dadurch verhalten sie sich fairer als ihre männlichen Kollegen und bleiben in Diskussionen auch sachlich.
Sie haben höhere soziale Kompetenz, auch wenn das die Männer nicht gerne hören.
Übrigens: Es müssen ja dann nicht die Frauen überall das Management übernehmen. Wenn sich Männer finden, die genau diese eher dem Weiblichen zugeordneten Prinzipien leben, dann ist es egal, wer die wichtigen Entscheidungen trifft, Hauptsache es sind die richtigen. Und doch wird es Sache der männlichen Führungskräfte sein, den Frauen einen sinnvollen = guten Platz zu geben, denn sonst werden sie ihn sich nehmen. Unterstützen wird sie dabei die wirtschaftliche Entwicklung, die hier ganz nach marktwirtschaftlichen Prinzipien vorgeht: Wer besser ist, gewinnt. Übersetzt heißt das: wer sich besser auf die Managementanforderungen der Zukunft einstellt = mehr Frauen im Management hat, gewinnt.
Dazu sind natürlich Schritte notwendig: Hausaufgaben, die Unternehmen in dieser Hinsicht zu leisten haben Referenzfehler: Ungültige Verwendung von<ref>: Der Parameter „ref“ ohne Namen muss einen Inhalt haben. ,aus dem Artikel „Warum Frauen im Unternehmen der Schlüssel zum Erfolg sind“ von Melanie Vogel, www.business-wissen.de, 2011,lauten:
Initiativen zur Feminisierung des Unternehmens sind Aufgabe des Top-Managements. Kleine Strohfeuer in einzelnen Abteilungen verpuffen, wenn von oben keine klaren Statements kommen, dass Gender Diversity dem Unternehmen und dem einzelnen Arbeitsplatz dient.
Unternehmen müssen ihr Beurteilungssystem für alle Mitarbeiter nach klaren und verständlichen Leistungskriterien definieren und so organisieren, dass erfolgreich sein nicht heißt, bis abends um 22 Uhr im Büro zu sein.
Firmeninterne Anreizsysteme müssen dafür sorgen, dass Chancengleichheit auch wirklich durchgesetzt wird.
Arbeitsstrukturen müssen familienfreundlich werden. Telearbeitsplätze, Home-Office oder Video-Konferenzen sind keine Zukunftsvisionen mehr. Die Umsetzung ist erprobt – es wird Zeit, dass die Unternehmen diese flexiblen Arbeitsmöglichkeiten selbstverständlich in den Alltag der Mitarbeiter integrieren.
Bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Dabei helfen Betriebskindergärten, Auszeiten für die Kinderbetreuung und Wiedereinstiegsprogramme nach Familienpausen.
Das Hinterfragen berufstätiger Mütter und Wiedereinsteigerinnen muss unterbunden werden. Unternehmen und Manager müssen lernen darauf zu vertrauen, dass Frauen, die Beruf und Familie kombinieren (müssen), ihr Privatleben und ihre Kinderbetreuung im Griff haben – im besten Fall mithilfe der Betreuungseinrichtungen im Unternehmen.
Installation von Mentorenprogrammen für Frauen mit dem Ziel, Frauen zu trainieren, die Sprache der Manager zu sprechen und ihren eigenen, authentischen Führungsstil zu entwickeln, der im Unternehmen akzeptiert wird.
Sichtbarmachen weiblicher Vorbilder, um gerade jungen Frauen zu zeigen, weibliche Karrieren sind möglich.
Aufgabe 6
Das wird sicher spannend, die Meinungen der (großteils) Männer zum Thema Frauen im Management zusammen zu tragen.
Am besten beantworten Sie folgende Fragen:
1.) Welche Erfahrungen haben Sie mit Frauen im Management? Versuchen Sie diese mit männlichen Managern zu vergleichen, die Sie kennen gelernt haben.
2.) Eine sehr persönliche Frage – oder doch nicht? Was ist Ihre Meinung dazu, warum es noch nicht mehr Frauen im Management gibt?
3.) Sie sind jetzt für ein paar Minuten Personalberater*in. Ein großer Kunde hat eine Anfrage und Sie haben die ideale Person für diesen Job. Der Kunde will einen Mann, Sie haben aber eine Frau zur Verfügung. Schreiben Sie einen Brief an den Kunden, in dem Sie versuchen, ihn von der Frau zu überzeugen.
Organisationsmodelle
Nach so viel Praxis sind wir bereit für die Theorie. Die erste theoretische Frage, die sich im organisationalen Kontext stellt, lautet: Was ist eine Organisation? „Wenn Sie nach einer Organisation suchen, werden Sie sie nicht finden. [2] “ Was man findet, sind Gebäude, Mitglieder, Kommunikationen, Entscheidungen, möglicherweise auch Papiere, auf denen „die Organisation“ beschrieben ist: Organigramme, Stellenbeschreibungen, Protokolle und Broschüren. Das Phänomen Organisation ist so schillernd wie unfassbar und zugleich in der modernen Gesellschaft allgegenwärtig. Wir werden von Kindheit an organisiert, manchmal versuchen wir auch selbst zu organisieren. Einmal institutionalisiert, bleibt die Organisation – kaum beeindruckt von bestimmten Personen – über Jahrzehnte oder Jahrhunderte bestehen. Wenn sie sich verändert, ist das nur selten auf Handlungen einzelner Personen zurückzuführen. Diese Unabhängigkeit von den Handlungen einzelner kann als einer der bedeutendsten Erfolgsfaktoren hochentwickelter moderner Organisationen gesehen werden. Was heißt dabei, „sie“ verändert sich? Was macht ein soziales Gebilde aus, das wir Organisation nennen? Allein durch die darin tätigen Personen können Organisationen nicht beschrieben werden. Organisationen bestehen vielmehr aus miteinander verbundenen Kommunikationen ihrer Mitglieder. Die Mitglieder sind dabei Träger*innen auf sie gerichteter Erwartungen, die zu einem System von Regeln verknüpft sind. Dieses Regelsystem besteht aus Selbstverständnissen, Normen, Werten, Routinen, Kompetenzen etc. „Sind einmal die Regeln eines institutionalisierten Spiels etabliert, dann ist es … korrekter zu sagen, dass das Spiel sich die Leute (Spieler*innen) so organisiert, dass das Spiel sich spielen kann. Ebenso machen nicht Lehrer*innen und Schüler*innen eine Schule, sondern die Schule organisiert sich Lehrer*innen und Schüler*innen so, dass das Regelsystem „Schule“ ablaufen kann [3] “. Das Beständige und Charakteristische von Organisationen sind die Regeln, die formalen und organisationskulturellen Strukturen, die den Strom möglicher Kommunikationen zwischen den Mitgliedern und mit der äußeren Umwelt kanalisieren und dadurch einigermaßen erwartbar machen. Diese hochkomplexen Regelsysteme überdauern ihre „Spieler*innen“ und sind von jener bemerkenswerten Stabilität, die unkonventionelle Mitglieder und interne wie externe Organisationsberater*innen in ihren Bemühungen auf „Verbesserung“ so häufig scheitern lässt.
Behauptungen, wie Organisationen grundsätzlich sind:
- allgegenwärtig und doch unfassbar und unsichtbar;
- immens leistungsfähig und dennoch …
- … manchmal dümmer als die darin handelnden Personen;
- sensibel und nachtragend?
- kühl und unpersönlich: Liebe und Dank sind keine organisationalen Kategorien.
- grundsätzlich träge und lernunwillig? Sie wollen letztlich so bleiben wie sie sind.
- Sammlungen von Entscheidungen, die nach Problemen suchen, von Themen und Gefühlen, die nach Entscheidungssituationen suchen, in denen sie Ausdruck finden können, von Lösungen, die nach Fragen suchen, auf die sie die Antwort sein könnten, und von Personen in Entscheidungssituationen, die nach Arbeit suchen. Dieses Entscheidungsmodell wird „Garbage-Can-Theory [4] “ genannt.
Nun sehen wir uns verschiedene Ansätze an. Sie alle funktionieren nach dem Organisationsmodell der Hierarchie – bisher haben die Menschen nun einmal noch nichts anderes erfunden. Die Ansätze wirken trocken, fade und nicht sehr attraktiv. Das liegt daran, dass Hierarchie generell etwas für den Kopf und nicht fürs Herz ist. Niemand liebt sie, man lebt mit ihr, in ihr, manchmal hasst man sie, weil sie so trocken und unpersönlich ist. Das ist es: unpersönlich! Als freiheitsliebendes Individuum fühle ich mich nun einmal nicht dort wohl, wo ich zum Zwecke des Überlebens den Preis der Unterordnung bezahle. Gerne und oft übersehen wir die Vorteile: nicht nur das Überleben, auch unsere Form der Zivilisation, der Kultur ist nur durch die Erfindung der Hierarchie möglich gewesen. Wir haben das zwar schon besprochen, aber es darf hier noch einmal mit ein bisschen anderen Worten gesagt werden: Wir brauchen die Hierarchie, denn sonst gäbe es keine Autos, keine Fernseher, keine Handys und noch viele andere Dinge nicht. Ob wir das alles brauchen? Das ist nicht die richtige Frage, obwohl sie heutzutage immer öfter die richtige zu sein scheint. Hätten wir es, wenn wir es nicht bräuchten? Scheinbar sind wir am Weg zur Menschwerdung irgendwo mittendrin. Ob wir aber eher am Anfang stehen oder kurz vor unserem Ende sind, das können nicht einmal die Philosoph*innen sagen. Und denjenigen, die es sagen können, empfehle ich nur bedingtes Vertrauen zu schenken. Nun aber zu den Organisationsmodellen.
Bürokratieansatz
In unserer heutigen Alltagsverwendung des Begriffs „Bürokratie“ schwingt häufig ein kritischer Unterton mit: Bürokratie steht vielfach als Synonym für organisationale Starrheit, Überkonformität und Ineffizienz. Dabei wird leicht übersehen, dass Bürokratien unter bestimmten Voraussetzungen sehr effektive Organisationsformen sind, ohne die die Verwaltung großer Institutionen, insbesondere des modernen Verfassungsstaates, undenkbar wäre. Charakteristisch für bürokratische Verwaltungsordnungen sind dabei vier Prinzipien:
Prinzip der Arbeitsteilung
Innerhalb der bürokratischen Organisation besteht eine geregelte Verteilung der Zuständigkeiten. Die Zuständigkeiten werden personenunabhängig und generell festgelegt. Damit können in der Organisation Personen ausgetauscht werden, ohne die Strukturen zu verändern. Die Kompetenzen umfassen neben inhaltlichen Aufgaben auch jenen Rahmen an Befehlsgewalt, der für die Aufgabenerfüllung erforderlich ist.
Prinzip der Amtshierarchie
Neben der horizontalen Aufgabenabgrenzung erfolgt auch eine vertikale, um die Koordination der Teile zu gewährleisten. Wenngleich der höheren Stelle ein Weisungs- und Kontrollrecht gegenüber der untergeordneten Stelle zukommt, ist es ihr dennoch nicht möglich, Kompetenzen der unteren Stelle an sich zu ziehen. Die Durchsetzung des Weisungsrechts ist durch weitere Regeln begrenzt. Im Konfliktfalle entscheidet jeweils die nächsthöhere Stelle. Man geht dabei davon aus, dass höhere Stellen über höhere Qualifikationen verfügen und in der Lage sind, einen größeren Bereich zu überblicken.
Prinzip der Regelmäßigkeit
Die Aufgabenerfüllung beruht auf „generellen, mehr oder minder festen und mehr oder minder erschöpfenden, erlernbaren Regeln“. Darin sind die zu erfüllenden Leistungen und Kommunikationsbeziehungen vorgesehen.
Prinzip der Aktenmäßigkeit
Nicht nur die Regeln der Aufgabenerfüllung bedürfen ihrer Kodifizierung, sondern auch die Aufgabenerfüllung selbst muss in Bürokratien schriftlich dokumentiert werden. Briefe, Aktennotizen und Formulare bilden einerseits ein wesentliches Kommunikationsmedium der Bürokratie, und andererseits erleichtern diese die Kontrolle und Nachvollziehbarkeit der Entscheidungen. Mit diesem Prinzip gewährleistet die Bürokratie eine Kontinuität der Aufgabenerfüllung auch bei einem
Wechsel der Amtsinhaber*innen.
Dass diese Prinzipien in hohem Maß aktuell sind, zeigt die aktuelle Diskussion um Qualitätszertifikate (z. B. nach den ISO 9000ff.-Normen). Diese schreiben vor, dass jeder Verfahrensschritt nachvollziehbar sein muss (Aktenmäßigkeit), einer verantwortlichen Stelle (Amtshierarchie bzw. Arbeitsteilung) zugeordnet werden und in einer festgelegten Art und Weise vollzogen werden kann (Regelmäßigkeit). Im Rahmen der Erstellung der Qualitätshandbücher wird organisationales Geschehen festgeschrieben, d. h. Stabilität in die Organisation getragen. Die Grundlage für diese „Entzauberung der Welt“ bildet die bürokratische Sozialisation. Damit ist in einem engeren Sinne die Formung des bürokratischen Menschen gemeint, der zwei spezifischen Anforderungen genügen muss: Rationalität und Loyalität.
Rationalität
Die Kalkulierbarkeit der Bürokratie beruht auf der emotionslosen und „wertfreien“ Anwendung der jeweiligen Regeln. Nicht Ziele oder Interessen bestimmen das Handeln des Bürokraten, sondern die ihm zur Verfügung stehenden Mittel. Die Ziele, die diesen Mitteln zugrundeliegen, sind jene des Herrschenden und stehen als solche außerhalb der bürokratischen Struktur.
Loyalität
Die zweite Hauptanforderung an die Mitglieder des Verwaltungsstabes ist Gehorsam und Amtstreuepflicht. Die Interessen der Organisation gehen gegenüber individuellen Interessen vor. Die Bürokratie bietet dem*der Beamten eine materiell abgesicherte Zukunft und erwartet im Gegenzug nicht nur die Hingabe von Leistung, sondern auch unbedingte Loyalität (= Amtstreue). Aus der Sicht des*der Beamten tritt damit sein*ihr Arbeitsleben in Gegensatz zu seinem*ihrem übrigen Dasein als Mensch, das ein gewisses Maß an Eigenverantwortlichkeit und Wertbezogenheit erfordert. Diese Trennung wird durch die strikte räumliche Trennung von Privat- und Arbeitsleben unterstrichen.
Stärken der Bürokratie
- hohe Stabilität der Organisation
- geringe Personenabhängigkeit: Das Ausscheiden einzelner Personen beeinträchtigt kaum das Funktionieren der Gesamtorganisation,
- Standardisierte Vorgehensweisen und klare Unterstellungsverhältnisse erleichtern die Orientierung.
Schwächen bzw. Gefahren der Bürokratie
- Erstarrung: Verfahren werden wichtiger als inhaltliche Ziele und Ergebnisse.
- Der Sinn der Gesamtorganisation ist für die einzelnen Handlungsträger*innen nicht mehr erlebbar. Damit kann die interne und externe Kommunikation der Organisation leiden.
- Die strukturimmanente Anonymisierung der Bürokratie kann die Motivation der Organisationsmitglieder massiv beeinträchtigen.
Horizontale Arbeitsteilung
Die Entwicklung der Hierarchie als Integrationsinstrumentarium ist in dem Maß von Bedeutung, in dem sich die Organisation horizontal (=arbeitsteilig) ausdifferenziert. Insbesondere bei starkem Wachstum gehen direkte Kommunikationsmöglichkeiten verloren. Arbeitsteilung und klare Abgrenzung von Zuständigkeiten haben den Effekt, dass Kommunikationserfordernisse reduziert werden. Die Organisationslehre unterscheidet zwei grundsätzliche Möglichkeiten der horizontalen Arbeitsteilung in Organisationen: funktionale und divisionale Gliederung.
Funktionale Gliederung
Funktionale Gliederung bedeutet Bildung von Verantwortungsbereichen nach den zu verrichtenden Aufgaben, z. B. Beschaffung, eigentliche Leistungserbringung, Marketing und Rechnungswesen. Mit diesem Gliederungsprinzip ist eine Konzentration der Tätigkeiten auf bestimmte Teilaufgaben verbunden. Wir finden hier das schon bekannte Modell der Hierarchie wieder:
Wie jede Organisationsstruktur verfügt die funktionale Gliederung über bestimmte charakteristische Vorteile:
- Hohe Spezialisierung und damit bestmögliche Nutzung der fachlichen Fähigkeiten
- Einschränkung der erforderlichen Qualifikationen der Handlungsträger*innen und dadurch Senkung der Personalkosten, insbesondere auf der operativer Ebene
- Kurze Einarbeitungszeiten
- Potentiell hohe Wirtschaftlichkeit der Aufgabenerfüllung durch Arbeitsteilung
- Aus dem Blickwinkel der Herrschaftssicherung handelt es sich dabei um ein „teile und herrsche“: Die einzelnen Funktionsbereiche sind auf die Organisationsleitung mit ihrer Klammerfunktion angewiesen
Zu diesen Vorteilen tritt eine Reihe von Schwächen der funktionalen Gliederung:
- Die Kommunikation zwischen den Funktionsbereichen findet regelmäßig über die Organisationsleitung statt. Dies kann zu Überlastung der Leitungsebene(n) führen.
- Durch die Vertiefung in bestimmte Funktionsbereiche kann das Verständnis für die Schwierigkeiten anderer Bereiche beeinträchtigt werden („Abteilungsblindheit“).
- Probleme in einem Bereich wirken sich direkt auf alle anderen Bereiche aus: Die Kette (des Leistungserstellungsprozesses) ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied.
- Durch diese strukturimmanenten Kommunikations- und Kooperationsprobleme leidet die Flexibilität der Gesamtorganisation. Auf Nachfrageverschiebungen oder andere Umweltveränderungen kann nur schwerfällig reagiert werden.
- Den einzelnen Bereichen können nur die anfallenden Kosten, nicht jedoch erwirtschaftete Erträge zugerechnet werden, denn eine Beschaffungsabteilung kann z. B. keine eigenen Erträge bringen.
Auch stark funktional differenzierte Organisationen können unter bestimmten Umweltbedingungen langfristig erfolgreich sein. Ihre Stärken liegen in hoher Stabilität und Verlässlichkeit sowie hoher potentieller Wirtschaftlichkeit der Aufgabenerfüllung. Die möglichen Nachteile wie strategische und organisationale Inflexibilität, beeinträchtigte Wirtschaftlichkeit durch einen „Organisations-Overkill“ und geringe Marktorientierung werden unter folgenden Umweltbedingungen nicht wirksam (Morgan):
- Die organisationalen Aufgaben müssen klar vorhersehbar sein, um eindeutige Verfahrensanweisungen festlegen zu können. Es muss erkennbar sein, was richtig und was falsch ist.
- Die Umwelt muss stabil genug sein, um sicherzustellen, dass die hergestellten Leistungen marktgeeignet sind. Eine stabile Umwelt ermöglicht es der Organisation, ihre Problemwahrnehmungskapazität auf einzelne Teile, z. B. das Topmanagement, zu beschränken.
- Die Produkte müssen standardisierbar sein.
- Präzision muss an erster Stelle stehen.
- Die menschlichen „Maschinen“-Teile müssen sich in der vorgesehenen Weise verhalten und auf eigenständiges Mitdenken verzichten.
Divisionale Gliederung
Eine alternative Möglichkeit zur funktionalen Arbeitsteilung stellt die divisionale Gliederung (Spartenorganisation) dar: Die Bildung von Organisationsbereichen erfolgt dabei nicht nach Tätigkeiten, sondern nach Objekten der Arbeit. Das können bestimmte Leistungsbündel (Produkte), Regionen oder Kundengruppen sein. Jede dieser Sparten ist in ihren Tätigkeiten weitgehend selbstständig und nur lose (z. B. über Ergebnisverantwortung) an die Gesamtorganisation gebunden.
Der entscheidende Unterschied zwischen funktionaler und divisionaler Struktur ist die Dezentralisierung des Vertriebs und damit die Möglichkeit der Ertrags-Zurechnung auf die einzelnen Organisationsteile. Sparten sind in der Lage, eigene Erträge zu erwirtschaften, verfügen also über Vertriebskompetenz. Folgende Stärken und Gefahren sind für die Spartenstruktur charakteristisch:
- Entlastung der Organisationsspitze in Hinblick auf den Kommunikations- und Koordinationsaufwand zwischen den einzelnen Divisionen
- hohe Flexibilität bei Umweltveränderungen
- leicht definierbare Kosten- und Ertragsverantwortung, z. B. durch Einführung der Profit-Center-Organisation
- Doppelgleisigkeiten zwischen den Sparten, z. B. im Marketing, können die Wirtschaftlichkeit beeinträchtigen.
- erhöhter Leitungsaufwand in Bezug auf den Zusammenhalt der Gesamtorganisation
Diese beiden Gliederungsmöglichkeiten können auf Organisationsebene ebenso wie auf der Ebene der Arbeitsorganisation zur Anwendung kommen: In Spitälern z. B. besteht auf Organisationsebene formal eine Art der funktionalen Gliederung, die sich an den hauptbeteiligten Berufsgruppen festmacht. Die Pflegearbeit auf Stationsebene kann entweder funktional organisiert sein, d. h. jede*r Pfleger*in erbringt einzelne Tätigkeiten an allen Patient*innen (Funktionspflege) oder objektorientiert, sein d. h. jede*r Pfleger*in oder ein Team betreut einige wenige Patient*innen umfassend (Gruppenpflege).
Stabliniensystem
Ein Stab ist eine Organisationseinheit, die Informations-, Beratungs- und Kontrollfunktionen für eine oder mehrere ihr zugeordnete Abteilungen wahrnimmt. Ein Stab besitzt keine Entscheidungsbefugnis, sondern soll die zugeordnete „Linienabteilung“ von bestimmten Aufgaben entlasten (z. B. strategische Planung, Betriebsorganisation, Public Relations). Ohne „Linie“ also kein Stab - daher spricht man in diesem Zusammenhang auch meist von der Stablinienorganisation. Stabsabteilungen sind häufig oberen Hierarchieebenen zugeordnet, da diese bei funktionaler Arbeitsteilung besonders stark belastet sind. Stabsstellen üben keine direkte Macht auf andere Linienabteilungen aus. Sie agieren regelmäßig indirekt über die zugeordnete Linienabteilung mit Hilfe von Analysen und Empfehlungen. Das Prinzip der Einheit der Auftragserteilung und der Leitung bleibt damit auch bei der Einführung von Stäben erhalten.
Von „Stabsgeneralist*innen“ spricht man, wenn Stabsstellen die Linienabteilung von unterschiedlichen Detailarbeiten entlasten sollen (z. B. Direktionsassistenz). „Stabsspezialist*innen“ dagegen sind mit der Erfüllung einer bestimmten Teilaufgabe betraut (z. B. Rechtsfragen, Public Relations). Diese Stellen stehen meist allen Abteilungen zur Unterstützung zur Verfügung und sind lediglich formal einer Stelle - meist der Unternehmensleitung - zugeordnet.
Stärken des Stabliniensystems:
- potenzielle Entlastung der Linienabteilung
- Steigerung der Entscheidungsqualität durch intensivere Vorbereitung
- flexible Handhabung: Die Einführung greift nicht in die bestehende Grundstruktur der Organisation ein.
- breiter Anwendungsbereich hinsichtlich Aufgaben und hierarchischer Zuordnung
- Aus personalpolitischer Sicht eignen sich Stabsfunktionen vielfach als Vorbereitung auf künftige Linienfunktionen.
Schwächen des Stabliniensystems:
- Kompetenzkonflikte zwischen Linien- und Stabsabteilungen, insbesondere wenn die Stabsstelle versucht, direkte Macht auf ihr nicht zugeordnete Linienabteilungen auszuüben.
- Gefahr der Isolierung der Stabsstellen. Diese Gefahr besteht bereits aufgrund der besonderen Rolle als „rechte Hand“ einer Linienabteilung, ihrer undeutlichen De-facto-Machtposition und der Distanz zum betrieblichen Geschehen (Vorwurf der „Praxisferne“). Dies kann dazu führen, dass der Stab diejenige Stelle ist, die eigentlich Bescheid weiß, ohne direkt entscheiden zu können, die Linie dagegen entscheidet, ohne wirklich Bescheid zu wissen.
Stablinienorganisationen sind in größeren Organisationen weit verbreitet. Ihre (de-facto-) Machtposition lässt sich aufgrund eines Organigramms nur schwierig abschätzen. Diese hängt maßgeblich von den beteiligten Handlungsträgern in Stab und Linie und vor allem von der Qualität der Beziehung zwischen diesen Personen(gruppen) ab.
Matrixstruktur
Die Matrixorganisation beruht auf der Verknüpfung unterschiedlicher Dimensionen der Arbeitsteilung, womit die Eindeutigkeit der Unterstellung aufgegeben wird. In einer Matrixstruktur haben Organisationsmitglieder mindestens zwei Vorgesetzte (Mehrlinienmodell). Meist ist dies der*die funktionale Vorgesetzte der jeweiligen Fachabteilung und ein*e Verantwortliche*r für ein bestimmtes Produkt oder eine Dienstleistung, an deren Erstellung mehrere Fachabteilungen beteiligt sind. Seine*ihre Aufgabe besteht in der Koordination dieser Abteilungen auf „sein*ihr“ Produkt hin. Dadurch entsteht eine enge Integration der beiden Dimensionen. Charakteristisch für die Matrixstruktur ist die Mehrdeutigkeit.
Die Matrixorganisation wurde vor allem in größeren Organisationen bewusst ein-geführt, um Erstarrungstendenzen zu begegnen, die vor allem in funktional differenzierten Strukturen häufig auftreten. Durch die Verknüpfung zweier Gliede-rungskriterien werden bewusst Spannungen und Konflikte in die Organisation getragen. Die Auseinandersetzung der Schnittstellen mit unterschiedlichen Interessenlagen mehrerer Vorgesetzter soll zu erhöhter Innovationsfähigkeit und Flexibilität der Organisation führen. An potentiellen Vor- und Nachteilen der Matrixstruktur sind zu nennen:
- erhöhte Innovationsfähigkeit und Flexibilität der Gesamtorganisation
- hohes Problem- und Konfliktlösungspotential in den Schnittstellen
- Betonung der Gruppenarbeit und dadurch Senkung des Fehlerrisikos
- Reibungsverluste durch großen Kommunikationsbedarf und die Konfliktaustragung
- erhöhte Arbeitsbelastung und dadurch Beeinträchtigung der Motivation vor allem bei den Schnittstellen
- erhöhte Komplexität der Gesamtstruktur und Verzögerungen der Entscheidungsprozesse
Die Entwicklung einer Organisation in Richtung Matrix verlangt auch eine personale Entwicklung der beteiligten Organisationsmitglieder, da sich diese in neuen Rollen zurechtfinden und mit den Matrixspielregeln vertraut werden müssen, denn diese Struktur stellt hohe Anforderungen an die interpersonale Kompetenz, Konflikttoleranz und Konfliktlösungsfähigkeit der einzelnen Rollenträger. Insgesamt kann festgestellt werden, dass matrixartige Strukturen Organisationen und ihre Mitglieder stark belasten. Nicht selten überwiegen die Nachteile der internen Konfliktträchtigkeit die Vorteile erhöhter Innovationsfähigkeit. Häufig erweist sich die Matrixstruktur rückblickend als mittel- bis langfristiges Übergangsstadium von einer funktional differenzierten zu einer integrierten Organisation.
Projektorganisation
Projektorganisationen sind Formen der Sekundär- oder Parallelorganisationen. Sie werden parallel zur und mehr oder weniger differenziert von der Primärorganisation eingerichtet, um zeitlich befristete Aufgabenstellungen zu erledigen, welche außerhalb des Regelbetriebes liegen. In ihrer inneren Struktur sind Projektorganisationen deshalb auch eigenständig aufgebaut. Die Kosten für Projekte sind meistens klar definiert [5] . Bei der Projektorganisation stellen sich drei grundlegende Probleme dar:
- Die interne Integration und Differenzierung sind dann problematisch, wenn sich die Kommunikationsnormen und Rollenerwartungen zu stark von denen unterscheiden, die in der Primärorganisation zu erwarten wären. Das Individuum wird dann eine Abwehrreaktion gegen die Sekundärorganisation zeigen. Wenn die Kommunikationsnormen und Rollenerwartungen jedoch zu ähnlich sind, so verliert die Einrichtung einer Sekundärorganisation ihren Hauptzweck [6] .
- Eine solche Abwehrreaktion kann natürlich auch seitens der ganzen Organisation stattfinden. Die Differenz von der Primärorganisation äußert sich in der Abwehr von Neuem durch alte Organisationsmitglieder, kontraproduktivem Verhalten in der Sekundärorganisation, Angst vor Kontrollverlust durch Instanzen der Primärorganisation und Opposition neuer Organisationsmitglieder gegenüber den älteren, im Sinne neuartiger Ideen [7] .
- Die Komplexität des Aufgabengebietes leitet sich allein schon aus der Tatsache ab, dass eine Projektorganisation nur dann eingesetzt wird, wenn die Primärorganisation zur Bewältigung der Aufgabe nicht in der Lage ist. Es handelt sich dementsprechend um schwer zu strukturierende, planende, budgetierende und berechenbare Problemstellungen. Projekte sollen möglichst Unplanbares planbar machen [8] .
Es gibt drei Arten der Projektorganisation. Diese unterscheiden sich vor allem in der Stärke der Differenzierung von der Primärorganisation [9] .
Linien- Projektorganisation
Sie ist die am stärksten von der Primärorganisation differenzierte Form der Projektorganisation. In dieser Projektorganisation gliedert man die Mitarbeiter*innen des Projektes komplett aus der Primärorganisation zeitlich befristet aus und stellt sie in einer neuen Struktur zusammen. Daher nennt man sie auch „reine Projektorganisation“. Der*die Projektleiter*in ist für alle Belange des Projektes, inklusive Finanzierung, Terminisierung, Leistungserstellung und Kapazitäten, einem*einer Vorgesetzten verantwortlich. Problematisch in der Linien- Projektorganisation ist vornehmlich, dass die althergebrachten Hierarchien der Primärorganisation mitsamt ihren Schwächen übernommen werden.
Die Vorteile dieser Organisationsform liegen in der klaren Verantwortlichkeit und der Abgrenzung zur Primärorganisation, der hohen Entscheidungsfindungskompetenz und Flexibilität, der hohen Identifikation aller Mitarbeiter*innen auf deren Aufgabe, sowie einer klaren Zuweisung von Ressourcen zum Projekt. Dem entgegen stehen die Nachteile des Fehlens der Mitarbeiter*innen in der Primärorganisation aufgrund deren Ausgliederung und der damit einhergehenden Mehrbelastung deren Stammabteilungen. Zudem passiert es oft, dass Projektmitarbeiter*innen auf Ressourcen der Stammabteilungen zurückgreifen und damit diese noch zusätzlich belasten. Wenn die Projektmitarbeiter*innen nach Abschluss des Projekts wieder in die Hierarchie der Primärorganisation eingegliedert werden, ergeben sich häufig Probleme, mit dieser Hierarchie klar zu kommen.
Die hauptsächlichen Anwendungsgebiete von Linien- Projektorganisationen sind technologieorientierte Projekte (z.B. Maschinen- und Anlagenbau, Softwareentwicklung), große, gut abgrenzbare Vorhaben, in Integrations- bzw. Assoziationsphasen und zur Erarbeitung von Innovationsstrategien.
Stabs- Projektorganisation
In der Stabs- Projektorganisation ist die Abgrenzung zur Primärorganisation sehr schwach ausgeprägt. Der*die Projektkoordinator*in hat keine Entscheidungsbefugnis, weshalb er*sie voll auf das Wohlwollen der Primärorganisation angewiesen ist. Die Abwehrtendenzen der Primärorganisation sind demnach jedoch kleiner, weil nicht so stark in diese eingegriffen wird. Der*die Projektkoordinator*in nimmt hauptsächlich eine kontrollierende Funktion in Kosten-, Termin- und Leistungsfragen ein. Die Anweisungen zu Änderungen können lediglich aus der Linie der Primärorganisation erfolgen. Daraus ergibt sich eine starke Instabilität und Störungsanfälligkeit.
Der größte Vorteil der Stabs- Projektorganisation ist vor allem deren hohe Flexibilität. Die Einrichtung einer solchen Projektorganisation benötigt wenig Zeit und auch Ressourcen. Zusätzlich muss die Primärorganisation kaum verändert werden. Mitarbeiter*innen können durch die verbleibende Einbindung in die Primärorganisation ihre Kapazitäten besser ausnützen und bei „Stehzeiten“ im Projekt im täglichen Geschäft weiterarbeiten [10] .
Als nachteilig erweist sich zum Einen eine geringe Ausrichtung an dem*der Kund*in. Da der*die Projektkoordinator*in keine Entscheidungskompetenz hat, muss sich der*die Kund*in immer zunächst an die Instanzen der Primärorganisation wenden [11] . Zum Anderen bestehen häufig Konflikte zwischen dem*der Projektkoordinator*in und den Projektmitarbeiter*in, welche dann zu einer Mehrbelastung der Unternehmensleitung führen. Des Weiteren besteht eine starke Ziel- Mittel- Inkonsistenz. Der*die Projektkoordinator*in ist zwar inhaltlich verantwortlich, hat aber persönlich nicht die nötigen Mittel, diese Ziele alleine zu erreichen [12] . Durch die Trennung der Entscheidung von der Verantwortung kommt es oftmals zu Verzögerungen, welche vor allem durch verlängerte Kommunikationswege zu den Entscheidungsinstanzen der Primärorganisation erzeugt werden.
Anwendung finden Stabs- Projektorganisationen vor allem in Veränderungsprojekten (z.B. Personalentwicklung, Organisationsentwicklung, EDV), im Total Quality Management (=TQM), in kontinuierlichen Verbesserungsprozessen (=KVP), im Wissensmanagement als permanente Sekundärstruktur, zur Einbindung interner und externer Berater*innen als Projektkoordinator*innen und bei flexiblem Projektumfang.
Matrix- Projektorganisation
In der Matrix- Projektorganisation ist das Prinzip der Mehrfachunterstellung umgesetzt. Sie ist ein Mittelding zwischen einer Stabs- und Linien- Projektorganisation. Dabei unterstehen die Mitarbeiter*innen dem*der Projektleiter*in in inhaltlichen und dem*der Linienvorgesetzten in Disziplinar- und Personalangelegenheiten. Die Mitarbeiter*innen mehrerer Abteilungen sollen so in einem Projekt integriert werden. Der*die Projektleiter*in ist für die Leistungs-, Finanz- und Terminkomponente des Projektes verantwortlich.
Die Vorteile der Matrix- Projektorganisation liegen vor allem in der offenen Austragung von Konflikten. So können diese rasch einer Lösung zugeführt werden. Dabei soll die Abstimmung zwischen Projektmanager*innen und Abteilungsleiter*innen ohne Zutun der Unternehmensleitung erfolgen.
Als Nachteil ist anzumerken, dass der*die einzelne Mitarbeiter*in zwischen zwei Instanzen steht. Dies kann er*sie zum Einen zu seinem*ihrem persönlichen Vorteil nutzen, indem er einer Instanz eher zugetan ist, zum Anderen kann dies jedoch auch zu Frustration führen, wenn ein Konflikt zwischen den beiden Instanzen nicht selbst ausgetragen oder nach oben übertragen, sondern an den*die Mitarbeiter*in abgeschoben wird [13] . Die Matrix- Projektorganisation findet vor allem Anwendung bei Projekten, die die Zusammenarbeit mehrerer Abteilungen erfordern, schwankenden Auslastungen der Mitarbeiter*innen, marktorientierten Strategien und neuen Kundenerfordernissen, sowie im Key Account Management.
Die prozessorientierte Struktur
Die prozessorientierte Struktur ist eine jüngere Variante der Spartenstruktur, die v. a. in qualitätsorientierten Organisationen zunehmend Eingang findet. Demgemäß zeichnet sie sich durch eine hohe Orientierung am Kundennutzen in Form definierter Qualitätskriterien und eine auf diese ausgerichtete Flexibilität aus. Am Anfang der Prozessgestaltung steht die Identifikation der Kernprozesse, welche aus der Strategie abgeleitet werden und den nachhaltigen Wettbewerbsvorteil des Unternehmens ausmachen. Vom strategischen Kundennutzen ausgehend werden die Prozesse rückwärts bis zur Materialanlieferung gestaltet. Die kundenbezogene Koordinationsverantwortung obliegt einem sogenannten „Process owner“ oder einem*einer Kundendisponent*in. Der gesamte Leistungserstellungsprozess besteht seinerseits aus internen Kunden – Lieferantenbeziehungen mit jeweils definierten Qualitätsmerkmalen. Die Prozesssteuerung erfolgt in der Praxis durch einen intensiven Einsatz moderner Informationstechnologien sowie einfache Modelle der Selbststeuerung wie beispielsweise dem Kanban-Prinzip. In den meisten mittleren Unternehmen lassen sich ca. drei bis neun Kerngeschäftsprozesse definieren und als Profit-Center-ähnliche Verantwortungsbereiche strukturell abbilden. Als Kerngeschäftsprozesse bezeichnet man Prozesse, die durch einen wahrnehmbaren und verkaufbaren Kundennutzen sowie – idealiter – durch Einmaligkeit, Nicht-Imitierbarkeit und Nicht-Substituierbarkeit, also durch strategische Bedeutung für das Unternehmen gekennzeichnet sind. Neben den Kernprozessen existieren im Unternehmen auch Supportprozesse, die unterstützende Aufgaben übernehmen (z. B. Controlling, EDV, Instandhaltung) [14] . Als Vorteile dieser Struktur sind anzuführen:
- hohe Orientierung am Kundennutzen und daher in der Regel größere Preisspielräume
- Verringerung des Umlaufvermögens durch Reduktion der Teilelager
- Abnahme der hierarchischen Steuerung und damit Reduktion der Ebenen
- Empowerment: Mitarbeiter*innen erhalten mehr Entscheidungsbefugnisse
- Verbesserung der Koordination, da die Anzahl der funktionalen Schnittstellen reduziert wird
- Verbesserung der Motivation, da die Leistungen eigenständig erbracht und kundenspezifisch auf die Prozess-Teams zugerechnet werden können [15]
Als Nachteile der prozessorientierten Struktur gelten:
- Verlust von Skalenökonomien durch Dezentralisierung der Teilfunktionen auf die einzelnen Kerngeschäftsprozesse; Insbesondere im Bereich der Maschinenkapazitäten sind regelmäßig Reserven vorzuhalten. Daraus folgt eine erhöhte Kapitalbindung im Anlagevermögen. Weiters ist mit steigenden Rüstzeiten zu rechnen.
- Ähnliches gilt im Bereich der Humanressourcen: Die prozessorientierte Organisation braucht flexible, motivierte und eigenverantwortliche Mitarbeiter*innen, die imstande sind Gesamtprozesse in ihren Zusammenhängen zu verstehen.
- hoher Koordinationsaufwand, der sich v. a. in der Prozessgestaltung, der laufenden Steuerung sowie der kontinuierlichen Verbesserung der Abläufe niederschlägt; dies gilt insbesonders für jene Prozessschritte, die technologisch bedingt mehreren Kerngeschäftsprozessen zugeordnet werden müssen (z. B. Operationssäle, Papiermaschinen, Oberflächentechnologien).
Prozessstrukturen finden ihre Anwendung in Produktions- und Dienstleistungsunternehmen, in Integrationsphasen, zur Implementierung von Qualitätsstrategien und ab einer Größe von ca. 30 Mitarbeiter*innen.
Die Netzwerk- Struktur
ist eine Weiterführung des Kernprozessgedankens über Organisationsgrenzen hinweg. So wie entlang der Kerngeschäftsprozesse eines Unternehmens interne Kunden-Lieferanten-Beziehungen definiert werden, geschieht dies in Netzwerkstrukturen – idealiter – entlang der gesamten Wertschöpfungskette von der Generierung der Produktionsfaktoren bis zur Entsorgung. Die rechtlichen Ausformungen dieser Unternehmenskooperationen reichen von mittelfristigen Lieferverträgen bis hin zu gegenseitiger Kapitalverflechtung. Dazwischen finden sich General- und Subunternehmerschaften, Lizenz- und Franchisingverträge sowie Joint ventures [16] . Als strategische Netzwerke bezeichnet man solche, die auf die Erschließung wettbewerbsrelevanter Potenziale gerichtet sind, überregional agieren und i. a. von einigen wenigen Leitunternehmen strategisch geführt werden [17] . In der österreichischen Wirtschaftspolitik werden darüber hinaus Unternehmens-„Clusters“ eine große Bedeutung für die regionale Prosperität zugeschrieben. Darunter versteht man branchenbezogene Unternehmensnetze wie beispielsweise in der steirischen automotiven Industrie oder im Tourismus. Als Triebkräfte für das Entstehen solcher Netze gelten:
- gestiegene Qualitätsansprüche der Kund*innen bei zunehmenden Flexibilitätserfordernissen (z. B. kürzere Produktlebenszyklen)
- Risiko- und Kapitalstreuung
- Zugang zu neuen Märkten und Technologien [18]
- Konzentration auf Kernkompetenzen bei komplementären strategischen Zielsetzungen
- Transaktionskostenvorteile gegenüber rein hierarchischen oder marktlichen Austauschformen [19] (i. e. Kosten der bürokratischen Koordination bzw. Kosten der Informationsaufbringung, Verhandlung etc.)
Nicht alle vordergründig zweckmäßig erscheinenden Kooperationsbeziehungen führen zum gewünschten Erfolg. Neben betriebswirtschaftlichen Kriterien sind folgende Faktoren für das Gelingen von entscheidender Bedeutung:
- Vertrauen als zentrales Steuerungsmedium bezeichnet die gegenseitige Erwartbarkeit von Entscheidungen und bestimmt ganz wesentlich die Stabilität von Kooperationen.
- Kultureller Fit: Je besser die Wahrnehmungsschematismen von Organisationen, ausgedrückt u. a. in einer gemeinsamen Sprache, zueinander passen, desto eher werden sie zueinander anschlussfähig. Stabile Netzwerkorganisationen brauchen eine gemeinsame Identität bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der eigenen.
- Strategische Kompatibilität: Passen die strategischen Interessen der Partner in Bezug auf die Kooperationsinhalte hinreichend zusammen?
- Operative und prozessuale Passung: In der Ablaufplanung geht es um die rechtzeitige und explizite Festlegung von Regeln, um die Frequenz der unmittelbaren Interaktionen und um die zeitliche Gestaltung der gesamten Informations- und Kommunikationsprozesse zwischen den Partnerunternehmen [20] . Hier stellt sich die Aufgabe, die unterschiedlichen Geschwindigkeiten in jenen Teilbereichen zu synchronisieren, die der Kooperation unterliegen [21] .
Organisationstheoretisch sind Netzwerkorganisationen v. a. interessant, weil sie eigentlich Quasi-Organisationen darstellen und damit völlig anderer Steuerungsformen bedürfen als traditionelle Strukturen wie z. B. die Bürokratie. Heterarchische (partnerschaftliche) Koordinationsformen wie „mutual adjustment“, Vereinbarungen über einige wenige Leitwerte, dezentrale Informations- und Planungsprozesse, gemeinsame Lernorganisationen (z. B. im Rahmen von Total-quality-management-Strukturen) etc. In Netzwerkstrukturen, gekennzeichnet durch wechselseitige Abhängigkeiten, entschwindet gewissermaßen das Steuerungszentrum, und damit die Fiktion einer Instanz, die die Geschicke des Netzwerks lenken könnte.
Anwendungsmöglichkeiten für Netzwerk- Strukturen finden sich vor allem in Produktions- und Dienstleistungsunternehmen (z. B. steirischer Automotive Cluster, touristische Destinationen), in Assoziationsphasen und zur Implementierung von Qualitätsstrategien.
Aufgabe 7
Wenn es Ihnen vor lauter Organisation noch nicht aus den Ohren staubt, dann sind Sie bereit für die nächste Aufgabe: In welchen Organisationsformen waren Sie selbst bisher integriert? Denken Sie an die Schule, an die Lehre, an die Universität, an Ihren ersten Ferialjob, an Nebenjobs an der Uni oder oder oder.
Nun versuchen Sie herauszufinden, welche der bisher angeschnittenen Formen das jeweils war. Es reicht, wenn Sie die Form identifizieren können.
Und weil das nicht genug ist, erinnern Sie sich bitte auch noch an die für Ihr Leben wichtigste Organisation. Wie war diese strukturiert? Sie können auch diejenige nehmen, in der Sie gerade tätig sind. Bitte zeichnen Sie das Organigramm dieser Organisation – natürlich ohne Namen. Und zeichnen Sie sich selbst darin ein. Dann beschreiben Sie bitte kurz a.) die Vorteile, welche durch die Organisationsform für genau dieses Unternehmen entstanden sind und b.) die Nachteile.
Die letzte Frage lautet: Wäre eine andere Organisationsform besser gewesen? Welche?
Entwickungsphasen von Organisationen
Menschen gründen Organisationen, sie betreiben sie, entwickeln sie, leben und leiden in und mit ihnen und sie richten sie auch zugrunde. Organisationen sind menschlich, sie gehören zu uns und wir zu ihnen. Ähnlich wie Menschen z. B. Autos nach biomorphen Modellen bauen (der Motor ist z. B. das Herz, und wenn er stehen bleibt, dann sagen wir „Der Motor ist mir abgestorben“, obwohl er nie gelebt hat, weil er nicht organisch ist. Die Scheinwerfer sind die Augen, deswegen hat jedes Auto zwei und nicht eines oder drei etc.), entwickeln wir auch Organisationen anhand bestimmter Strukturen, die aus unserer eigenen Lebenswelt kommen. Organisationen machen auch bestimmte Phasen durch, und die wollen wir uns in einem Modell näher ansehen. Die folgenden Organisationstypologien beschreiben die Entwicklung von Organisationen im Zeitverlauf. Dabei lassen sich aus unterschiedlichen Blickwinkeln Veränderungen feststellen. Personen treten ein, verändern sich, scheiden aus; neue Technologien kommen zur Anwendung und bedingen Veränderungen der Arbeitsorganisation, Leistungssortimente und Kundengruppen verschieben sich etc. In diesem Abschnitt interessiert die Frage, ob es im Laufe des Bestehens einer Organisation Phasen gibt, in welchen Veränderungsbedürfnisse gebündelt auftreten. Wie lässt sich erkennen, dass eine Organisation in ein krisenhaftes Stadium gerät? In der Organisationsforschung gibt es eine Reihe beschreibender Modelle, die in einer idealtypischen Form Bestehen und Veränderung von Organisationen abbilden. Organisationale Probleme lassen sich nach diesen Modellen in bestimmten, „normalen“ Krisen im Laufe eines „Organisationslebens“ zusammenfassen. Diese Modelle gehen von folgenden Prämissen [22] aus:
- Organisationen tragen eine gerichtete, irreversible, immanente Entwicklungslogik von Gründung in sich. Kontextfaktoren spielen dabei in den meisten Modellen eine untergeordnete Rolle. Meist wird die Umwelt als anonyme Kraft gesehen, die Gestaltveränderungsprozesse der Organisation induziert.
- Die Veränderung von Organisationen besteht aus einer konsekutiven Abfolge von Entwicklungsphasen, d. h. jedes Stadium ist aus den vorangegangenen Bedingungen heraus beschreib- und erklärbar.
- Die einzelnen Entwicklungsstadien sind durch bestimmte „Konfigurationen“ markiert. Dazwischen gibt es mitunter Phasen des Umbruchs, der Krise. Der gesamte Entwicklungsprozess folgt einem biologischen Muster von „Geburt“ über „frühe Reife“ und „Reife“ zum „Tod“. Regenerationen sind dabei jedoch meist vorgesehen.
Das Entwicklungsmodell von Glasl/Lievegoed [23] definiert vier Phasen (Tabelle 4). Den einzelnen Phasen werden dabei jeweils Organisationsmetaphern zugeordnet: Familie, Apparat (Maschine), Organismus und Glied im Biotop. An den Übergängen der Phasen tritt eine Zeit der Neuorientierung der Organisation auf, die zumeist mit krisenhaften Erscheinungen einhergeht.
Pionierphase: Das Unternehmen als Familie oder Stamm
In dieser Phase wird die Unternehmung von der Pionierpersönlichkeit, meist dem*der Gründer,in geprägt. Alles ist rund um einige wenige Personen aufgebaut. Idealiter treten dabei folgende Charakteristika auf:
Image, Sinn und „Leitbild“ des Unternehmens werden geprägt von einer – zumeist nicht ausgesprochenen – „Vision“ der Pionierpersönlichkeit.
- Ziele, Sinn und Zweck der Arbeit sind für jeden deutlich sichtbar.
- Im Pionierbetrieb dominieren Intuition und Fingerspitzengefühl.
- Die Mitarbeiter*innen sind alle direkt dem*der Chef*in unterstellt.
- Die Funktionen wachsen um die Personen herum („Wildwuchs“).
- Das Pionierunternehmen ist wie eine „große Familie“.
- Die Organisationsmitglieder pflegen intensive und direkte Kontakte – sowohl unter sich als auch mit der Umwelt des Unternehmens.
- Der direkte Kontakt der Mitarbeiter*innen mit dem*der Chefin*in ist die Basis für Motivation.
- Die Führung ist charismatisch und autokratisch. Dies wird von den Mitarbeiter*innen im Großen und Ganzen akzeptiert.
- Im Grunde kennt jeder jeden und weiß, welche Bedeutung er im Ganzen hat.
- Es wird kaum geplant, sondern zumeist improvisiert. Dadurch ist das Pionierunternehmen sehr flexibel und effizient.
- Der Kontakt zu Kund*innen ist sehr intensiv und direkt. Man geht grundsätzlich auf alle Sonderwünsche ein und ist den Kund*innen treu. („Der Kunde ist König.“)
- Marketingaktivitäten erfolgen zumeist ungeplant und ohne vorher-gegangene Marktanalysen.
- Das Rechnungswesen ist zumeist nur soweit ausgebaut wie (aufgrund der Steuergesetze) notwendig; d. h., es erfüllt nur dokumentarische Funktionen.
Krisenerscheinungen der Pionierphase: Die Symptome eines überreifen Pionierbetriebes sind Störungen in der Kommunikation: Man hat die Übersicht verloren, es fehlt an orientierenden Strukturen; man weiß nicht mehr, wer wofür zuständig ist. Dadurch wird die Entscheidungsfähigkeit gehemmt, die Wendigkeit der Organisation nimmt ab.
Entscheidungen werden zu lange aufgeschoben, weil man sich in allem der Zustimmung „des alten Herren“ vergewissern will. Die direkte Führung jedoch ist nicht mehr wirksam, weil viele Angelegenheiten komplexer geworden sind. Es lässt sich nicht alles über den Daumen peilen oder aus der direkten Erfahrung heraus beurteilen. Unter den Mitarbeiter*innen treten Kompetenz- und Machtkämpfe auf, Konflikte und Reibungen bleiben dem*der Pionier*in jedoch verborgen. Faktoren, die zu dieser Situation beitragen, sind:
- starkes Wachstum hinsichtlich der Anzahl der Mitarbeiter*innen, des Umfanges der Produktion und der Ausdehnung des Marktes
- Kapitalmangel
- Nachfolgeprobleme
- Emanzipation der Mitarbeiter*innen
Der direkte Übergang von der Pionierphase in die Integrationsphase ist nach ursprünglicher Auffassung des Modells nicht möglich. Das Durchlaufen der Organisationsphase sei zur Erlangung von Erfahrungen erforderlich, ohne die der Weg in die Integrationsphase verschlossen bleibe. Dieser Auffassung entgegenstehende Beobachtungen lassen sich jedoch insbesondere in innovativen Organisationen machen. Dort sind vielfach bereits nach einer relativ kurzen Pionierphase Strukturen zu erkennen, die als Kennzeichen der Integrationsphase gelten: starke Corporate Identity, Teamorganisation, Mitgestaltung der Mitarbeiter*innen etc.
Organisationsphase (=Differenzierungsphase): Das Unternehmen als konstruierter Apparat
In dieser Phase bemüht sich das Unternehmen um Transparenz, Systematik, Logik und Steuerbarkeit. Die Unternehmung soll nach den Prinzipien Mechanisierung, Standardisierung, Spezialisierung und Koordinierung „durchkonstruiert“ werden. Die Organisation wird als steuerbare, beherrschbare und kontrollierbare „Maschine“ angesehen. Dementsprechend steht betriebswirtschaftliches und technisches Denken im Vordergrund. In der Struktur der Organisation findet funktionale Säulenbildung (Verwaltung, Produktion, Verkauf usw.) statt. Abläufe werden weitgehend standardisiert. Weitere Kennzeichen dieser Phase sind:
- produktorientiertes Denken
- Marktforschung
- Bereinigung der Produktpalette (Standardisierung)
- aggressive Marktpolitik und ein anonymer Markt
- ein klares Kommunikations- und Berichtswesen wird installiert
- Analyse von Arbeitsabläufen und Festhalten an formellen Anweisungen
- wirtschaftliche Unternehmensführung
- Statistiken
- Kostenrechnung, Budgetierung, Abweichungsanalysen
Krisenerscheinungen der Organisationsphase
- Erstarrung: Es tritt Beamtenmentalität auf. Verfahren werden wichtiger als Ziele und Ergebnisse.
- Abteilungsdenken: Führungskräfte und Mitarbeiter*innen, die Sinn, Ziel und Zusammenhang des Ganzen nicht mehr sehen oder erleben, ziehen sich in die eigene Abteilung zurück und bringen kein Verständnis für den*die Nachbar*in auf (horizontal und vertikal).
- Koordinationsschwierigkeiten: Die Abteilungsbezogenheit (unzureichende horizontale Kommunikation) führt dazu, dass der Aufwand, um alles koordinieren zu können, stets größer wird („Papierkrieg“).
- Zentrale Führung: Die vertikale Kommunikation wird immer mehr beansprucht und überfordert. Verantwortung wird nach oben geschoben, weil man auf den unteren Ebenen mangels Einsicht die Verantwortung scheut. Dies führt zu einer Konzentration der Verantwortung bei höheren Ebenen und damit zurück zur „Kopflastigkeit“ der Pionierphase.
- Stab-Linien-Differenzen: Die Stab- und Linienkonzeption, die anfänglich zu klaren Aufgaben und Befugnissen geführt hat, kann dazu führen, dass der*die Stabsangehörige der*diejenige ist, der eigentlich Bescheid weiß, ohne direkt entscheiden zu können, und der*die Linienchef*in entscheidet, ohne Bescheid zu wissen.
- Motivationsprobleme aufgrund der Zersplitterung der Aufgaben, der vielfältigen Regelungen und der hierarchischen Prinzipien;
- Durch überkonsequente Spezialisierung fühlen sich die Mitarbeiter*innen als Nummern, als anonyme Räder der „Organisationsmaschine“ und verhalten sich auch so. Durch das einseitige technische Denken ist der menschliche Aspekt vernachlässigt worden.
Integrationsphase: Das Unternehmen als lebendiger Organismus
Um aus der Erstarrung zu kommen, die sich in der überreifen Organisationsphase verbreitet hat, müssen die Beziehungen zwischen Menschen, Gruppen (Abteilungen) und größeren Einheiten neu gestaltet werden. Das Bild der Organisation in der Integrationsphase lässt sich folgendermaßen beschreiben: [24]
- Das Handeln der Organisationsmitglieder orientiert sich nicht primär an der produzierten Leistung, sondern am Problem des*der Kund*in.
- In die Entwicklung eines gemeinsamen Selbstverständnisses (Leitbild, Corporate identity, „Mission“) wird viel investiert. Dabei übernehmen die Mitarbeiter*innen eine aktive Rolle.
- Das Gesamtunternehmen wird in kleine, eigenverantwortliche Einheiten strukturiert. Zentrale Stabsstellen reglementieren nicht, sondern bieten Dienstleistungen an, die es den einzelnen Einheiten erlauben, ihre Eigenverantwortung besser wahrzunehmen.
- Die Führung ist unterschiedlichen Anforderungen und Möglichkeiten angepasst und begünstigt Teamarbeit sowie eine hohe Beteiligung der Mitarbeiter*innen an Entscheidungen, aber auch am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens. Durch ständige Schulungs- und Entwicklungsmaßnahmen wird die Entfaltung der Mitarbeiter*innen und damit die Entwicklung des Unternehmens gefördert.
- Mensch und Arbeit stehen nicht in Gegensatz zueinander, sondern befruchten einander.
- Die Mitarbeiter*innen sind nicht auf reine Ausführungshandlungen beschränkt, sondern gestalten Aufbau- und Ablauforganisation mit. Nur dadurch können sie auch mit verantworten.
- Die kleinen organisatorischen Einheiten richten sich auf eigene Produktgruppen oder Marktsegmente. Die Organisation wird dadurch flexibel und kundenbezogen gestaltet.
- Innovationen finden auf Basis von Marketingkonzepten statt.
- Das Rechnungswesen dient dem Unternehmen als Informationsquelle für Entscheidungen.
Assoziationsphase: Das Unternehmen als Glied im Biotop
In einer Überarbeitung am Beginn der neunziger Jahre wird das Modell um eine vierte Phase erweitert, die den Blick auf die Handhabung der Organisationsumwelt lenkt [25] . Konzentrieren sich die Beschreibungen der Integrationsphase noch stark auf das organisationsinterne Geschehen, geht es im Rahmen der „Assoziationsphase“ vor allem um die Vernetzung von Organisationen mit den Umwelten. Mit Assoziationen sind dabei längerfristige Kooperationen mit anderen Organisationen gemeint: In Forschung und Produktentwicklung, mit Lieferant*innen, in der Produktion und mit Vertriebspartner*innen. Wie in der Integrationsphase Netzwerke der internen Zusammenarbeit geflochten werden, geschieht dies nun auf überbetrieblicher Ebene. Die Grenzen der Organisation verschwimmen zunehmend: Organisationsinterne Kund*innen sollen im Wert überbetrieblichen Kooperationspartner*innen gleichgestellt sein, Funktionen, die nicht nahe dem eigenen Leistungserstellungsprozess sind, werden anderen Unternehmen übertragen (Outsourcing), Vertriebspartner*innen werden als wichtiger Zugang zu Kunden*innen gesehen. Zweifellos ist mit der zunehmenden Bedeutung und Handhabung der überbetrieblichen Zusammenarbeit ein zentraler Trend in der Organisationsforschung angesprochen. Mit Glasl/Lievegoed lassen sich folgende Charakteristika der Assoziationsphase zusammenfassen:
- Ausrichtung der Organisationsstrukturen an definierten Kern- und Zulieferprozessen;
- Intensive Zusammenarbeit mit anderen Organisationen erfordert eine fast ständige Arbeit an der eigenen Identität. Die Position im Unternehmensnetzwerk wird über den Nutzen der Zusammenarbeit in Dialogform definiert;
- Durchlässige Grenzen der Organisation, interne und externe Vernetzung relativ selbststeuernder Bereiche, Nahtstellenorgane (z. B. Auftragsprozessmanager*in) mit Externen;
- Fördernde Personalpolitik, Personalentwicklung auch organisationsübergreifend, externe Jobrotation sowie Teamarbeit;
- In der Ablauforganisation erweitertes Prozessdenken, Selbststeuerung, Nahtstellen-Management, Verzicht auf Pufferzonen und Sicherheitsnetze („Just in time“);
- Integration von Mensch und Technik, möglichst sparsamer Einsatz von Raum und Kapital.
Mit Ausnahme des nach außen gerichteten Fokus lassen sich jedoch auch viele Merkmale der Integrationsphase in die Assoziationsphase übertragen. Sehr radikal scheint der Übergang von einem „lebenden Organismus“ zu einem „Glied im Biotop“ nicht zu sein. Bezeichnenderweise wird auch zwischen den beiden Phasen keine weitere Organisationskrise beschrieben.
Aufgabe 8
Denken Sie an die Organisation, in der Sie gerade arbeiten oder an die letzte, in der Sie tätig waren. Sie können auch eine andere aus der Vergangenheit nehmen, etwa eine, in der Sie besonders gerne tätig waren. Folgende Fragen sind hier interessant:
1.) Welche der Phasen waren dort erkennbar? In welcher Phase hat sich das Unternehmen gerade befunden oder befindet sich derzeit?
2.) Gab es eine Krise, die auf einen Phasenwechsel hindeutet? Wie sah diese aus und wie wurde sie gemeistert?
Organisationstypen
Nach den Phasen sehen wir uns jetzt noch die Typen an. Auch sie sind sehr „menschlich“ und lassen sich in mehr oder weniger allen Organisationen finden. Das hier vorgestellte Modell knüpft an bekannte Begrifflichkeiten an: Bürokratie, Projekt und Adhocratie. Nun werden diese Begriffe jedoch für die Charakterisierung von Organisationen verwendet und um einen weiteren ergänzt: Die Expedition.
Typ 1: Bürokratische Struktur
Bürokratien haben bekanntlich ihre Stärke in der Stabilität. Die Mächtigkeit stabilisierender Strukturen gegenüber den Ideen Einzelner ist theoretisch wie empirisch einleuchtend. Wer jemals versucht hat, eine Bürokratie zu organisieren, kennt die Kraft dieser Strukturen. Der Zugang Niklas Luhmanns, die Personen außerhalb des Systems zu sehen, eröffnet uns erst den klaren Blick auf die Strukturen. Bürokratien sind Sozialstrukturen miteinander verknüpfter Positionen. Bürokratien sind der Prototyp nichtlernender Organisationen. Dort sind die Personen vergleichsweise weit „draußen“. Daher sind die Strukturen dominant und mit den innengerichteten Zielen Selbstreproduktion und Existenzsicherung (Wachstum) beschäftigt. Organisationsstrukturen sind enttäuschungsresistent. D. h. sie werden auch im Enttäuschungsfall aufrecht erhalten. Damit sind Strukturen, insbesondere normative, grundsätzlich lernresistent. Personen haben diese Positionen regelkonform auszufüllen. Wie kann aber das Positive an der Bürokratie erhalten werden und sie gleichzeitig mobilisiert werden? Eine Voraussetzung dafür ist die Erfahrung der Organisation, dass es auch andere Modalitäten des Funktionierens gibt: In anderen Organisationen, in anderen Kontexten der eigenen Organisation wie z. B. in Projektteams. Zur Gewinnung derartiger Erfahrungen braucht es „neue Räume“, also Gelegenheiten, andere Organisationen und andere Denkweisen kennenzulernen bzw. zu entwickeln: Exkursionen zu anderen Organisationen, neue Aufgabenstellungen in nichtbürokratischen Strukturen, Großgruppenveranstaltungen etc. Am Ende dieses Entwicklungsprozesses steht eine Bürokratie, die zwischen unterschiedlichen Funktionsweisen differenzieren kann und erkennt, in welcher Situation welcher Modus vivandi angemessen ist. Empirisch lassen sich derartige Bürokratien beispielsweise in der Flugsicherung beobachten. Im Routinebetrieb ist der Lotse an strikte, bürokratische Procedere gebunden. Im Gefahrenbetrieb übernimmt der Lotse Eigenverantwortung und Autonomie zur Gefahrenbewältigung. Bei akuter Gefahr, z. B. zwei Flugzeuge befinden sich auf Kollisionskurs, ist der*die Lots*in völlig frei in seinen Entscheidungen mit dem Ziel, die Kollision zu verhindern. Die entwickelte Bürokratie setzt ihre Stärken dort ein, wo sie effektiv werden und hält aber auch andere Strukturen und Prozesse für Nicht-Routine-Situationen bereit. Diese lassen sich aus den drei anderen Organisationsmodellen ableiten.
Woran man eine Bürokratieorganisation erkennt
Bürokratien pflegen eine genau geregelte Etikette. Das äußert sich nicht nur in klar definierten Kommunikationsstrukturen sondern auch in der Bekleidung, den Umgangsformen und sogar bei den Büroausstattungen. Oft verfügen Bürokratien über eigene Möbelausstattungsklassen: in manchen Organisation lässt sich die Bedeutung einer Person an den Fensterachsen messen. Titelhierarchie, Status und die Dauer der Zugehörigkeit sind Charakteristika einer Bürokratie. Bürokratien geben klare Orientierung, sowohl für den*die Mitarbeiter*in als auch für den*die Kund*in. Beide werden geführt durch klare Entscheidungsstrukturen und formalisierte Regelkomplexe. Man weiß, woran man ist, man hat das Gefühl jeder weiß, was er*sie zu tun hat und wie er es zu tun hat. Bürokratien wecken Vertrauen und vermitteln Kompetenz, wie zum Beispiel gut geführte Fluglinien, welchen man sich als Passagier*in mit gutem Gewissen anvertrauen kann. Bürokratien stehen für Regelmäßigkeit, sie erwecken den Anschein als könnten sie ewig leben. Sie haben eine Vorliebe für Dokumentation und Akten und sind in der Lage, nach einer Unterbrechung und einer außerplanmäßigen Störung sofort wieder zu ihrem vertrauten Routinemodus zurückzukehren. Beispiele für Bürokratieorganisationen sind Fabriken mit Massenproduktion, öffentliche Verwaltungsorganisationen, die eine hohe Anzahl an Routinefällen zu bearbeiten haben, Fast-Food-Ketten, aber auch Flughäfen und –linien, Kernkraftwerke sowie meist auch Versicherungen und Banken.
Die Stärken und Schwächen der Bürokratieorganisation
Wenn ein Sturm aufzieht, sind Bürokratien meist nicht die ersten Organisationen, die zusammenbrechen. Sie sind in ihren Strukturen in der Regel nicht flexibel, aber stark. In einem Sturm sind sie wie Pyramiden: Diese laufen nicht weg, passen sich in ihrer Form nicht an und haben mit dieser Strategie schon viele Stürme überlebt. Gefährlich wird es für die Pyramide erst, wenn sich versteckte Risiken in ihr befinden: morsches Gebälk, verdeckte Finanzlöcher, usw. In diesem Fall deckt die Krise diese Schwächen auf und kann zu einer existenziellen Bedrohung für die Pyramide werden. Die Bürokratie ist eine entwickelte Organisation. Sie ist in ihrer Struktur nicht schnell aus der Ruhe zu bringen. Dazu bedarf es vielmehr nicht krisenadäquater Führungsentscheidungen. Neuartige Situationen werden für Bürokratien erst zum Problem, wenn sie zu nachhaltigen Änderungen des Umfeldes führen, die Anpassungen und Neuentwicklungen erfordern. In diesem Fall wird die Schwäche der geringen Anpassungsfähigkeit bedrohlich. Achtsamkeit – das Gegenteil von Aktionismus – ist eine Stärke der Bürokratie, weil Bürokratien von Natur aus vorsichtig sind. Auch Besonnenheit – das Gegenteil von Beschleunigung – zählt grundsätzlich zu den Stärken der Bürokratie. In Krisen sind Bürokratien gut beraten, ihre Stärke der Achtsamkeit und Besonnenheit weiter zu betonen. Bürokratien haben mehr als andere Organisationen einen Hang zur Regression in überkommene Kulturmuster. Bürokratien sind einerseits gekennzeichnet von gegenseitiger Loyalität zwischen Mitarbeiter*innen und Organisation. Dies ermöglicht diesen Organisationen eine gute Ausgangssituation hinsichtlich des Commitments. Bürokratien besitzen aber andererseits auch eine Tradition der Kontrolle und des Misstrauens. Das in Kontrollprozessen jahrelang angesammelte Wissen über die Mitarbeiter*innen ist auch geeignet als Munition gegenüber den eigenen Leuten. Damit lässt sich eben dieses Commitment auch rasch und wirkungsvoll zerstören.
Typ 2: Adhocratische Struktur
Adhocratien sind in mehrfacher Hinsicht gegensätzlich zu den Bürokratien. Es sind flüchtige, aber sehr flexible Sozialsysteme. Sie sind in hohem Maß personenabhängig und wenig strukturiert. Wenige handlungsmächtige Strukturen und große Freiheitsgrade für das (Anders-)Handeln der Personen kennzeichnen diese Organisationen. Daraus bezieht sie ihre Stärke, die Innovationskraft. Damit begibt sich die Adhocratie aber auch als soziales System an den Rand des Abgrunds: Je weiter sie die Handlungsautonomie ihrer Mitglieder zulässt, umso schwächer werden die Systemstrukturen, umso weniger lernt sie als Organisation. Sie leistet im Erfinden neuer Lösungen. Genau betrachtet leisten dies aber nicht die Strukturen, sondern die handelnden Personen. Die offenen Strukturen ermöglichen lediglich den Erfindergeist der Menschen und Teams, die darin tätig sind. In Adhocratien passiert also viel individuelles und wenig organisationales Lernen. So bleiben Adhocratien vielerorts lose strukturierte und sehr fragile Ansammlungen von Individuen, die sich schwer tun, organisationales Lernen zu generieren, obwohl sie in operativen Themen sehr beweglich und lernfähig sein können. Darin liegt aber auch die Crux adhocratischer Strukturen: Wie kann es gelingen, personale Lernprozesse zu organisationalisieren? Wie kann die adhocratische Organisation als solche lernen? Wie können beispielsweise die Einsichten aus einem Lernraum [26] , aber auch Projekterfahrungen in die Strukturen und Prozesse der Organisation Eingang finden? In lernenden Organisationen geht es um das Entdecken neuer Spiele statt um das Spielen der bestehenden. Sie bedienen sich der Mitglieder mit ihren Mustern, Ideen, Potenzialen, Wünschen und Ängsten. Im Gegenzug sind sie in der Lage, ihren Akteur*innen aber die Erfahrung höherer Lernebenen als jene, die sie als Personen erreichen könnten, zu ermöglichen. Die Entwicklung einer Adhocratie zu einer lernenden Organisation hängt von der Entwicklung der Beziehungen zwischen den Personen ab.
Woran man eine Adhocratieorganisation erkennt
Adhocratien sind wie erwähnt gegensätzlich zu Bürokratien. Adhocratien verzichten auf Statussymbole und klare Strukturen. Sie sind gekennzeichnet durch Durcheinander und Unklarheit. Wer auf eine Adhocratie trifft, der spürt das Engagement der Mitarbeiter*innen, erkennt aber nicht genau, nach welchem Plan sie agieren und wie die einzelnen Handlungen zusammenspielen. Das Büro einer Adhocratie sieht ein bisschen aus wie eine Garagenwerkstatt. Es ist typischerweise eng, man hat einander gut im Auge, die Wege sind kurz und eine soziale Differenzierung ist kaum erkennbar. Auf den ersten Blick weiß man nicht, wer hier Chef*in ist und wie die Hierarchien geregelt sind – wenn sie es überhaupt sind. Es herrscht ein zwangloser und legerer Umgang. Individualismus wird großgeschrieben. Die Adhocratie ist eine unkomplizierte Organisation für hochkomplizierte und komplexe Problemstellungen.
Die Stärken und Schwächen einer Adhocratieorganisation
Wenn ein Sturm aufzieht, dann ist die Adhocratie wie ein junger Baum der sich hin und her biegt aber nicht bricht. Der Baum kann den Sturm überstehen, weil er flexibel genug ist, sich im Sturm flach zu machen und anzupassen. Wenn aber der Sturm zu stark ist und nicht mehr zu Ende geht, dann bricht auch der junge Baum oder wird ausgerissen. Im Gegensatz zu den bürokratischen „Pyramiden“ sind die Adhocratien aber strukturell nicht sehr stabil. Die Stärke der Adhocratie ist vielmehr ihre jugendliche Dynamik und Anpassungsfähigkeit. Sie ist grundsätzlich flexibel, sie ist dynamisch, sie ist aufgeschlossen, also das Gegenstück zur Innovationsfeindlichkeit. Sie neigt auch nicht zur Regression in starke überkommene Kulturmuster, weil sie über solche kaum verfügt. Sie verwendet wenig Ressourcen und Energie für sich selbst, weil sie den Großteil ihrer Energie dem Erfinden von Problemlösungen zuführt. Adhocratien sind von Natur aus aktionistisch und neigen zu Beschleunigung. Sie sind es gewohnt, auf Zuruf zu funktionieren und auftretende Probleme rasch zu lösen. Dies kann in einer Krise zu überstürzten Entscheidungen mit verhängnisvollen Folgen führen. Commitment – das Gegenteil von Aggression – ist eine Stärke der Adhocratie. Sie ist nicht durch definierte Prozesse und Kontrollschleifen gekennzeichnet. Stattdessen funktioniert sie hauptsächlich über Vertrauen. Die persönliche Beziehung steht im Vordergrund. In schwierigen Situationen müssen Adhocratien versuchen, ihre Stärken zu bewahren.
Typ 3: Die Projektstruktur
Die Projektstruktur hat im Gegensatz zur Bürokratie unscharfe Grenzen. Die Mitgliedschaft zu dieser Struktur ist meist unklar. Die fließenden Außengrenzen sind durch klare Formalstrukturen (z. B. Aufgabenfestlegungen) und ein identitätsstiftendes Werte- und Normengefüge „dicht“ zu machen. „Damit ein System seine Existenz sichern und überleben kann, muss es wissen, wer dazu gehört und wer nicht.“ [27] Dieses Problem haben die Projektstrukturen mit den Adhocratien gemeinsam. Der Schlüsselerfolgsfaktor ist die gemeinsame Identität, die Projektkultur, der Spirit, der imstande ist, das temporäre Sozialsystem der Projektstruktur von der Umwelt abzugrenzen. Es gibt unterschiedliche Ausprägungen dieser Strukturen. Demnach ist die skizzierte Grundproblematik auch unterschiedlich ausgeprägt. Die Linien-Projektstruktur (auch „reine Projektstruktur“ genannt) ist zusätzlich gekennzeichnet von Regeln und Prozeduren. Diese Form, in der die Mitarbeiter*innen meist zeitlich und räumlich konzentriert mitwirken und die Leitung volle Entscheidungskompetenz besitzt, kommt in ihrer Charakteristik eher der Bürokratie nahe. Man trifft diese Form der Projektstrukturen z. B. in der Forschung und Entwicklung. Die Stabs-Projektstruktur (auch „Einfluss-Projektstruktur“ genannt“) dagegen ist von besonders unscharfen Grenzen und einer besonderen Fragilität, aber auch einer besonderen Flexibilität gekennzeichnet. Diese Struktur hat gegenüber den entscheidenden Strukturen beratenden Charakter. Die Funktionen werden „nebenamtlich“ von betroffenen Mitgliedern und Expert*innen besetzt, die die Projektaufgaben neben ihrer angestammten Aufgabe übernehmen. Die Leitung besitzt lediglich Koordinationsfunktion, verfügt aber nicht in vollem Umfang über die Personalressourcen. Dadurch ist die Struktur fragil. Sie ist von der Stärke der Auftraggeberbeziehung und von der Autorität der Projektverantwortlichen (z. B. Organisationsentwickler*innen) abhängig. Umwelt des Stabsprojektes ist zuerst die Stammorganisation. Nichtsdestotrotz gibt es auch Organisationen, die weitgehend aus Stabs-Projekten bestehen wie zum Beispiel große Unternehmensberatungen.
Woran man eine Projektstruktur erkennt
Projektorganisationen nehmen in einem unterschiedlichen Verhältnis sowohl Elemente der Bürokratie, als auch der Adhocratie in sich auf. Einerseits sind sie technokratisch und von klaren Regeln durchzogen, andererseits sind sie durch eine Vertrauenskultur und einer starken Abhängigkeit von individuellen Kompetenzen gekennzeichnet. Der Grundproblematik der Projektorganisation liegt darin, das Unplanbare planbar machen zu sollen. Man erkennt sie daher auch an Planungsinstrumenten wie Charts, Tafeln, Zeitreihen und Terminplänen. Ihre Kommunikation ist formalisiert richtet sich aber an viele wie zum Beispiel durch einen regelmäßigen Newsletter oder ein schwarzes Brett.
Die Stärken und Schwächen der Projektstruktur
Wenn ein Sturm aufzieht, dann ist die Projektstruktur wie eine Yacht. Ein*e gute*r Kapitän*in, der achtsam und besonnen reagiert, kann auch in einer Krisensituation einiges retten, vorausgesetzt er*sie war auf solche Situationen gut vorbereitet und hat die richtige Ausrüstung mitgenommen. Er*sie rafft die Segel, räumt alles unter Deck, was nicht niet- und nagelfest ist und macht die Luken dicht. Die Projektstruktur ist in einer Krise nicht von vornherein verloren. Ihre Gefahr ist, dass sie nur in einem begrenzten Korridor, den sie nicht verlassen kann, flexibel ist. Eine Yacht ist stets an das Meer gebunden. Eine ihrer potenziellen Stärken ist die stark entwickelte Kultur. Projektorganisationen wurden bereits durch klare Regeln und Prozesse zusammengestellt. Das verschafft ihnen eine gute Ausgangsituation. Sie neigen nicht zu Aktionismus und gehen in der Vorbereitung achtsam und besonnen vor. Gefährlich ist ihre Neigung zu einem „optimalen Weg“, den sie in der Vorbereitung festlegen und dann in der Umsetzung möglichst schnell durchfahren wollen. Dies kann sie unflexibel machen und unterscheidet Projektstrukturen auch grundsätzlich von Expeditionsorganisationen: Eine Expedition braucht immer mehrere mögliche Wege und darf sich nicht lediglich auf einen festlegen. In der Umsetzung mangelt es Projektorganisationen oft an Achtsamkeit und Besonnenheit, sie können aktionistisch werden und neigen mit dem häufigen Hintergrund einer Terminfrist zu Beschleunigung. In der Planungsphase sind Projektstrukturen sehr kreativ und allem Neuen gegenüber aufgeschlossen. In der Umsetzungsphase hingegen neigen sie zu innovationsfeindlichem Verhalten und lehnen aus Termintreue Neues oft ab, ganz besonders, wenn es von außen kommt. Eine Projektstruktur hat starke Teams, das Commitment ist hoch und eine Kultur des Vertrauens prägt die Organisation.
Exkurs: Die Expeditionsmetapher
„Expedition“ heißt, als Erste*r einen Weg zu gehen. Eine erfolgreiche Expedition braucht fünf Komponenten:
- Eine Person mit einer Idee, die Andere begeistert: Das Resultat muss sich nicht mit der ursprünglichen Idee decken. Es kann bei Expeditionen vorkommen, dass man Amerika entdeckt hat, während man sich in Indien wähnt. Diese Qualität der inhaltlichen Offenheit der Ziele ist ein wesentlicher Grundsatz der Expeditionsperspektive, der demzufolge auch den drei gegenständlichen Expeditionsräumen gemeinsam ist. Der Expeditionsleader gibt Sicherheit und Vertrauen. Er begrenzt Räume und ermöglicht dadurch die rekursive Bildung von Regeln anstatt sie vorzugeben.
- Bestimmte Ressourcen, die von einem*einer Mentor*in bereitgestellt werden: Der*die Mentor*in muss an die Idee glauben, um die erforderlichen Ressourcen bereit zu stellen.
- Eine Vielfalt an Fach- und Managementkompetenz: Eine gute Vorbereitung reduziert die Gefahren des Scheiterns und erschließt alternative Handlungsräume statt sie einzuschränken.
- Verantwortliche Mitspieler*innen, die sich loyal zur Idee und motiviert einsetzen: Expeditionen brauchen erfahrene und kompetente Mitspieler*innen (z. B. Navigator*innen). Diese Handlungsträger*innen tragen nicht nur mit ihrer Fachkompetenz zum Erfolg bei, sondern ermöglichen durch ihre Systemkompetenz auch Anschlussfähigkeit an bestehende soziale Strukturen. Eine längerfristige, qualifikationsorientierte Personalpolitik ist eine gute Voraussetzung für Organisationslernen. Nachwuchsförderung ist Zukunftssicherung (z. B. Schiffsjungen, Lehrlinge). Diese Handlungsträger sichern den Zufluss neuer Gedanken und Irritationen.
- Glück: Expeditionen behalten aber auch stets eine hohe Risikokomponente in Bezug auf die Zielerreichung. [28]
„Eine Expedition ist eine zeitlich begrenzte Reise, die von mehreren Menschen zur Wahrnehmung einer komplexen Aufgabenstellung mit einer bestimmten Zielsetzung durchgeführt wird. Dabei betritt das Expeditionsteam ein ihm in wenigstens einem Aspekt unbekanntes Gebiet. In ihrem Verlauf ist die Expedition verschiedenen sich ändernden Umwelteinflüssen und schwer kalkulierbaren Risiken ausgesetzt. Das Expeditionsteam versucht sich dabei stets einen größtmöglichen Handlungsspielraum zu erhalten. Hinsichtlich der Gesamtheit aller Faktoren, die eine Expedition ausmachen, ist jede Expedition für sich genommen einzigartig.“ [29]
Typ 4: Die Expeditionale Struktur
Die Metapher der Expedition zeigt die Ambivalenz von Innovation und Bewährtem besonders deutlich. Eine Expedition ist dem Ziel nach aufs Unbekannte gerichtet. Die Zielerreichung hängt jedoch maßgeblich von der Nutzung des Bewährten ab. Expeditionale Strukturen sind daher durch ein Sowohl-als-auch gekennzeichnet. Sie integrieren adhocratische und bürokratische Elemente.
| Keine Expedition findet ohne Idee, Vision statt. | Keine erfolgreiche Expedition findet ohne Planung statt. |
|---|---|
| Expedition ist definiert als ein Weg, den noch niemand beschritten hat. | Expedition braucht die Minimierung des Neuartigen (z. B. durch den Einsatz bewährter Technologien). |
| Expedition braucht Innovation und Mut. | Expedition braucht Erfahrung und Loyalität. |
| Freiheit | Disziplin |
| Persönliche Nähe im Team | Klare Kommandostrukturen |
Eine Expeditionsstruktur hält zumindest zwei modi vivandi vor: einen eher bürokratisch charakterisierten Routinebetrieb und einen eher adhocratischen Betrieb im Ausnahmefall. Wenn also organisationales Lernen, Kreativität, Ändern im Vordergrund steht, agieren die Personen innovativ in das System hinein, denn nur durch ihr verändertes Systemhandeln können neue Strukturen, also Organisationsveränderungen entstehen. Wenn dagegen verlässliche Durchführung, Sicherheit und Präzision im Vordergrund stehen, rücken die Personen wieder in den Hintergrund ab, lassen der selbststabilisierenden Struktur den Vorrang und führen das Vorgegebene aus. Die Grenze des Systems zu ihrer „inneren Umwelt“ ist also gewissermaßen perforiert. Strukturell bildet sich dieses Sowohl-als-auch in den sternförmigen Strukturen teilautonomer Teams mit einem eindeutigen Entscheidungszentrum ab. Die Größe der Teams ist bei 8 +- 2 Personen nach oben limitiert.
Der Routinebetrieb liefert aber auch die Voraussetzungen für das Funktionieren im Ausnahmefall: gezieltes Training von Ausnahmesituationen, Reflexionsfähigkeit und – besonders wichtig – das Einander Kennen und Vertrauen. Durch die praktizierte Partizipation an Entscheidungsprozessen im Nicht-Krisenfall schafft man jenes Know how und jene Vertrauensbasis, die im Krisenfall nötig ist, die Qualität und Akzeptanz rascher und hierarchischer Entscheidungen sicherstellt.
Woran man eine expeditionale Organisation erkennt
Wer eine Expeditionsorganisation betritt, erkennt sofort ein klares Entscheidungszentrum. Man erkennt auch, wer Chef*in ist. Man sieht, worauf sich die Schlüsselpersonen spezialisiert haben und womit sie sich aufeinandersetzen: man sieht (im übertragenen Sinne) den*die Navigator*in, den*die Arzt*Ärztin, den*die Forscher*in und man erkennt die Mannschaft. Expeditionsorganisationen haben klare soziale Strukturen die auch für Außenstehende erkennbar sind. Auch Außenstehende können beobachten, wer zum Leitungsteam und wer zu den operativen Teams gehört. Die Mitglieder sind robust und funktional gekleidet. Überhaupt ist Funktionalität das vorherrschende Element in einer Expedition. „Gut ist, was unserem Vorankommen und unserer Sicherheit nützt“ so die Auffassung der Leute. Trotz der Funktionalität ist aber auch Platz für Persönliches. Bilder, Maskottchen, Glücksbringer oder Tagebücher, auch Bücherecken ohne Fachliteratur sind weiche Faktoren, die aber dann doch wieder funktional genützt werden: Sie werden gebraucht, weil das Leben einer Expeditionsorganisation hart ist. Soziale Veranstaltungen sind ein fixer Bestandteil. Eine expeditionale Organisation versteht es auch, Erfolge zu feiern. Dadurch entsteht der im Ernstfall nötige soziale Zusammenhalt. Expeditionsorganisationen erkennt man auch an ihren Planungshilfsmitteln, Karten und Navigationsinstrumenten. Expeditionen sorgen durch klare Kommunikation dafür, dass ihre Ergebnisse und der aktuelle Stand ihres Fortschritts für alle sichtbar sind. Eine Balanced Scorecard passt daher gut zu einer Expeditionsorganisation. Expeditionale Strukturen sind Vertrauenskulturen: Man kennt einander meist bereits lange und gut, Loyalität und Verantwortungsgefühl sind stark ausgeprägt. Es herrscht der Geist der Musketiere: Einer für alle – Alle für einen.
Die Stärken und Schwächen der expeditionalen Struktur
Wenn ein Sturm aufzieht, dann hat die Expeditionsorganisation bereits damit gerechnet. Sie überlebt weder durch Festigkeit noch durch Flexibilität. Sie überlebt, weil sie von ihrer Natur aus fürs Überleben ausgerichtet ist. Sie verhält sich wie Pinguine: Wenn Schneestürme mit über 150 Stundenkilometern über das Packeis fegen, dann drängen sich die Pinguine zu einem festen Knäuel zusammen, Körper an Körper wärmen sie sich gegenseitig. Dabei etablieren sie ein ausgeklügeltes Rotationssystem, nach dem die Pinguine am Rand regelmäßig von den Pinguinen in der Mitte abgelöst werden bevor diese abkühlen. Die Expeditionsorganisation neigt weder zu Regression, Aktionismus, Beschleunigung, Innovationsfeindlichkeit, Aggression, noch zu Tunnelblick. Ihre Stärken sind Kulturentwicklung, Achtsamkeit, Besonnenheit, Aufgeschlossenheit, Commitment und Fitness. Das Scheitern einer Expeditionsorganisation kann passieren, wenn sie ihre Vorteile nicht sorgfältig genug verfolgt hatte, weil sie beispielsweise zu wenig Achtsamkeit aufbringt und erhält, die Demut vor ihrem Auftrag und den Gefahren verliert und beginnt leichtsinnig zu werden. Die gescheiterten historischen Expeditionen machten in mindestens einem solchen Bereich entscheidende Fehler.
Expeditionsorganisationen in der Praxis
Klassische Beispiele für Expeditionsorganisationen in der Praxis sind neben historischen Expeditionen die Sondereinsatzkommanden der Polizei und des Militärs. Wer von Expeditionen lernen will, der kann von Organisationen lernen, die sich mit unvorhersehbaren Situationen beschäftigen wie Personenschutz in Bagdad, Geiselnahmen in der Sahara oder einer Terrorismusattacke in einer Großstadt. Sondereinsatzkommanden der Polizei und des Militärs sind expeditionale Strukturen nahezu in Reinkultur: Sie sind ständig mit dem Unbekannten beschäftigt und setzen dabei auf das Beherrschen des Bewährten. Sie legen starken Wert auf Funktionalität und das Verarbeiten von unsicheren oder nicht vorhandenen Informationen gehört zu ihrem Tagesgeschäft. Sogenannte Blaulichtorganisationen beispielsweise halten weitgehend reine expeditionale Strukturen vor. Im Wirtschaftsleben kommen Expeditionsorganisationen als solche selten vor. Sie existieren jedoch in vielen Organisationen temporär und partiell. Der Eintritt in einen neuen Markt und die Entwicklung eines neuen Produkts sind als Beispiele einer temporären und partiellen Expeditionsorganisation anzuführen. Risikokapitalinvestitionen oder Unternehmenssanierungen sind auch temporäre Expeditionsorganisationen. Bei beiden Beispielen betritt man Großteils Neuland. Dies trifft ebenso auf Joint Venture Zusammenschlüsse oder auf Unternehmensübernahmen zu. Ein Beispiel für das partielle Auftreten sind Innovationen im Bereich der Produkte und der Märkte. Als Grundsatz gilt: Je innovativer und je neuartiger die Innovation ist, desto stärker wird dieser Bereich der Organisation expeditionale Elemente entwickeln. Personal- und Organisationsentwicklungsabteilungen besitzen ebenso Merkmale der expeditionalen Organisation. Zusammengefasst sind die expeditionalen Strukturen jene, die besonders gut zum Entdecken geeignet sind. Das Paradebeispiel für expeditionale Strukturen in der Wirtschaft ist jedoch das Topmanagement, das sich mit strategischer Unternehmensführung auseinandersetzt. Die Gestaltung der Zukunft des Unternehmens ist stets eine Expedition. Und je unsicherer die Zukunft, desto wichtiger werden die Stärken der expeditionalen Strukturen. Ein Beispiel sind die sogenannten „Blauen Ozeane“. Das sind neuartige Produkt-Markt-Kombinationen wie es sie in jeder Branche von Zeit zu Zeit gibt bzw. durch deren Aufkommen überhaupt neue Branchen entstehen. Das Aufspüren solcher historischer Chancen, das Neuerfinden bestehender Produkte sind vergleichbar mit dem Entdecken neuer, ferner Länder. Ein anderes Beispiel dafür sind auftretende Krisen. Eine schwere Krise zu überstehen lässt sich mit einer Expedition zum Südpol vergleichen: Die Umweltbedingungen und die Anforderungen an die Organisation sind ähnlich. Expeditionsstrukturen, die ja gemacht sind, um Krisen zu überstehen, haben eine bessere Überlebenschance. Dies soll nun nicht heißen, eine Bürokratie müsse zu einer Expeditionsorganisation werden, um eine Krisensituation zu überstehen – ganz im Gegenteil! Dennoch kann man auch als Bürokratie von Expeditionen lernen und man kann expeditionale Elemente in die bürokratische Kultur einführen. Der wichtigste Aspekt des Imperativs „von Expeditionen lernen“ liegt aber darin, zu sehen, wie es einer Expeditionsorganisation gelingt, rabiates Verhalten zu vermeiden.
Aufgabe 9
Das ist die letzte und letztlich auch eine der schwierigsten Aufgaben, denn es ist notwendig, in eine noch unbekannte Zukunft zu blicken. Es wäre denkbar, dass wir in einer krisengeschüttelten Zeit vermehrt Ansätze wie den der expeditionalen Struktur brauchen. Es kann sogar sein, dass nur oder am ehesten diejenigen Firmen überleben, die so einen Ansatz beherrschen, als Gesamtorganisation oder zumindest als Teil.
Versuchen Sie folgende Aufgabe zu lösen:
Sie sind CEO (oder ein*e andere*r sehr wichtige*r Mitarbeiter*in , dessen*deren Funktion mit drei Buchstaben abgekürzt wird) und müssen das hier vorliegende Modell umsetzen. Wofür würde sich das am ehesten eignen, etwa in der Firma, in der Sie gerade sind? Welche Kraft hätte das? Wo müsste mit Widerstand gerechnet werden? Wenn das nicht funktioniert, nehmen Sie sich eine fiktive Firma und versuchen Sie, auf Expedition zu gehen. Wenn auch diese Frage zu schwierig ist, dann horchen Sie in sich hinein: Was löst dieser Ansatz bei Ihnen aus? Wären Sie der „Typ“ für so etwas? Was ist daran reizvoll und was stößt Sie eher ab? Wo würden Sie sich dem gewachsen fühlen und wo wären Sie „eher nicht der richtige Mann oder die richtige Frau?“ Und nun zur schwierigsten Frage: Welche Art der Krise müsste eintreten, damit genau diese Form der Organisationsstruktur notwendig wird?
| Ich habe entschieden... | ...und sie sind eingeladen, mit mir zu diskutieren: |
|---|---|
| 1. gar nichts | 1. ob etwas gemacht werden soll. |
| 2. dass etwas gemacht werden soll. | 2. was gemacht werden soll. |
| 3. was gemacht werden soll | 3. wann, wie, wo und von wem es gemacht werden soll. |
| 4. wann, wie, wo und von wem es gemacht werden soll. | 4. meine Beweggründe für meine Entscheidung |
| 5. alles | 5. nichts, sondern nur um zu hören, welche Konsequenzen es für Sie dabei gibt |
| 6. alles | 6. gar nichts |
1 repräsentiert die kooperativste Möglichkeit, da völlig offen bleibt, welche Funktionen von wem übernommen werden. Punkt 5 und 6 repräsentieren die autoritärste Form, da aufgrund der einseitigen oder gar nicht vorhandenen Kommunikation keine Möglichkeit für die Übernahme von solchen Funktionen seitens der Untergebenen vorgesehen sind.
Wichtig ist nun, dass eine Führungskraft nicht 1 lebt, wenn ihre MitarbeiterInnen zu keinerlei Selbständigkeit fähig sind. Deswegen ist dieses Modell gut als Anlass für Teamentwicklung geeignet, aber auch um den Weg für partizipativ-situative Führung zu ebnen. Dabei soll eine Führungskraft die einzelnen Mitglieder ihres Teams unterschiedlich stärken und entwickeln, so dass sie im Laufe des Prozesses immer mehr eigene Entscheidungen treffen können.
An dieses Modell angelehnt wurde das „Partizipationskontinuum“ entwickelt. Es soll anregen, den eigenen Führungsstil in Projekten zu reflektieren und weiterzuentwickeln.
In der folgenden Tabelle gibt es zuerst wieder die Spalte „Ich“, die an das Delegationskontinuum angelehnt ist. Auch die zweite Spalte folgt diesem Modell. In der dritten Spalte wird gezeigt, was aus dem jeweiligen Management-Stil entsteht und in der vierten Spalte gibt es die sich daraus ergebenden Herausforderungen.
Das Partizipationskontinuum
| Ich... | ...und ihr könnt: | Dabei entsteht | Herausforderungen dabei sind | ...stelle Informationen über Projekte, Planungen oder Ergebnisse zur Verfügung. | ...es euch organisieren, wie ihr sie bekommt: technisch und organisatorisch. ...sie euch abholen, wenn ihr wollt und sie findet und die Möglichkeiten habt, sie zu bearbeiten. | Informiertheit bei denen, die Infos wollen und bereit sind, dafür einiges zu tun. | Vor allem die Seite der „Machtlosen“, die Infos sozusagen „gnadenhalber“ holen können, muss trotzdem ein Gefühl der Partizipation aufbauen können, sonst verliert sich die Motivation. Die Mächtigen können sich nie sicher sein, dass diese Form der Partizipation den Machtlosen reichen wird. Öffentlichkeit wird zum Risiko. | ...stelle Informationen zur Verfügung und dazu die Medien, die man braucht, um sie zu rezipieren. | ...euch die Infos samt der Technik abholen und sie euch ansehen, wenn ihr wollt. | Informiertheit bei mehreren | s.o. zusätzlich: Aneignung technischer Kompetenz, Investition von Zeit und Energie, meist unbezahlt. | ...stelle Informationen zur Verfügung und dazu die Medien, die man braucht, um sie zu rezipieren. Zusätzlich trete ich noch aktiv an euch heran und sage euch, was vorhanden ist und wie man es liest und ermuntere euch, es abzuholen. | ...auf meine Initiative reagieren und die Informationen holen. | Informiertheit bei vielen | s.o. zusätzlich: Eine Auseinandersetzung mit der anderen Seite – Formen der Kommunikation müssen aufgebaut werden, die nicht mehr nur einseitig bestimmt werden. |...trete aktiv an euch heran, noch bevor ich eine Initiative starte und stelle euch Informationen darüber zur Verfügung. | ...die Informationen nehmen, die ich euch biete. | Informiertheit sowie ein Gefühl, sich an etwas beteiligen zu können, wenn man will. Das Partizipationsgefühl wird stärker, hat aber noch nicht an Qualität gewonnen. | s.o. | ...trete aktiv an euch heran und stelle Informationen zur Verfügung und bitte euch, dazu Stellung zu nehmen. | ...euch die Informationen abholen und einzeln dazu Stellung nehmen. | Informiertheit, ein Beteiligungsgefühl sowie das Gefühl, selbst was zu tun. Die Qualität schein schon eine andere zu sein. | Je weiter dieser Prozess voranschreitet, umso mehr „Partizipationstäuschung“ ist notwendig, denn Entscheidungskraft ist noch sehr ungleich verteilt. Zugleich verwandelt sich die Partizipation insofern, als Machtanreicherung bei den Machtlosen passiert, mehr Öffentlichkeit muss von beiden Seiten verkraftet werden. |...trete aktiv an euch heran und stelle Informationen zur Verfügung und bitte euch, dazu Stellung zu nehmen. Zusätzlich stelle ich eine Plattform zur Verfügung, auf der ihr euch organisieren könnt. | ...euch die Informationen abholen und euch auf der Plattform organisieren, miteinander kommunizieren und gemeinsame Meinungen bilden. | Beteiligungsgefühl, Gemeinschaftsgefühl, Gefühl einen Parteienstatus zu haben, wenngleich eher als Möglichkeit denn als Recht. | Gemeinschaft will organisiert sein. Innerhalb der Plattformen, Bürgerinitiativen etc. muss Organisation entstehen bzw. die Gruppendynamik muss gesteuert und reflektiert werden – sonst läuft man in Gefahr, sich aufzureiben, zu zerstreiten etc. |...organisiere ein Projekt, gebe euch die Informationen, errichte die Plattform und lade euch ein, in organisierter Form an den Sitzungen teilzunehmen und eure Meinungen einzubringen. | ...in organisierter Form mittun und an den Sitzungen teilnehmen und eure Meinungen einbringen. | s.o. | s.o. | ...organisiere ein Projekt, gebe euch die Informationen, errichte die Plattform und lade euch ein, in organisierter Form an den Sitzungen teilzunehmen und eure Meinungen einzubringen. Zusätzlich gibt es für euch ein aufschiebendes Veto gegen unsere Entscheidungen. | ...in organisierter Form mittun und an den Sitzungen teilnehmen und eure Meinungen einbringen. Ihr könnt ein Veto einlegen. | s.o. plus Gefühl, auf Entscheidungen in begrenztem Maße einwirken zu können. Eine erste Form der Abhängigkeit voneinander und somit von der Qualität der Kooperation und Kommunikation entsteht. | Wer von dem Veto übermäßig Gebrauch macht, wird scheitern – wer es nie tut, auch. Die Gegenseitig aufkeimende Abhängigkeit muss von beiden Seiten bewältigt werden. Der organisatorische Aufwand auf beiden Seiten steigt, man muss die Entscheidungen der anderen Seite versuchen zu antizipieren und entsprechend Einfluss darauf nehmen. | ...organisiere ein Projekt, schlage eine gemeinsame Infrastruktur vor und baue mit euch gemeinsam eine solche auf. Dann bringe ich die Ideen für das Projekt ein und entwickle eine gemeinsame Vorgehensweise. Ich zahle die Infrastruktur sowie die meisten Projektkosten. | ...mitarbeiten an der Infrastruktur und der Organisation. Ihr könnt meine Ideen ergänzen und am Projekt mitarbeiten. Kosten, die ein gewisses Budget übersteigen, müsst ihr selbst finanzieren. | s.o. plus Gefühl, mitzuarbeiten Die „echte“ Mitarbeit erzeugt eine neue Qualität, in der auch die „Mächtigen“ erste Selbstzweifel entdecken und anfangen, ihre eigene Situation zu reflektieren. | Von beiden Seiten sind jetzt große Ressourcen gefragt. Budgetfragen tauchen auf beiden Seiten auf. Die Kooperation muss reflektiert werden, da sie selbst zum Thema wird. | ...baue gemeinsam mit euch ein Projekt auf, stelle all meine Daten sowie eine gewisse Manpower zur Verfügung. Ich zahle die Infrastruktur und meine eigenen Projektkosten. Ich finanziere das Ergebnis und entscheide, was davon wie umgesetzt wird. | ...mit mir gemeinsam das Projekt aufbauen, eure Daten sowie Manpower zur Verfügung stellen und eure Projektkosten zu tragen. | Partizipationsgefühl in der Art, dass man Teil der Gesamtentwicklung ist und auch verantwortlich dafür. Erste Ansätze der Partnerschaft entstehen, Nachhaltigkeit und über das Projekt hinausragende Kooperationsgedanken entstehen. | Beide Teile müssen einander ernst nehmen, meist mehr, als sie bereit sind zu akzeptieren. Frust und Enttäuschung während des Prozesses sind zu verkraften und zu reflektieren. Externe Begleiter müssen mit einbezogen und gesteuert werden. Mehrere Ebenen der Einigung werden notwendig. | ...baue alles gemeinsam mit euch auf, trage meinen Teil an den Kosten und entscheide gemeinsam mit euch, was umgesetzt wird. Die Umsetzung zahle ich. | ...mit mir das Projekt aufbauen und durchziehen. Ihr entscheidet mit, was davon wie umgesetzt wird. | s.o. plus das Gefühl der Partnerschaft in begrenztem Rahmen | Echte Partnerschaft entsteht und verlangt von allen Beteiligten, damit zurecht zu kommen. | ...schlage ein Projekt vor bzw. hänge mich an einen von euren Vorschlägen an, ziehe es mit euch gemeinsam durch, zahle meinen Teil, entscheide mit, was wie umgesetzt wird und trage meinen Teil der Umsetzungskosten | ...eigene Projektvorschläge einzubringen, mit mir das Projekt aufzubauen, mit mir zu entscheiden, was wie umgesetzt wird und euren Teil der Umsetzungskosten selbst zu tragen. | Gefühl echter Partnerschaft: Gleichwertigkeit, Vertrauen etc. | Die „neue Macht“ muss von Seiten der ursprünglich Machtlosen bewältigt werden. Die Mächtigen müssen die Kraft der Partnerschaft erkennen und sich selbst ebenso weiterentwickeln.
Literaturverzeichnis
Bleicher, K. (2006): Management im Wandel von Wirtschaft und Gesellschaft Randbemerkung. Künzelsau: Swiridoff.
Brunnmayr-Grüneis, P. (2006): Lernraum. In Heimerl, P. et al. (Hrsg.): Expedition statt Organisation. Bern: Haupt, S. 249–321.
Burns, T./Stalker, G. M. (1961): The Management of Innovation. London: Tavistock.
Crozier, M./Friedberg, E. (1979): Macht und Organisation: Die Zwänge kollektiven Handelns. Königstein: Athenäum.
Emery, F. E./Trist, E. L. (1965): The causal texture of organizational environments. In: Human Relations 18 (1), S. 21-32.
Gareis, R./Titscher, S. (1990): Projektarbeit und Personalwesen. In: Gareis, R. (Hrsg.) (1990): Projekte und Personal. Projektmanagement-Tag. Wien.
Glasl, F./Lievegoed, B. C. J. (1993): Dynamische Unternehmensentwicklung: Wie Pionierbetriebe und Bürokratien zu schlanken Unternehmen werden. Bern et al.: Haupt.
Hedberg, B. L. T./ Nystrom, P. C./ Starbuck, W. H. (1976): Camping on Seesaws: Prescriptions for a Self-Designing Organization. In: Administrative Science Quarterly. S. 41 – 65.
Heimerl, P. (2009): Zur expeditionalen Organisationsentwicklung. Bern: Haupt.
Heimerl, P. et al. (2006): Expedition statt Organisation. Organisationszukunft ermöglichen mittels Lernräumen, Organisationsaufstellungen und Großgruppenveranstaltungen. Bern et al.: Haupt.
Heimerl, P./Loisel, O. (2005): Lernen mit Fallstudien in der Organisations- und Personalentwicklung. Anwendungen, Fälle und Lösungen. Wien: Linde.
Heimerl-Wagner, P./Herbek. P. (1994): Lean Banking: Perspektiven der strukturellen Entwicklung großer Universalbanken vor dem Hintergrund des Kontingenzsatzes. Journal für Betriebswirtschaft. Nr. 5. S.190-215.
Heimerl-Wagner, P./Meyer, M. (1999): Organisationen in NPOs. In: Badelt, C. (Hrsg.): Handbuch der Nonprofit Organisationen: Strukturen und Management. Stuttgart: Schäffer-Poeschel.
Heintel, P./Krainz, E. E. (1988): Projektmanagement. Eine Antwort auf die Hierarchiekrise? Wiesbaden: Gabler.
Hull, C. L. (1951): Essentials of behavior. New Haven.
Kasper, W. (1987): Was alles Erkennen übersteigt. Besinnung auf den christlichen Glauben. Freiburg: Herder.
Königswieser, R./Hillebrand, M. (2005): Einführung in die systemische Organisationsberatung. Heidelberg: Carl-Auer-Systeme.
Kuhn, T. (1970): The Structure of Scientific Revolutions. Chicago: The University of Chicago Press.
Laske, St./Meister-Scheytt, C./Küpers, W. (2006): Organisation und Führung. Münster/New York/München/Berlin: Waxmann.
Luhmann, N. (1984): Soziale Systeme: Grundriss einer allgemeinen Theorie. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
Mack, J. (2000): Softwareentwicklung als Expedition: Entwicklung eines Leitbildes und einer Vorgehensweise für die professionelle Softwareentwicklung. Vortrag auf dem Treffen der GI und ACM-Regionalgruppe Hamburg am 24.11.2000 in Hamburg.
Mack, J. (2001): Softwareentwicklung als Expedition: Entwicklung eines Leitbildes und einer Vorgehensweise für die professionelle Softwareentwicklung. Berlin: Logos.
Michels, R. (1911/1925): Zur Soziologie des Parteiwesens in der modernen Demokratie: Untersuchungen über die oligarchischen Tendenzen des Gruppenlebens. Leipzig: Kröner.
Mintzberg, H. (1982): Organisationsstruktur: modisch oder passend? In: Harvardmanager, 4/Heft 2, S. 7-19.
Mintzberg, H. (1992): Die Mintzberg-Struktur. Organisationen effektiver gestalten. Landsberg/Lech: Moderne Industrie.
Morgan, G. (1986): Images of Organization. Newbury Park, Cal: SAGE.
Neuberger, O. (1985): Unternehmenskultur und Führung. Augsburg: Universität Augsburg.
Osterloh, M./Frost, J. (1996): Prozessmanagement als Kernkompetenz: Wie sie Business Reenginiering strategisch nützen können. Wiesbaden: Gabler.
Pacher, B. (2006): Organisationsaufstellungen. In: Heimerl, P. et al. (Hrsg.): Expedition statt Organisation. Bern: Haupt, S. 121–247.
Reber, G. (1982): Projektmanagement. Arbeitsunterlage für den Post Graduate Management Universitätslehrgang der Wirtschaftsuniversität in Wien.
Schein, E. H. (1984): Coming to a new awareness of organizational culture. In: Sloan Management Review Nr. 2, S.3-16.
Scheuss, R. (1985): Strategische Anpassung der Unternehmung. St. Gallen: Diss.
Schlötter, P. (2006): Das Spiel ohne Ball im Unternehmen: Kommunikation sichtbar machen und verbessern. Stuttgart: Klett-Cotta.
Schwarz, Gerhard: Die Heilige Ordnung der Männer: Hierarchie, Gruppendynamik und die neue Rolle der Frauen, 5. überarbeitete Auflage, VS-Verlag, Wiesbaden 2007
Schwarz, Gerhard: Führen mit Humor – ein gruppendynamisches Erfolgsrezept; 2. Auflage, Gabler-Verlag Wiesbaden 2008
Schwarz, Guido: Qualität statt Quantität – Motivforschung im 21. Jahrhundert; Verlag Leske & Budrich, Opladen 2000
Selznick, P. (1948): Foundations of the theory of organization. In: American Sociological Review, S. 25-35.
Simon, F. B. (2004): Gemeinsam sind wir blöd!? Die Intelligenz von Unternehmen, Managern und Märkten. Heidelberg: Carl-Auer-Systeme.
Simon, F. B. (2007): Einführung in die systemische Organisationstheorie. Heidelberg: Carl-Auer-Systeme.
Smith, A. (1776): An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. (dt: Untersuchung über Wesen und Ursachen des Reichtums der Völker.). Stuttgart: Utb.
Sydow, J. (1992): Strategische Netzwerke und Transaktionskosten: Über die Grenzen einer transaktionskostentheoretischen Erklärung der Evolution strategischer Netzwerke. In: Staehle, W. H./Conrad, P. (Hrsg.): Managementforschung 2. Berlin und New York: De Gruyter, S. 239-311.
Sydow, J. (1993): Strategie und Organisation international tätiger Unternehmungen – Managementprozesse in Netzwerkstrukturen. In: Ganter, H.-D./Schienstock, G. (Hrsg.): Management aus soziologischer Sicht. Wiesbaden: Gabler, S. 47-82.
Türk, K. (1989): Neuere Entwicklungen in der Organisationsforschung: ein Trend-Report. Stuttgart: Enke.
Weichsler, M. (2006): Was Universitäten von wissensbasierten Unternehmungen lernen können. Masterthese an der PEF Privatuniversität für Management (unveröffentlicht). Wien.
Weick, K. E. (1985): Der Prozeß des Organisierens. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
Weick, K. E./Sutcliffe, K. M. (2001): Managing the Unexpected. San Francisco: Jossey-Bass.
Weick, K. E./Sutcliffe, K. M. (2007): Das Unerwartete managen: Was Unternehmer aus Extremsituationen lernen. Stuttgart: Klett-Cotta.
Willke, H. (1994): Systemtheorie II: Interventionstheorie: Grundzüge einer Theorie der Intervention in komplexe Systeme. Stuttgart, Jena: Gustav Fischer.
- ↑ Aus "Paths to Power". © 1980 by Natascha Josefowitz, erschienen bei Addison-Wesley Publishing Co. Inc., Reading, Massachusetts.
- ↑ Weick 1985, S. 129
- ↑ Willke 1994, S. 155
- ↑ Cohen/March/Olsen (1972), zit. in: Weick 1985, S. 38
- ↑ Heintel/Krainz 1988, S. 1
- ↑ Gareis/Titscher 1990, S. 17
- ↑ Heintel/Krainz 1988, S. 9 ff.
- ↑ Staehle 1999, S. 774
- ↑ Heintel/Krainz 1988, S. 41 ff.
- ↑ Reber 1982, S. 33
- ↑ Reber 1982, S. 33 f.
- ↑ Heintel/Krainz 1988, S. 47
- ↑ Reber 1982, S. 37 ff.
- ↑ Osterloh/Frost 1996, S. 35
- ↑ Osterloh/Frost 1996, S. 33
- ↑ Sydow 1993, S. 104
- ↑ Das Kriterium der strategischen Führung ist jedoch auch in regionalen Netzwerken zu beobachten und gilt sogar als deren Erfolgsfaktor.
- ↑ Sydow 1992, S. 258
- ↑ Sydow 1992, S. 271
- ↑ Heimerl-Wagner/Meyer 1999, S. 231
- ↑ Kasper 1987, S. 147 f.
- ↑ Türk 1989, S. 60
- ↑ Glasl/Lievegoed 1993, S. 100
- ↑ Die Organismusmetapher wird hier in einem etwas anderen Sinn als im Open systems approach verwendet. Während sie dort in Verbindung mit Evolution bzw. Anpassung an Umweltbedingungen und damit Offenheit markierend verwendet wird, wird hier im Sinne des Burns/Stalker‘schen (1961) „organischen” Modells eher ein interner Bezug auf Dezentralisierung, Teamentwicklung, partizipative Führung, Identitätsrekonstruktion etc. hergestellt.
- ↑ Glasl/Lievegoed 1993, S. 99 ff.
- ↑ Brunnmayr-Grüneis 2006
- ↑ Pacher 2006, S. 130
- ↑ Heimerl et al. 2006
- ↑ Mack 2000, S. 49 f.; Mack 2001